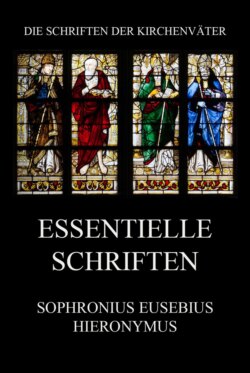Читать книгу Essentielle Schriften - Sophronius Eusebius Hieronmyus - Страница 71
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Fußnoten
Оглавление1. Sallustius Crispus, De coniur. Catil. VIII, 4.
2. Vgl. Dan. 7, 6 und 8, 21. Der 8, 3 zuerst genannte Widder wird jedoch nicht auf Alexander, sondern nach 8, 20 auf die Könige der Meder und Perser bezogen. Vielleicht ist Hieronymus schuldlos an dem Irrtum, da nach zwei Vatikanischen Handschriften arietem durch bellua ersetzt ist und in einer anderen ganz fehlt.
3. Arrian, Anabasis I, 12.
4. Epiphanius lebte von 315 — 403. Der in Frage stehende Brief ist nicht mehr erhalten.
5. Vgl. Homer, Od. XII, 85 ff.
6. Thabatha ist das heutige Chirbett umm et-Tût, das ungefähr 7,5 km südlich von Gaza liegt. Antonius von Cremona berichtet von einer bereits im 14. Jahrhundert dort befindlichen Hilarionkirche. Nach Schiwietz II, 104 Anm. 1.
7. Apg. 5, 1ff.
8. Luk. 14, 33.
9. Hafenstadt von Gaza, später nach Constantin, der es zur Stadt erhob, Constantia genannt, vgl. Sozom. h. e. V, 3; heute El-mine oder Maimas.
10. Zur näheren Lokalisierung der Einöde des hl. Hilarion vgl. Schiwietz II, 106 f.
11. Gegensatz zwischen dem Tode des Körpers und dem der Seele.
12. Is. 14, 14.
13. 2 Thess. 3, 10.
14. Vgl. zu den Kapiteln 6 ― 8 16 f.
15. Exod. 15, 1. 21.
16. Ps. 19, 8.
17. Dimidium sextarium. Der Sextarius ist der 48. Teil der amphora. Zwanzig amphorae sind gleich einem culcus, der 525,27 l hält. Hilarion genoß also täglich etwa 1/4 l Linsen.
18. Die römische Unze war ein Zwölftel As und wog 27,288 Gramm.
19. Eleutheropolis, das Ramath Lechi des Richterbuches (15, 17), war ein bedeutender Bischofssitz zur Zeit des Eusebius und Hieronymus, die in ihrem Onomastikon viele Orte nach dieser Stadt bestimmen. Sie liegt zwischen Jerusalem und Askalon. Ptolemäus V, 16,6 nennt sie Baitogabra, welcher Name sich im heutigen Beth Dschibrîn erhalten hat. Der griechische Name führt sich auf Septimius Severus zurück und ist seit 202 nachweisbar. Er verschwand wieder, nachdem die Sarazenen 796 den Ort zerstört hatten. 1134 erbauten die Kreuzfahrer an der Stelle eine Festung.
20. Luk. 5, 31.
21. Aristaenete und Helpidius, der praefectus praetorio Orientis des Constantius, sind auch sonst geschichtlich nachweisbar. Helpidius wurde trotz seiner Beliebtheit und Rechtschaffenheit von Julian abgesetzt (Ammianus Marcellinus XXI, 6, 9). Seine Gattin wird vom heidnischen Rhetor Libanius (I. IV epist. 44 ad Helpidium) sehr gelobt. Nach Schiwietz II, 111 Anm. 2.
22. Marnas, den Hieron. noch epist. 107 ad Laetam c. 2 und comm. in Is. 17, 1 ff. erwähnt, war der Herr aller Menschen (מַר אֱנָשׁ). Er wurde zu Gaza verehrt, wo man in ihm den kretischen Zeus sah.
23. Rhinocorura oder Rhinocolura, die heutige Oase und Grenzfestang El Arisch, wurde früher bald zu Syrien bald zu Ägypten gerechnet. Es war Stapelplatz für den arabischen Handel. In der Nähe dieser Stadt fließt der so oft in der Hl. Schrift genannte „Bach Ägyptens“ ins Mittelländische Meer. Erwähnt wird der Ort Liv. XLV, 11; Strabo 741, 759, 781; Flav. Jos., Ant. XIV, 14,2.
24. Vgl. Joh. 9, 6.
25. Aila, das alttestamentliche Elath, kommt in der klassischen Literatur öfters mit vielfach ändernder Namensbezeichnung vor. (τὰ Αϊλανα, Αἰλανή, Ἐλάνα, Αῖλας etc.). Es war Ausgangspunkt für Salomos Flotte und blieb wichtiger Handelsplatz bis in die spätrömische Zeit. Es liegt an der östlichen Spitze des Roten Meeres in der Nähe des heutigen Akaba.
26. 2 Kön. 5, 20 ff.
27. Apg. 8, 18 ff.
28. Es gab drei verschiedene Abstufungen des römischen Bürgerrechts: das eigentliche und volle ius civitatis, das ius Latii, welches jenem am nächsten kam, und das ius Italicum, welches an römische Städte außerhalb Latiums verliehen wurde. Dieselben hießen municipia und behielten sonst ihre eigentlichen Gewohnheiten und ihre Verfassung. Später wurde das ius Italicum auch an andere fremde Städte oder einzelne Personen außer Italien verliehen, wie an Paulus und den hier genannten Rosselenker. Schiwietz II, 121 faßt Italicus als Eigennamen des Beamten auf.
29. Consus, welches Wort Hieronymus als Ratgeber deutet andere von condere ableiten, ist ein altitalischer Gott der Erde und der Feldfrüchte. Den Beinamen Consus führte später Neptun, dem zu Ehren die genannten Wettrennen am 21. August und 15. Dezember (Consualia) stattfanden. Vgl. Liv, I, 9; Tert., De spectaculis, c. 5.
30. Memphis (altägypt. Men-nefer) soll von dem ältesten historisch nachweisbaren ägypt. König Menes um 3300 v. Chr. gegründet sein. Es ist die Hauptstadt an der Grenze der beiden Reiche. — Liebeszauber war bei den Ägyptern an der Tagesordnung. Vgl. Wiedemann, Die Religion der alten Ägypter. Münster 1890, 153 f.
31. Asklepios ist der Heilgott der Alten. Im dem ägyptischen Pantheon entspricht ihm Imhotep, der hauptsachlich in Memphis verehrt wurde.
32. Der Candidatus, auch quaestor Caesaris genannt, war ein Beamter des römischen Kaisers, der im Senate die Verordnungen zu verlesen hatte. Tac. Ann. XVI, 27.
33. Ein zweihöckeriges Kamel.
34. Job 2.
35. Mark. 5, 1 ― 13
36. 1 Kor. 7, 31.
37. Die Wüste Kades (Ps. 28, 8) ist ein Teil der arabischen Wüste. Kades ist im heutigen ’Ain Kadîs östlich vom Wâdi Gerûr, etwa 80 km südlich von Bîr es-Seba wieder gefunden worden.
38. E. Robinson identifiziert Elusa, das zuerst von Ptolemäus unter den Städten Idumäas erwähnt wird, mit der Ruinenstätte El-Klulasah. (E. Robinson, Palästina und die südlich angrenzenden Länder I, 335. Halle. 1841.) Es ist das heutige Halasa südwestlich von Bîr es-Seba.
39. Daß die Sarazenen den Morgenstern verehren, erwähnt Hieronymus noch im Amoskommentar 5, 25 ff. (M. XXV, 1056). Dasselbe schreibt der Mönch Gordianus in seiner Vita S. Placidi, num. 61, wo er berichtet, daß der Sarazenenfürst Abdallah den Kult des Lucifer auszubreiten suchte, um das Christentum auszurotten.
40. Die Lagene, eigentlich eine zum Abziehen des Weines bestimmte Flasche, bezeichnete ursprünglich bei den Griechen ein bestimmtes Maß. Sie faßte zwölf Kotylen. (Eine Kotyle = 0,274 l.) Der Weinberg lieferte also fast 1000 Liter.
41. Matth. 6, 5. 16.
42. Hilarion denkt an die unter c. 33 erwähnte Zerstörung seiner Niederlassung durch die Einwohner von Gaza unter Julians Regierung, die wahrscheinlich auf arianische Quertreibereien zurückzuführen war.
43. Betilium ist gleich Bethelia. Dieser Flecken gehörte zum Stadtbezirk von Gaza, besaß prächtige Tempel und ein Pantheon auf einem künstlichen, die ganze Stadt beherrschenden Hügel. Musil identifiziert den Ort mit dem südlich von Gaza liegenden, 135 m hohen Weli eš-Sejch Nûrân. Nach Schiwietz II, 123.
44. Lychnos ist eine Wüste mit Mönchsniederlassungen in der Nähe der Einsiedelei des hl. Hilarion. Nach Schiwietz II, 114; 124 Anm. 3.
45. Castrum Theubatum ist identisch mit Thaubastheum, einer Grenzfestung Unterägyptens an der Ostseite des Nils, nicht weit vom Serapeum an den Bitterseen.
46. Unter Constantius wurden sechzehn Bischöfe Ägyptens verbannt. Unter diesen befindet sich auch ein Dracontius, der wohl dieselbe Persönlichkeit ist wie der von Athanasius zum Bischof von Hermupolis erhobene Mönch gleichen Namens. Vgl. Tillemont, Mémoires pour servir à l’hist. ecclés. des six premiers siècles, VIII, 145-147; 171.
47. Babylon ist ein altrömisches Kastell. Seine Ruinen liegen westlich von dem heutigen Fostât oder Alt-Kairo. Nach Schiwietz II, 114 Anm. 2.
48. In der S. 58 Anm. 5 genannten Liste befindet sich auch der in Fragen des Kirchenrechts nicht gerade skrupulöse Philo von Cyrene, der sich anscheinend später der Sekte der Luciferianer anschloß. Es ist leicht möglich, daß er mit dem von Hieronymus erwähnten Philo identisch ist. Vgl. Tillemont VIII, 171f.; 234.
49. Aphroditon oder Aphroditopolis am östlichen Nilufer ist das heutige Atfîh in Mittelägypten. Vgl. Schiwietz II, 114 Anm. 2.
50. Dieser sog. Antoniusberg lag zwischen dem obengenannten Babylon und der mittelägyptischen Stadt Heraclea Magna nach dem Roten Meere zu. Schiwietz I, 71 Anm. 16.
51. Matth. 25, 24; Luk. 19, 21.
52. Bruchium (Προυχεῖον, Βρούχιον, Βρύχιον) war der spätere Name für jenen Stadtteil Alexandrias, der früher Βασιλεία hieß.
53. Die Oasis des Jupiter Ammon in der libyschen Wüste.
54. Auf Julian, der 363 im Kriege gegen die Perser gefallen war, folgte Jovian.
55. Paraetonium ist eine Stadt in der westlich von Ägypten gelegenen Küstenlandschaft Marmarica. Strabo 40. 798. 799. 809. 814. 838.
56. Schiwietz liest statt Gazanus einen Personennamen Zazanus, der sich auch in einigen Handschriften nachweisen läßt.
57. Pachynum ist das südöstliche Vorgebirge Siziliens; heute Kap Passero.
58. Matth. 5, 14.
59. Scutarii waren nach Ammianus Marcellinus in der späteren Kaiserzeit eine Art mit Schilden bewaffnete Leibgarde.
60. Es ist eine von Constantin erbaute fünfschiffige Basilika, die Vorgängerin der jetzigen Peterskirche. Vgl. Grisar, Geschichte Roms und der Päpste im Mittelalter. I, 238 f. Freiburg 1901.
61. Joh. 2, 11.
62. Matth. 10, 8.
63. Das Altertum kannte mehrere Städte dieses Namens. Welche gemeint ist, läßt sich aus dem Text nicht erkennen.
64. Das heutige Ragusa.
65. Am 21. Juli 365. Dieses Erdbeben erwähnen auch Ammianus Marcellinus, XXVI, 15f.; Socrates h. e. IV, 3; Sozomenus h. e. VI, 2; Hieronymus, Chronicon ad annum secundum Valentiniani.
66. Nach Matth. 17, 19 und Mark. 11, 23.
67. Jetzt Spalato, in dessen unmittelbarer Nähe noch heute ein Dorf Salona liegt.
68. Südostspitze des Peloponnes.
69. Jetzt Cerigo.
70. Matth. 14, 31.
71. Paphus (jetzt Baffo), aus der Hafenstadt Neupaphus und dem drei Stunden entfernten Altpaphus bestehend, eine phönizische Kolonie (von Cinyras gegründet) an der Südwestküste von Cypern, war berüchtigt durch seinen unsittlichen Kult der Venus, deren Tempel 1887 von den Engländern ausgegraben wurde.
72. Z. .B. Verg. Aen. X, 51; Hor. Carm. I, 30, 1.
73. Salamis, der Bischofsitz des hl. Epiphanias an der Ostküste Cyperns, wurde später nach Constantin Constantia genannt.
74. Curium lag an der Südküste von Cypern. Strabo. 683.
75. Lapethus war eine lakonische Kolonie und Hafenstadt auf Cypern. Strabo. 682.
76. Eine Gegend im nordwestlichen Teile des Nildeltas. (Nil = Βουκολικὸν στρόμα bei Herodot II, 17). Die Bewohner waren eine räuberische Hirtenbevölkerung, welcher die sumpfigen Niederungen bequemen Unterschlupf boten.
77. Apg. 3, 6.
78. Kukulla ist eine Kapuze, welche an der Paenula, einem langen, ärmellosen Mantel, befestigt wurde.