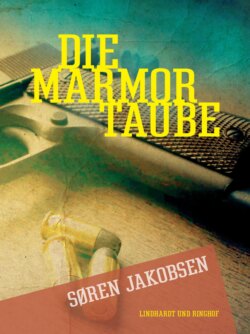Читать книгу Die Marmortaube - Søren Jakobsen - Страница 4
1.
ОглавлениеEs war die allzu perfekte Verhaftung eines Zivilfahnders in Kopenhagens Innenstadt, die zur Versetzung der Kollegen Søndergaard und Petersen in eine andere Fußstreife der Polizei führte. Der Zivile und seine Vorgesetzten beschwerten sich durchaus nicht, im Gegenteil, sie stellten die Verhaftung als besten Beweis für ihre Verkleidungskünste und Fähigkeiten hin, im Milieu unterzutauchen. Polizeiinspektor Aage Thomsen allerdings zog es vor, die unglücklichen Helden zu versetzen. Seine Überlegungen waren höchst simpel: je weniger Kontakt Søndergaard und Petersen mit der Bevölkerung hatten, desto weniger Ärger hatte er.
Die beiden Ordnungshüter konnten aber auch nicht einfach hinter einen Schreibtisch gesetzt werden. Wenn die Polizei schon immer weniger Verbrechen aufklärt, muß sie wenigstens ihren pädagogischen Einsatz erhöhen. Wenn jemand mit einer Anzeige aufs Revier kommt und erfahren muß, daß bei Sachbeschädigungen oder gewöhnlichem Einbruch gar nicht erst ermittelt wird, muß der Beamte in der Lage sein, dem Betroffenen, der den letzten Rest seines Glaubens an den Rechtsstaat zu verlieren droht, ein kurzes Referat über die knappe Personaldecke der Polizei zu halten. Gelingt dies, wird der Bürger die Wache mit dem Gefühl verlassen, daß er sich eigentlich schämen müsse, der Polizei mit einer derartigen Bagatelle zur Last gefallen zu sein.
Für diese Pufferfunktion fehlte Søndergaard und Petersen jedoch die Erfahrung.
Søndergaard und Petersen wurde als neue Dienststelle das 2. Revier in der Store Kongensgade zugewiesen. Den eigentlichen Grund ihrer Versetzung erfuhren sie nie. Sie waren naiv genug, den Vorgang als Anerkennung ihrer Dienste zu interpretieren.
Auf höherer Ebene hatte man allerdings das Gefühl, es hier mit relativ unkonventionellen Personalentscheidungen zu tun zu haben. Der Personalchef bat Thomsen um nähere Erläuterungen. Thomsen erledigte das mit einer Bemerkung, die nicht unbedingt zur Aufnahme in die Akten geeignet war:
»Wenn die Jungens in Nyhavn auf Streife gehen und sie verhaften wirklich mal jemanden ohne Grund, wird es sich höchstwahrscheinlich um einen besoffenen Schweden handeln. Und meiner Erfahrung nach beschweren sich besoffene Schweden nie. Wie du weißt, lege ich persönlich allergrößten Wert darauf, daß meine Leute mit äußerster Zurückhaltung vorgehen, wenn abzusehen ist, daß es zu Klagen vor Gericht kommen kann.«
Der Personalchef verstand sehr gut. Cleverer Bursche, dieser Thomsen, dachte er sich.
Auf dem 2. Revier konnten sich die Polizeiassistenten Søndergaard und Petersen in aller Ruhe einarbeiten.
Ihre wichtigste Aufgabe bestand in der Kontrolle der systematischen Falschparker vor den Botschaften in Østerbro. Ihre regelmäßigen Berichte ans Außenministerium allerdings waren nur für den internen Gebrauch bestimmt. Diplomaten können nicht belangt werden, aber das hieß noch lange nicht, daß sie nicht kontrolliert wurden.
Ausführlich erklärte ihnen der Revierleiter, warum eine so bedeutende Aufgabe nicht von städtischen Angestellten übernommen werden konnte. Eine komplizierte Geschichte für Søndergaard und Petersen: Mitten in Kopenhagen gelten Botschaften als exterritoriales Gebiet; es gibt die Wiener Konvention und besondere Rechte für Diplomaten – das Diplomatische Corps darf Schnaps und Zigaretten zollfrei einkaufen, ihre Wagen haben blaue Nummernschilder.
Von größerer Bedeutung war die Beziehung des 2. Reviers zum königlichen Hof. Patrouillefahrten rund um Amalienborg durfte man erst fahren, wenn man sich als besonders vertrauenswürdig erwiesen hatte.
Es verging einige Zeit, bis Søndergaard und Petersen ihre Chance bekamen. Erst einmal mußten Schwarzfahrer aus der S-Bahn von der Østerport Station abgeholt und eine Menge Besoffener in die Ausnüchterungszellen geschleppt werden – aber nicht eine interessante Demonstration fand vor den Botschaften statt. Darauf warteten die Kollegen, seit sie die Polizeischule verlassen hatten. Ihre Knüppel hatten sie bislang nur zur Zierde getragen.
Allerdings machten Søndergaard und Petersen bei ihrem langweiligen Dienst auch keine Fehler, und endlich ließ sie ihr Einsatzleiter auf dem Amalienborg Slotsplads Streife fahren. Das erhöhte zumindest ihr Prestige im Hause.
Der warme Augustabend, den Søndergaard und Petersen laut Wachplan in ihrem Streifenwagen zubringen mußten, schien nicht aufregender zu werden als die vorangegangenen Hundestreifen. Eine ausgestorbenere Gegend als das Botschafts- und Büroviertel an der Bredgade wird sich am Wochenende in Kopenhagen kaum finden lassen.
Das Wetter machte den beiden zusätzlich zu schaffen. Wie ein beschlagener Klarsichtbeutel hielt der Smog die Feuchtigkeit des Spätsommers gefangen.
Man brauchte nicht lange im Auto zu sitzen, bis die Kleidung am Körper klebte. Bereits nach der ersten Runde irritierten Søndergaard die feuchten Flecken, die sich unter seinen Achselhöhlen ausbreiteten und bald auch auf der Brust zu sehen waren. Søndergaard kurbelte das Seitenfenster noch ein Stück runter.
»Du holst dir die Gicht, bevor du fünfundvierzig bist«, knurrte Petersen. Er konnte Zug nicht ausstehen.
»Das Risiko muß ich eingehen ... ich muß mich abkühlen.«
»Willst wohl noch mit Lene zum Tanzen?«
Søndergaard nickte.
Zu seiner Enttäuschung fragte Petersen nicht weiter. Petersen war einige Jahre älter als er, verheiratet und hatte Kinder. Wie die Meisten in dieser Situation hatte er die hektischen Freitagund Samstagabende längst hinter sich. Für ihn war die Jagdsaison vorbei.
»Können wir uns schon eine Pause erlauben? Ich habe Hunger.« Petersen fummelte an der Metallklammer des kleinen Notizblocks. Sie fuhren an den letzten Häuserreihen Nyboders vorbei. Der weiße Opel schaukelte, als sie um die scharfe Kurve am Ende der Store Kongensgade bogen. Die Tachonadel zitterte an der Markierung der innerhalb der Stadt zulässigen Sechzig.
»Noch eine Runde«, meinte Søndergaard.
Petersen guckte auf die Uhr am Armaturenbrett. »Ok, ’ne kurze.« »Kongens Nytorv, Holbergsgade, Toldboden, Amalienborg und dann ab zu einer frischen Tasse Kaffee.«
Søndergaard grinste. »In den Amaliehaven willst du nicht?«
»Den gucken wir uns nur aus dem Auto an. Ich hab’ viel zu viel Hunger, um noch in irgendwas reinzugeraten.«
»Okay.«
Ein paar Minuten später rollte die Polizeistreife 023 langsam auf den kopfsteingepflasterten Schloßplatz. Søndergaard, der eigentlich auf das Steuer achten sollte, war beschäftigt. Reine, persönliche Neugierde. Brannte Licht im Palais von Christian IX., war die königliche Familie zu Hause, und konnte er Lene erzählen, daß er auf sie aufpassen mußte?
Das Palais war dunkel. Margarethe und Henrik hatten wohl genug von all den Touristen, die in dem neuen Park hinter dem Schloß herumrannten und sich auf die Mauern stellten, um wenigstens einen kurzen Blick auf die Regentenfamilie zu werfen. Vom höchsten Punkt des Parks aus konnte man genau in die Bel-Etage des Schlosses gucken.
Wenn man zwischen einer Reihe schöner Schlösser wählen kann, läßt sich nichts dagegen sagen, daß man ab und zu umzieht, um sein Privatleben ungestört von aller Öffentlichkeit genießen zu können. An diesem Abend gefiel das dem treuen Untertan Søndergaard gar nicht. Die Möglichkeit, sich interessant zu machen, war dahin. Er mußte sich abreagieren.
Aber jeder Versuch, sich zu unterhalten, war aussichtslos. Zu laut dröhnten die Reifen auf dem Kopfsteinpflaster. Søndergaard gab trotzdem nicht auf.
»Was ist?« Petersen hatte nur mitbekommen, daß Søndergaard über Prinz Henrik redete.
Søndergaard wandte ihm den Kopf zu, es gelang ihm aber nicht mehr, seine Meinung über den Prinzen zu wiederholen. Über Sprechfunk kam eine Meldung.
»023, bitte kommen ... bitte kommen«, forderte der Funker des 2. Reviers.
Petersen fischte das Mikrophon aus der Halterung.
»Hier 023, Amalienborg Slotsplads.«
»023, bitte fahren Sie sofort zur Marmorkirche. Dort sollen Schüsse gefallen sein.«
»Verstanden.«
Søndergaard schaltete Sirene und Blaulicht ein und trat aufs Gas.
Das gellende Heulen brach sich zwischen den Sandsteinmauern des Schlosses und überrumpelte den wachhabenden Gardesoldaten, der beinahe sein Gewehr mit dem aufgepflanzten Bajonett fallen ließ.
»Bestimmt irgendwelche Jugendliche, die Knaller hinter einer Katze hergeschmissen haben.« Søndergaard sah seine Verabredung platzen.
Unfug, dachte Petersen. Du weißt genauso gut wie ich, daß es in diesem Viertel nicht einen Bewohner unter fünfzig gibt.
Die dumme Bemerkung paßte dennoch ausgezeichnet zum Stil ihres Einsatzes. Søndergaard und Petersen mußten höchsten 250 Meter weit fahren, doch bereits nach 75 Metern sprang eine Ampel auf Rot um. Søndergaard hatte gerade in den dritten Gang geschaltet. Er trat hart auf die Bremse, überlegte kurz und beschleunigte erneut. Alles in allem eine dramatische Vorstellung. Allerdings ohne Zuschauer, die sie hätten beeindrucken können. Zum Glück kam ihnen aus der Seitenstraße der Bredgade niemand entgegen, ein Unfall hätte sich kaum vermeiden lassen. Søndergaard fuhr mit aufheulendem Motor bei Rot über die Ampel.
Der Anblick der Kirche hatte einen beruhigenden Einfluß auf ihn. Als sie auf den Kirchplatz fuhren, stellte er Blaulicht und Sirene wieder ab. Der Platz war schlecht beleuchtet. Die Laternen waren mit grellen, städtischen Standardleuchtröhren bestückt, aber die mächtige, graphitgraue Kirche und die imponierenden Wohn- und Bürogebäude neutralisierten die blauvioletten Strahlenbündel des Kunstlichts. Die Dämmerung ist ein diffuser Feind; die Guerilla der Natur.
Søndergaard schaltete das Fernlicht ein, als er rechts abbog. Der Scheinwerfer erwischte ein frisches Graffiti an der Kirchenmauer:
›Menschen vor Profit!‹
Die Beamten kümmerten sich nicht um die schreiendrote Sprayschrift, sie hatten wichtigere Dinge zu tun, als diese Beleidigung des Gotteshauses zu beachten.
Søndergaard nahm das Gas zurück, sein Kollege kurbelte das Seitenfenster runter und suchte die dunklen Eingänge der Patrizierhäuser mit dem Dachscheinwerfer ab.
Am Eingang von Rotaprint war nichts zu bemerken. Auch nicht an den sogenannten Anwälteeingängen, wo die blankpolierten Messingschilder mit den Anwaltsnamen im Scheinwerferlicht aufblitzten.
Søndergaard und Petersen wurden langsam ruhiger. Gleich hatten sie die Hälfte des Platzes kontrolliert, in spätestens drei Minuten den gesamten Platz. Bestimmt falscher Alarm.
Vor der Nummer 7 versperrten parkende Autos den Blick auf den Bürgersteig. Søndergaard bremste und schaltete zurück in den ersten Gang. Von der Store Kongensgade bog ein Wagen auf den Kirchplatz, und einen kurzen Moment war Søndergaards Aufmerksamkeit abgelenkt, obwohl er wußte, daß er auf einer Einbahnstraße fuhr und der Wagen den entgegengesetzten Weg um die Kirche nehmen mußte.
Der Streifenwagen fuhr langsam an den beiden parkenden Autos vorbei.
»Halt an, verdammt noch mal, halt an, Kerl!« Der sonst so besonnene Petersen brüllte, seine Stimme überschlug sich fast.
Vor lauter Überraschung trat Søndergaard die Bremse durch und würgte den Motor ab. Verflucht!
Bevor er wenden konnte, um wenigstens etwas vom Fußweg zu sehen, war Petersen bereits aus dem Wagen. Er versperrte nun Søndergaard die Sicht, doch der Polizeiassistent glaubte, vor dem schmiedeeisernen Gitter etwas Helles zu erkennen. Ein paar helle Schuhsohlen und ein Bündel Kleider.
Petersen hatte mehr als genug gesehen. Er zog seine Walther mit einer Geschwindigkeit, als wollte er sich duellieren und ging hinter einem der parkenden Wagen, einem silbergrauen BMW der Generaldirektorenklasse, in Deckung.
»Deckung!« Petersens Schrei hallte auf dem Kirchplatz nach. Søndergaard öffnete die Fahrertür, rollte sich aus dem Wagen und duckte sich hinter das linke Vorderrad. Einige Sekunden war alles ruhig.
»Bleib in Deckung.«
Søndergaard mußte seine Pistole ziehen. Dem Lehrer der Polizeischule hätte die Zeit, die er dazu brauchte, gar nicht gefallen. Seine Finger waren nervös und unsicher.
»Bleib bloß hinter dem Wagen. Da liegt ein Toter auf dem Fußweg. Möglicherweise sind die noch hier.«
Søndergaard erbleichte. Seine schwarze Silhouette vor dem weißen Polizeiwagen lieferte das perfekte Ziel für einen Heckenschützen. Er warf sich auf den Boden und kroch unters Auto.
Als er sich an die Dunkelheit gewöhnt hatte, konnte er den Bürgersteig übersehen.
Die neuen Schuhe gehörten einem dunkelgekleideten Mann, der in einer dunklen Pfütze lag. Im Neonlicht sah die Blutlache wie dickflüssiges Altöl aus.
Links vor dem Toten oder Sterbenden lag ein schwarzer Diplomatenkoffer. Offenbar war er gegen das schmiedeeiserne Gitter geschleudert worden. Oder hatte sich der Erschossene damit zu schützen versucht? Jedenfalls war die Aktentasche aufgesprungen, in der Blutlache lagen weiße Briefbögen.
Søndergaard kniff die Augen zusammen. War der Mann tot? Ihm kam es so vor, als sei die Lache in der kurzen Zeit, in der er unter dem Wagen lag, größer geworden.
Brechreiz stieg in ihm hoch. Er konnte nicht länger auf den Mann blicken, dessen Leben langsam in die Zementplatten sickerte.
Auf Knien und Ellenbogen kroch er vorwärts, bis ihm die Reifen den Blick auf den Sterbenden versperrten.
Ein scharfes, beunruhigendes Geräusch zerriß die Stille. Metall auf rauhem Asphalt. Søndergaard war psychisch und physisch in höchster Bereitschaft, mehr konnte er nicht ertragen. Sein Herz schlug einen Saltomortale und hämmerte wie eine außer Kontrolle geratene Pumpstation.
Was zum Teufel war bei dem BMW los? Hatte der Täter auch auf Petersen geschossen? Oder machte sich Petersen zum Schuß bereit?
»Was auf deiner Seite?«
Petersens Stimme ... es tat gut, sie zu hören.
»Nichts.« Søndergaard versuchte auch zu flüstern, gleichzeitig aber so deutlich zu sprechen, daß sein Kollege die Antwort verstand . Während er auf dem Asphalt lag, hatte er nur die Geräusche der Autos auf der Store Kongensgade gehört. Nie hätte er geglaubt, daß man sich mitten in einer Millionenstadt so einsam fühlen konnte.
»Ist besser, wenn ich mal gucke, ob er noch lebt.« Petersens Stimme war weit weg, drang aber gut durch. Scheinbar hatte er keine Angst mehr, daß sich der Schütze noch auf dem Platz versteckte.
Søndergaard änderte seine Position. Er erkannte Petersens zu kurze Uniformhose und seine Schuhe am Rand der Blutlache. Der Kollege wollte sich hinknien, erstarrte aber mitten in der Bewegung. Petersen schwang seine Pistole, als hätte er plötzlich wieder Angst bekommen, von hinten angegriffen zu werden. »Was ist?« Søndergaard war überrascht über seine belegte, ängstliche Stimme. Ängstlich und belämmert. Gab es etwas Schlimmeres für einen Polizisten im Dienst?
»Sieh dir das an. Sie haben ihm fast den ganzen Hinterkopf weggeblasen.«
Søndergaard sah, wie Petersen um den Toten herumging. Er versuchte sich zusammenzureißen, war aber nicht imstande, sich die Mischung aus Blut und Gehirnmasse anzusehen, die auf den Fußweg floß. »Ich ruf den Krankenwagen und das Revier«, sagte er. Sie brauchten Verstärkung.
Wieder auf dem Fahrersitz registrierte Søndergaard, daß der Wagen die ganze Zeit illuminiert wie ein Ausflugsdampfer auf dem Platz gestanden hatte, während er und sein Kollege sich bemühten, einem Hinterhalt zu entgehen. Die geöffnete Fahrertür hatte den Kontakt der Innenbeleuchtung ausgelöst. Vor Aufregung hatte er es nicht bemerkt. Schöner Mist. Ein Verrückter hätte die freie Wahl gehabt zwischen zwei schwarzgekleideten Polizisten: vor einem Hintergrund von Weiß oder Silbermetallic.
Petersen war hoffentlich zu beschäftigt, um sein idiotisches Verhalten bemerkt zu haben. Søndergaard wurde rot. Hastig bediente er die Sprechfunkanlage. Sekunden später hörten die beiden Männer auf dem Kirchenvorplatz ihre Kollegen in der Fredericiagade ausrücken. Zwischen der Kirche und der Hinterausfahrt des 2. Reviers lagen nur zwei Häuserblöcke.
Der Krankenwagen heulte durch die Innenstadt, obwohl Søndergaard gesagt hatte, es sei nichts mehr zu machen. Man brauchte kein Arzt zu sein, um hier den Totenschein auszustellen. Er hatte noch gemurmelt, daß der Mann mit einem abgesägten Jagdgewehr erschossen worden sei, aber daran konnte er sich später nicht mehr erinnern. Auf dem Tonband, das in der Hauptwache bei allen Meldungen mitläuft, wurde es allerdings registriert.
Als der Krankenwagen Nr. 6 vom Reichshospital, genauer gesagt vom Rechtsmedizinischen Institut hinter dem Krankenhaus abfuhr, bog eine schwere Honda auf den Amager Strandvej. In den Kleingartenkolonien und Segelklubs herrschte reges Treiben. Es war die Zeit für einen Abendkaffee oder ein Bier. Vor den alten Bunkern auf dem Weg zur Badeanstalt fochten ein paar Jungen einen kleinen Phantasiekrieg aus, sie schossen imaginäre Bomber auf ihrem Flug zur Benzininsel ab. Als das Motorrad vom Strandvej auf den Øresundsvej fuhr, bedienten sie gerade ihre Luftabwehrraketen: Äste, die beim letzten Mitsommernachtsfeuer nicht mit verbrannt waren.
Das sanfte Brummen der vier gleichmäßig arbeitenden Zylinder ließ sie einen Moment aufhorchen. Da der Honda-Fahrer aber zu keinem lokalen Motorradklub gehörte, interessierte er sie nicht weiter.
Der Polizei hätte es auch wenig geholfen, wenn sie sich das Nummernschild der Maschine gemerkt hätten. Es war gestohlen. An den Schienen der Güterbahn bog die Honda auf einen schmalen Schotterweg und hielt kurz darauf vor einem primitiven Werkzeugschuppen. Mit einer beinahe anmutigen Bewegung stieg der Fahrer ab und sah sich um. Trotz der zunehmenden Dunkelheit blieb das getönte Plexiglasvisier des Sturzhelms geschlossen. Unpraktisch, denn das Visier beschlug, als der Fahrer die Maschine mit ziemlicher Mühe durch das Tor des Schuppens schob. Aufmerksamen Beobachtern wäre möglicherweise aufgefallen, daß der Fahrer verhältnismäßig kleine Stiefel trug. Überhaupt wirkte die Gestalt sehr feminin.
Als die Leuchtstoffröhren unter dem mit Spinnweben verhangenen Dach zu flimmern aufgehört hatten, öffnete der Fahrer die linke Seitentasche, schlug ein paar Lappen auseinander und hielt eine mattschwarze Pistole in der Hand. Eine 9mm Heckler & Koch, ein westdeutsches Markenfabrikat, Dienstpistole in einigen Bundesländern.
Den Motorradfahrer reizte es, die Handschuhe auszuziehen und noch einmal den Zeigefinger um den Abzug zu krümmen. Eine unglaubliche Macht lag in dieser kleinen Bewegung.
Es war jedoch nicht der richtige Augenblick, sich solchen Überlegungen hinzugeben. Die Pistole verschwand wieder in der schützenden Dunkelheit der Seitentasche, der Sturzhelm wurde abgenommen.
Auch das Gesicht lieferte keine endgültige Antwort, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Volle Lippen und ein sinnlicher Amorbogen, nur saß darüber ein buschiger Schnauzbart. Kinn und Backen zeigten allerdings nicht die typischen schwarzen Schatten, die auf einen kräftigen Bartwuchs hinweisen. Die Stirn war hoch wie bei vielen Frauen, darüber ein kurzer Herrenschnitt, eine zivilisierte Punkfrisur. Der deutliche Unterschied zwischen Haupthaar und Augenbrauen wurde durch die Färbung betont.
Der Motorradfahrer arbeitete mit der Geschicklichkeit eines routinierten Mechanikers oder Fabrikarbeiters. Die neue Heckler & Koch wurde in einen Schraubstock gespannt, und blitzschnell war der Lauf zu einem ungewöhnlich großen Kaliber ausgebohrt. Die Stahlspäne würden im Nachhinein nicht mehr zu identifizieren sein. Die Möglichkeit dazu sollte das Polizeilabor sowieso niemals bekommen, denn einen Augenblick später verdampften die Späne in einem Säurebad.
Inge Kramer zündete sich eine Zigarette an und ging zum Fenster. Den Tabak schmeckte sie kaum noch, es war die dritte Zigarette innerhalb weniger Minuten. Sie kannte Oles Fahrgewohnheiten und das Motorengeräusch seines BMW, eigentlich gab es keinen Grund, am Fenster zu stehen und vor Ungeduld nervös zu werden. Dorte und Manfred nippten an den Campari-Sodas und wechselten einen vielsagenden Blick. Sie waren zum Abendessen eingeladen, danach wollte man Bridge spielen. Der Ablauf dieser Freitagabende war so eingespielt, daß sie Inges Irritation über Oles Verspätung nicht verstanden. Einem vielbeschäftigten Geschäftsmann konnte das doch mal passieren. Oder gab es tiefere Gründe für Inges Unruhe? Ab und an war ein feindlicher Unterton in den Bemerkungen zu hören gewesen, die die beiden miteinander wechselten.
»Ich begreife nicht, wo er bleibt.« Inge Kramer drückte ihre Zigarette aus.
Manfred schwenkte die Eiswürfel in seinem hohen Campariglas. Er mochte den Aperitif nicht austrinken, zum Essen und beim Kartenspiel würde es noch genug Alkohol geben.
»Vielleicht ist er in eine Verkehrskontrolle geraten«, versuchte er ein Gespräch in Gang zu bringen.
»Vielleicht, trotzdem ist es mir unverständlich, wo er bleibt. Er wechselt jedes Jahr seinen Wagen, da können sie kaum was finden.«
»Wirklich? Seine Autos sehen sich alle so ähnlich, daß ich es nie bemerkt habe.« Manfred war überrascht. Natürlich hatte er Oles geschäftlichen Erfolg mitbekommen, das ließ sich gar nicht vermeiden. Aber daß Oles Erfolg so groß war, daß er sich jedes Jahr einen der teuersten BMW’s leisten konnte, beeindruckte ihn doch. Oder war es nur ein Steuertrick? Manfred war sich nicht sicher.
»Ich rufe jetzt im Büro an. Wenn die auch nicht wissen, wo er ist, fangen wir ohne ihn an.«
Inge ging in die Küche, ein kleines Tastentelefon hing dort am Türpfosten. Es gab keinen Grund, Dorte und Manfred das Gespräch mithören zu lassen, möglicherweise fielen barsche Bemerkungen. Aber weder im Stadtbüro noch im Fabrikzentrum in Lundtofte meldete sich noch jemand.
Inge Kramer stellte eine Flasche Rosechatel in den Weinkühler und zerkleinerte Eiswürfel. Sie ärgerte sich noch immer, wurde aber spürbar nervöser. Normalerweise rief Ole an, wenn er sich verspätete, egal, ob er noch in einer wichtigen Konferenz saß oder bereits unterwegs war.
Es mußte etwas passiert sein.
Die aufgeschweißte Öltonne gab mit einem Klagelaut nach, als die Flammen der Motorradreifen das dünne Metall erhitzten. Mit der steigenden Temperatur des brodelnden Gummis wechselte die rostrote Tonne ihre Farbe in dunkelbraune und brandigblaue Töne.
Der Hondafahrer trat von der Abfalltonne in den Windschatten des alten, rotbemalten Holzschuppens. Wachsame, grünbraune Augen folgten der breiten Fahne von schwarzem, fetten Rauch, der sich über das Nachbargrundstück, eine verlassene Zementgießerei, wälzte. Doch weder die Geräusche der Tonne noch die Rauchbelästigung riefen neugierige Jugendliche, wütende Kleingartenbesitzer oder Umweltschützer der Gegend auf den Plan.
Der Motorradfahrer steckte sich eine Zigarette an. Die Spuren waren verwischt, jetzt kam die Reaktion auf die Anspannung.
Es tat gut, den Rauch in die Lungen zu ziehen. Und es tat gut, daran zu denken, daß jetzt die anderen Probleme hatten. Die Spezialisten der Polizei, die den Platz vor der Kirche zentimeterweise untersuchten, weißes Pulver streuten, fotografierten. Erst in ein paar Stunden würden diese Trüffelschweine erkennen, daß der ganze Aufwand umsonst war.
Und der Polizeichef mußte vor immer aggressiver fragenden Journalisten einräumen, daß man noch keinen Schritt weitergekommen war.
Ein Mord, ein Terrorakt ... und ohne jeden Hinweis. Morgen oder übermorgen würden seine Vorgesetzten über den Mann herfallen, der sein Bestes gab, aber nicht einmal die Andeutung einer verwertbaren Spur hatte.
Die Kugeln, die Ole Kramer getroffen hatten, würden ganz Westeuropa beunruhigen.