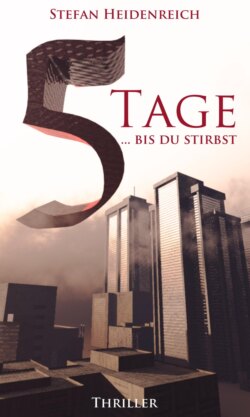Читать книгу Fünf Tage - Thriller - Stefan Heidenreich - Страница 5
Kapitel 1
ОглавлениеDer kleine Raum war fast komplett abgedunkelt. Nur eine einzige Glühlampe am Kopfende des Bettes spendete der alten Dame, die in ihm lag, ein schwaches Licht. Davon bekam sie inzwischen jedoch nichts mehr mit, genauso wenig wie von den medizinischen Geräten, die neben ihr ihre Arbeit verrichteten.
Außer der alten Dame hielt sich nur eine einzige weitere Person in dem Raum mit den trostlosen weißen Wänden auf.
Es handelte sich dabei um einen Krankenpfleger. Sein Name war Rene; mit seinen 34 Jahren optisch der Typ des ewigen Medizinstudenten, 1,80 m groß, 76 kg schwer und im Alltag wie auch im Beruf stets leger gekleidet. Ein kurzärmliges Oberhemd, das nie in seiner Jeans steckte, war in den letzten Jahren so etwas wie sein Markenzeichen geworden. Ein Rollkragenpullover im Winter sowie ein T-Shirt im Sommer, unter seinem Hemd rundeten das Bild ab. Stets trug er Turnschuhe, aus beruflichen Gründen immer in der Farbe Weiß. Sein Kinn zierte ein schmaler Bart, der bis zu den perfekt rasierten Koteletten reichte. Die braunen Augen, mit denen er bereits als Kind jeden Menschen verzauberte, zeugten von einer Warmherzigkeit, die jedem seiner Patienten ein Gefühl der Geborgenheit vermittelten. Ansonsten gab es im Leben des jungen Mannes wenig Spektakuläres. Selbst ein Notendurchschnitt von 1,6 konnte den ehemaligen Abiturienten nicht zu einem Studium bewegen. Weder die Aussicht auf das stattliche Einkommen eines Akademikers, noch irgendwelche Titel, die damit verbunden gewesen wären, konnten ihn davon abhalten eine Ausbildung als Krankenpfleger zu absolvieren.
Seine letzte Beziehung fiel den unregelmäßigen Arbeitszeiten zum Opfer, aber auch das nahm er in Kauf. Er war dort, wo er sein wollte und am meisten gebraucht wurde. Dort wo Menschen seine Hilfe und Fürsorge benötigten. So wie auch an jenem Abend.
Bereits seit zwei Stunden hielt er die abgemagerte Hand der alten Dame.
Was hatte die Krankheit nur aus dieser Frau gemacht? Noch vor ein paar Monaten stand die 67-jährige mit beiden Beinen im Leben. Mit ihren 1,72m und 69kg zählte sie zu den eher großen Frauen. Es gab keine weißen Haare, die man hätte färben müssen und auch ihr fast makelloses Gebiss ließen sie immer 10 Jahre jünger erscheinen, als sie tatsächlich war.
Mit Ausnahme ihrer engsten Freunde, zu denen auch Rene und seine Familie gehörten, wusste kaum jemand etwas über die schweren Zeiten, die sie hinter sich hatte. Ihre eigenen Eltern hatte sie nie kennengelernt. Die ersten 17 Jahre ihres Lebens verbrachte sie in Hamburg in einem kirchlichen Waisenhaus, ohne jemals die Umstände dafür zu erfahren. Im Alter von 16 Jahren begann sie eine Ausbildung zur Friseurin, wo sie sich in den Sohn ihrer Chefin verliebte. Zwei Wochen nach ihrem 18. Geburtstag stand sie bereits vor dem Traualtar. Das junge Paar übernahm bereits nach 4 Jahren den elterlichen Betrieb und eröffnete innerhalb der nächsten sechs Jahre zwei weitere Salons. Die Geschäfte liefen gut.
Man bekam gesellschaftliche Anerkennung, in der sich ihr Mann sonnte und sie selbst immer mehr zum Vorzeigeobjekt für ihn wurde. Nach 23 Jahren und fünf erfolglosen Versuchen ihren Mann vom Alkohol wegzubekommen, stand sie vor den Scherben ihrer Ehe. All das konnte dieser Frau die Lust am Leben nicht nehmen. Mit neuen Hoffnungen und einer großen Portion Lebensmut im Gepäck verließ sie nur wenige Tage nach der Scheidung Hamburg und siedelte nach Berlin um, wo sie Rene und seine Familie kennenlernte.
Inzwischen auf 48kg abgemagert war selbst das lebensfrohe Leuchten aus ihren Augen verschwunden. Die Haut war faltig, das Gesicht eingefallen und der bevorstehende Tod zeigte seine hässlichste Fratze. Rene wusste, dass sie bereit war, vor ihren Schöpfer zu treten. Sie hatte es ihm in den letzten fünf Tagen (welche sie nun auf seiner Station verbrachte) mehr als einmal gesagt. Doch war er bereit sie schon loszulassen?
In dieser Nacht saß er auf einem Stuhl neben dem Bett und starrte auf die elektronischen Anzeigen, die jede Veränderung des Gesundheitszustandes der Patientin sofort protokollierten.
Irgendwann in dieser Nacht, das wusste er, würde es passieren und der immer wiederkehrende Piepton, der jeden einzelnen Herzschlag darstellte, würde in einen lang anhaltenden Pfeifton übergehen. Dann hätte sie es endlich geschafft. Nach einem halben Jahr zwischen Schmerz und Hoffnung sowie endlosen Untersuchungen und den verschiedensten Behandlungen würde sie hier in diesem Bett ihren Frieden finden.
Acht Sekunden später würde dann auch das Gehirn seine Tätigkeit endgültig einstellen. Neuesten Erkenntnissen zur Folge könnte dies die Zeitspanne sein, die die Seele braucht, um den Körper zu verlassen. Ob sie danach tatsächlich körperlos weiter existieren könnte, darüber spekulierte die Menschheit seit Anbeginn des Seins.
Für Rene stand auf jeden Fall fest, dass er mindestens diese acht Sekunden warten würde, bevor er die nächsten erforderlichen Schritte unternähme. Auch in diesen letzten Momenten wollte er einfach nur bei ihr sein.
Erst nach Ablauf dieser Frist würde er die Geräte ausschalten und Dr. Seehof rufen, der den Tod offiziell bestätigen musste. Es war immer die gleiche Prozedur. Und doch war diesmal alles anders als sonst. Diesmal lag eine Frau in diesem Bett, die ihm in der Vergangenheit wesentlich näher gestanden hatte als irgendeine Patientin zuvor.
Schon seit Wochen musste er sich bemühen, seine Tränen vor ihr zu verbergen.
Längst hatte er aufgehört mitzuzählen wie viele Menschen, die vor ihr in diesem Bett lagen, er schon betreut hatte, wie vielen Betroffenen er schon Trost zugesprochen hatte, wie viele Angehörige auf demselben Stuhl gesessen hatten wie er in dieser Nacht.
Jeder von ihnen fühlte sich der Situation hilflos ausgeliefert. Jedes Mal glaubte er zu verstehen, was in diesen Menschen vorging. Jedes Mal irrte er sich in diesem Punkt.
Welche Qualen man tatsächlich auf diesem Stuhl durchlebte, das sollte er erst jetzt wirklich erfahren.
Zum ersten Mal fühlte er sich nicht als Krankenpfleger, sondern als Angehöriger. Diesmal war er derjenige, der den Trost des Pflegepersonals benötigte. Denn anders als alle Patienten vor ihr kannte er diese Frau schon fast sein ganzes Leben lang.
Seine eigene Wohnung hatte er seit vier Tagen nicht mehr gesehen und den wenigen Schlaf, den er benötigte, fand er sitzend auf einem Stuhl in diesem Raum, der nur selten von Tageslicht durchflutet wurde. Für die meisten Patienten war diese schwache Beleuchtung genau das, was sie in diesem Zustand brauchten. Nur ganz wenige von ihnen baten darum, die Jalousie beiseitezuschieben, weil sie wenigstens noch ein letztes Mal das Sonnenlicht und den Himmel sehen wollten.
Die letzten Wünsche vieler, die in diesem Bett starben, gingen ihm durch den Kopf. Fast jeder von ihnen hatte irgendeinen anderen Wunsch gehabt. Doch diese Frau hatte nicht einen Einzigen geäußert. Es reichte ihr völlig aus, sich von ihren Lieben verabschiedet zu haben.
Zeitweilig glaubte Rene, dass ihn das monotone Geräusch des kleinen Lautsprechers, der die Herztöne wiedergab, noch in den Wahnsinn treiben würde. Und doch war er für jeden einzelnen Ton, den er seit nunmehr fast fünf Tagen hörte, dankbar. Es war ein ständiger Zwiespalt, in dem er sich befand. Obwohl er in einem Moment noch daran glaubte, dass jede Sekunde des Lebens das wohl kostbarste Geschenk der Welt war, wusste er, dass sie sofort wieder leiden würde, wenn die Wirkung des Morphiums nachließe. In diesen Momenten betete er um ihre Erlösung. Inzwischen hatten die meisten inneren Organe fast vollständig versagt. Maschinen waren es, die ihr Leben künstlich verlängerten. Ohne sie wäre diese Frau mit Gewissheit schon tot.
In solchen Augenblicken stellte sich Rene immer wieder die gleiche Frage: Waren diese Maschinen wirklich in der Lage das Leben zu verlängern? Oder verlängerten sie möglicherweise nur das Sterben, in der Hoffnung, dass im letzten Moment doch noch ein medizinisches Wunder geschieht? Der große Durchbruch im Kampf gegen den Krebs!
Die unheimliche Ruhe im Raum wurde lediglich durch das Piepen des Herzmonitors gestört. Die gleichmäßige Frequenz erinnerte ihn an ein Metronom, wenn es scheinbar unaufhörlich tickt und Musikern dabei hilft, den Takt zu halten, bis es irgendwann schlagartig stehen bleibt.
Die Frau, die vor ihm im Bett lag, besaß ein solches Metronom und er wusste noch genau, wie fasziniert er als Kind davon war. Er selbst durfte es damals aus dem Karton nehmen, in dem es transportiert worden war.
Er dachte an den großen schweren Umzugskarton, den er als Junge, der gerade mal die dritte Klasse besuchte, niemals alleine hätte bewegen können. Mit den ungeschickten Händen eines Kindes hatte er das tickende Monstrum, nachdem er es aufziehen durfte, auf einen kleinen Tisch gestellt und mit großen Augen beobachtet, wie das Pendel hin und her schwang.
Und nun, viele Jahre später, lag seine Besitzerin im Sterben. Eine Tatsache, die kein Mensch und keine Medizin auf der Welt, in diesem Stadium der Krankheit, noch hätte ändern können.
Rene schloss seine Augen und drückte die Hand der Patientin etwas fester.
Vor seinem geistigen Auge erwachten Erinnerungen aus seiner Kindheit. Die Bilder der Vergangenheit wurden wieder lebendig.
Da sah er sie wieder vor sich, 25 Jahre jünger und mit der Kraft und dem Lebensmut einer damals gerade frisch geschiedenen Frau, die anscheinend vorhatte die ganze Welt aus den Angeln zu heben. Schon seit den Morgenstunden beobachtete Rene das Treiben vor dem Fenster seines Kinderzimmers. Einem uralten Umzugswagen waren bereits kurz nach Sonnenaufgang zwei Männer entstiegen, die nun seit einigen Stunden Möbel und Kartons durch die Gegend trugen. Im Rückblick machten sie den Eindruck, dass man sie gerade in einem Obdachlosenheim aufgelesen hatte. In den Augen eines Kindes wirkten sie damals jedoch einfach nur fleißig.
Irgendwann in den Vormittagsstunden schellte es an der Tür. Renes Herz schlug schneller.
‚Sollte Papa doch früher als erwartet nach Hause gekommen sein?’ Schließlich hatte er versprochen die Kinder an diesem Tag ins Bett zu bringen und die Familie erwartete ihn erst am Abend.
Neugierig folgte Rene seiner Mutter zur Wohnungstür. Im Treppenhaus stand jedoch nicht sein Vater, sondern die neue Nachbarin. Die damals noch fremde Frau trug eine viel zu große blaue Latzhose und fragte, ob Renes Mutter etwas dagegen hätte, die Wohnungstür einen Moment geöffnet zu halten, damit ihre Helfer auf dem kleinen Treppenabsatz ein Klavier wenden könnten.
Rene stand hinter seiner Mutter und sah die merkwürdig gekleidete Frau mit großen Kinderaugen an. Es war das erste Mal, dass er eine Frau in Männerkleidung sah. Ein Bild, das für ihn damals etwas Unnatürliches hatte. Schließlich trug seine Mutter selbst ausschließlich Kleider und auch die Mütter seiner Freunde kleideten sich zu jener Zeit ausnehmend weiblich.
Bereits in diesem ersten Augenblick erkannte er, dass es sich bei dieser Frau um einen ganz besonderen Menschen handelte. Auch seine Mutter musste es damals so empfunden haben, weshalb sie die neue Nachbarin kurzfristig zum Abendessen einlud. Sein Vater, der damals als Fernfahrer tätig war, hatte erst kurz zuvor angerufen, um seiner Frau mitzuteilen, dass er an diesem Abend nicht nach Hause käme, weil er wieder einmal im Stau stecke und die Nacht irgendwo in Frankreich verbringen würde.
Wie schon so oft, wenn die beiden telefonierten, schimpfte sie am Telefon und verfluchte den Job ihres Mannes. Rene, der die ganze Zeit am Fenster des Kinderzimmers verbrachte, bekam davon jedoch nichts mit.
„Hätte ich doch bloß niemals einen Fernfahrer geheiratet“, murmelte sie auf dem Weg zur Wohnungstür so leise, dass ihr Sohn es nicht hören konnte.
Es war das erste Mal seit Wochen, dass sie für vier statt drei Personen gekocht und sich auf einen Abend im Kreise ihrer Familie gefreut hatte. Dass durch diesen Umstand eine großzügige Portion des Abendessens für die Frau in der frechen Kleidung abfiel, war somit reiner Zufall, ein Zufall, der Renes Leben sowie das seiner Familie später noch maßgeblich beeinflussen sollte.
Punkt 19.00 Uhr stand die Fremde mit der Kurzhaarfrisur auch tatsächlich vor der Tür, immer noch in der Latzhose, aber mit einem Blumenstrauß und zwei Tafeln Schokolade in den Händen, eine für Renes drei Jahre jüngere Schwester Julia und eine für Rene. Um die Taille hatte sie inzwischen einen Gürtel gelegt, sodass sie nicht mehr ganz so unweiblich wirkte wie am Vormittag.
„Entschuldigen Sie bitte meinen Aufzug, aber meine restlichen Kleider sind noch irgendwo in den Kartons und die beiden Idioten, die man mir schickte, haben es geschafft, alles durcheinander in die Wohnung zu stellen, natürlich mit der Schrift nach unten.“
„Männer!“, sagte Renes Mutter damals, während sie die linke Augenbraue hochzog, eine Geste, die im Allgemeinen nichts Gutes verhieß. „Man kann nicht mit ihnen leben, aber auch nicht ohne sie. Ich halte mir auch so ein Exemplar. Also weiß ich, wovon ich rede.“
„Oh! Sie Ärmste“, erwiderte die Besucherin. „Ich habe meinen erst kürzlich dorthin zurückgeschickt, wo er herkam.“ Lachend betraten beide die kleine Essecke zwischen Küche und Wohnzimmer, die gerade mal Platz für einen Tisch und vier Stühle bot.
Es gab Rinderrouladen mit Kartoffeln und Rotkohl, das Leibgericht seines Vaters. Die beiden Frauen unterhielten sich während des Essens angeregt miteinander, wobei es vorrangig die Fremde war, die mit ihrer Art Geschichten zu erzählen Menschen verzaubern konnte. Bereits nach ein paar Minuten am Tisch nannten sich die beiden Damen beim Vornamen und stießen mit einem Glas Wein auf das ‚Du’ an.
Rene erinnerte sich, dass er im Laufe des Abends einmal eine Frage stellen wollte, dabei jedoch ins Stottern kam, weil er ihren Nachnamen nicht kannte.
„Frau … … äh … Na … Sie … ich meine… …“
Just in diesem Augenblick unterbrach sie ihn. „Sage einfach Helga zu mir. Ich hasse es, wenn man mich mit dem Nachnamen anredet, denn den habe ich ohnehin nie gemocht.“ Dabei lächelte sie verständnisvoll. Rene stellte zögerlich die Frage, die ihm auf der Seele lag, und Helga beantwortete sie sofort. Trotz seines Alters von nur neun Jahren gab ihm Helga das Gefühl kein Kind zu sein, sondern behandelte ihn wie einen Erwachsenen. Seine Mutter merkte, wie stolz es Rene machte, und lächelte gutmütig.
Helga erzählte während des Nachtischs noch ein paar Geschichten aus ihrer Schulzeit und berichtete über die vielen Dummheiten, die sie während ihrer Kindheit mit ihren Freunden gemacht hatte, jedoch nie ohne den mahnenden Zusatz, dass man solche Dummheiten eigentlich nicht machen sollte, was den Witz der einzelnen Geschichten allerdings nicht schmälern konnte. Es wurde fast den ganzen Abend gelacht und die Kinder durften etwas länger aufbleiben als normalerweise. Schließlich genoss ihre Mutter die Gesellschaft an diesem Abend. Ihren Mann hatte sie vor Stunden mit schweren Vorwürfen und ohne das sonst übliche „Bussi“ am Telefon verabschiedet, bevor sie den Telefonhörer wütend auf die Gabel geknallt hatte. Eine Handlung, die sie sich den Rest ihres Lebens noch selbst zum Vorwurf machen sollte.
Irgendwann im Laufe des Abends hatte sie die Kompottschälchen in die Küche gebracht und Helga gefragt, ob sie noch eine zweite Flasche Wein mitbringen solle.
Helga lehnte dankend ab und unterhielt sich weiter mit den Kindern, die gerade laut lachten, als Helga plötzlich verstummte. Sie hatte mitbekommen, dass ihre Gastgeberin am Telefon auf dem Flur war. Aber das, was sie in diesem Moment sehen musste, gefiel ihr absolut nicht.
Der Gesichtsausdruck der Mutter sprach eine deutliche Sprache. Wortlos stand Helga auf, eilte auf den Flur und nahm die Frau am Telefon in ihren Arm. Auch Rene tat instinktiv das einzig Richtige, als er mit seiner kleinen Schwester an der Hand ins Kinderzimmer ging. Obwohl er spürte, dass etwas Schreckliches geschehen war, konnte und wollte er nicht weinen.
Laut Polizeibericht und dem, was ein anderer deutscher Fernfahrer später zu Protokoll gab, löste sich der Stau, in dem sein Vater stand, bereits kurz nach dem Telefonat mit seiner Frau auf. Bei seinen Kollegen erkundigte er sich per Funk, ob die Autobahn nach Deutschland frei wäre, weil er so schnell wie möglich nach Hause zu seiner Familie wollte, um sie nicht schon wieder zu enttäuschen. Der Fahrtenschreiber wies nach Auskunft der Polizei eine Geschwindigkeit von 130 km/h auf, als sein Vater mit seinem Lkw und der nur schlecht gesicherten Ladung die Kontrolle verlor und in einer Kurve die Leitplanke durchschlug.
Nur knapp 35 Kilometer von zu Hause entfernt war das schwere Fahrzeug von einer Brücke gestürzt. Die Ärzte gingen davon aus, dass der Fahrer, der aus dem Auto geschleudert wurde, auf der Stelle tot war.
An den folgenden Tagen war Helga immer für die Kinder da, weil ihre Mutter viel zu erledigen hatte. Die Abende verbrachten die beiden Frauen meist zusammen. Erst drei Tage nach dem ersten gemeinsamen Abendessen, als die Kinder Helga gerade beim Auspacken der Umzugskartons halfen, stellte Julia die Frage, die eines Tages gestellt werden musste. „Ist Papa jetzt im Himmel?“
Ohne zu zögern, sprang Helga auf und nahm die Kinder wortlos in den Arm. Sie musste auch nichts mehr sagen oder erklären. In den folgenden Wochen war Helga einfach nur für die Drei da. Sie war scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht, zu einem Zeitpunkt, als man sie am meisten brauchte.
Sie unterstützte die kleine Familie so gut sie es vermochte, kümmerte sich mit der Mutter zusammen um alle notwendigen Formalitäten sowie die Beerdigung, und wurde so zu ihrer besten Freundin. Eine Freundschaft, die ein Leben lang anhalten sollte.
Immer noch die Hand der Sterbenden haltend sah Rene kurz auf den Monitor, bevor er sich abermals seinen Erinnerungen hingab..
Er dachte an Helgas Stimme, wenn sie den Kindern damals aus einem Buch vorlas, wie auch an die unzähligen Kinderlieder, zu denen Helga sie mit dem Klavier begleitete. Immer wieder forderte sie die Kinder zum Mitsingen auf, indem sie ein und denselben Ton so oft wiederholte, bis Rene und seine Schwester mit einstimmten.
Rene wartete darauf Julias helle Stimme wahrzunehmen, die fast immer den Anfang der beiden machte. Doch nichts geschah. Warum konnte er diesen Teil der Vergangenheit diesmal nicht zurückholen? Wo war dieser kurze Augenblick, der ihm damals so vertraut war? Irgendetwas war geschehen.
Rene öffnete seine Augen. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass für einen ganz kurzen Moment tatsächlich nichts mehr zu hören gewesen war, dass Helgas sanfte Musik nie wieder erklingen würde.
Die kurze Stille mit dem anschließenden langen, hellen Ton hatte Rene wieder in die Realität zurückgeholt.
Der Herzmonitor zeigte genau 23.43 Uhr an, als der Pfeifton einsetzte. Rene musste nicht zum Bildschirm sehen. Er wusste, dass aus den mehr oder weniger regelmäßigen Zacken inzwischen eine einzige durchgezogene Linie geworden war. Instinktiv begann er leise zu zählen. „einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig … … … … achtundzwanzig“. Er hielt ihre Hand noch ein paar Sekunden länger fest, um ganz sicherzugehen, die acht Sekunden nicht zu unterschreiten.
Anders als bei einigen seiner Patienten musste er ihre Augen nicht extra schließen, denn unter dem Einfluss des Morphiums befand sie sich bereits schon den ganzen Tag über in einer Art Schlafzustand.
In den zurückliegenden fünf Tagen hatten sie sich alles gesagt, was zu sagen war. Seine Mutter war noch am Abend zuvor am Sterbebett ihrer besten Freundin gewesen und Rene hatte Helga versprechen müssen, sich um sie zu kümmern. Julia, die seit vier Jahren für ein Computerunternehmen in Kanada tätig war, hatte mehrfach um Urlaub gebeten, aber dieser wurde ihr jedes Mal verwehrt. Rene redete stundenlang mit ihr am Telefon, um sie davon abzubringen, trotzdem nach Deutschland zu fliegen, um der Familie beizustehen. Eines, so wusste er, würde er ihr nie ausreden können.: Helga die letzte Ehre zu erweisen und zur Beerdigung zu kommen. Bereits damals, nach dem Tod des Vaters der beiden und auch Jahre später noch, hatte Helga immer wieder betont, dass dies etwas sei, das man für einen Verstorbenen tun muss. „Und wenn danach die Hölle zufriert“, waren zu jener Zeit ihre Worte.
Rene klingelte nach Dr. Seehof. Nun konnte er nichts mehr tun, außer seine Mutter und seine Schwester zu informieren.
Beide nahmen es sehr gefasst auf. Das Einzige, was seine Mutter herausbrachte, war: „Dieser verdammte Krebs. Wann findet man endlich ein Mittel dagegen? Wie viele Menschen müssen noch sterben?“
„Ich weiß es nicht“, waren die einzigen Worte, die er darauf erwidern konnte. Er fühlte sich leer und ausgebrannt.
„Soll dich jemand vom Krankenhaus abholen? Wir könnten uns zusammensetzen und reden. Ich merke genau, wie sehr dich die letzten Tage mitgenommen haben.“
Rene lehnte ab. Er wollte nur noch in sein Bett. „Wir reden morgen weiter“, versprach er seiner Mutter.
„Fahr vorsichtig. Ich möchte nicht noch einen Menschen verlieren.“ Traurig sah sie in den Telefonhörer, unfähig etwas für ihren Sohn tun zu können.
Langsam klappte er sein Handy zu und stellte seine Kaffeetasse auf die Abstellfläche im Schwesternzimmer.
Claudia, die etwas rundlich wirkende Praktikantin, die anscheinend ein Auge auf Rene geworfen hatte, drückte im Vorbeigehen seine Hand. Mehr konnte auch sie in diesem Moment nicht tun. Rene war ohnehin nicht ansprechbar.
Er nahm seine dicke Winterjacke vom Haken und verließ ohne sich umzuziehen das Krankenhaus.
Vorbei am Sterbezimmer von Helga, wo Dr. Seehof gerade die offizielle Todeszeit zu Protokoll gab und Rene mit einem traurigen Blick verabschiedete.