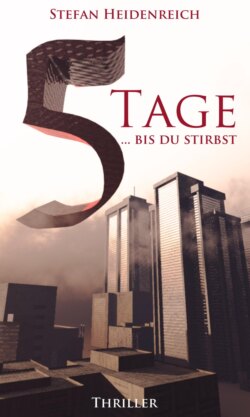Читать книгу Fünf Tage - Thriller - Stefan Heidenreich - Страница 6
Kapitel 2
ОглавлениеRene saß mit Andy gerade vor dem Computer in dessen Wohnung, wo sich die beiden Freunde wie an jedem Donnerstag mit einem Onlinespiel beschäftigten.
Rene hatte soeben von Helgas Tod berichtet und Andy sah ihn fragend an. Er wusste was Helga für Rene und seine Familie bedeutete und konnte es kaum glauben, dass diese taffe Frau nun tot sein soll. „Du musst mir mal bitte etwas erklären“, begann er schließlich ein Gespräch. „Seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, dass es heute viel mehr Krebskranke gibt als noch zu unserer Kindheit. Welche Erklärung hast du als Halbmediziner dafür?“
Rene ließ die Frage einen Moment auf sich wirken, bevor darauf einging. Er war inzwischen schon seit zwölf Jahren als Krankenpfleger tätig und konnte diese Frage nicht so einfach ignorieren. Er selbst hatte sie schon sehr oft im Kollegenkreis erörtert, aber nie eine wirklich befriedigende Antwort erhalten.
Natürlich entwickelte sich die Medizin immer weiter und auch die Methoden zur Früherkennung des Krebses waren im Laufe der Jahre wesentlich besser und genauer geworden. Woran also mochte es liegen, dass die Anzahl der nachgewiesenen Krebstoten prozentual zur Weltbevölkerung anscheinend stärker anstieg? Tatsächlich könnten Ärzte in der Vergangenheit oftmals fehlerhafte Totenscheine ausgestellt haben, ohne die eigentliche Ursache des Ablebens richtig zu erkennen. Lag es vielleicht daran, dass sie nicht in der Lage waren, eine ordentliche und somit korrekte Diagnose zu erstellen?
Irgendwie machte diese Erklärung, die auch er immer wieder von sogenannten Experten bekam, aber keinen Sinn.
Schließlich soll es Hippokrates selbst gewesen sein, der die Bezeichnung „Krebs“ erstmals benutzte, als er bei der Behandlung eines Brustgeschwürs die Ähnlichkeit mit den Beinen eines Krustentieres entdeckte. Wenn also der berühmteste Arzt des Altertums, ca. 400 Jahre vor Christus, schon in der Lage war, diese Krankheit zu diagnostizieren, dann sollte es den Ärzten des 19. oder gar des 20. Jahrhunderts auch möglich gewesen sein.
Nein, an mangelnder Früherkennung konnte es nicht liegen!
Für Rene stand fest, dass die Häufigkeit dieser heimtückischsten aller Krankheiten tatsächlich stetig anstieg. Doch wo waren die Ursachen zu suchen?
Umweltschützer gaben der zunehmenden Belastung durch den Nah- und Fernverkehr die Schuld, wobei Benzol tatsächlich oft im Zusammenhang mit der Leukämie genannt wurde. Aber auch hier brachte der reduzierte durchschnittliche Kraftstoffverbrauch bei Pkws und der somit verminderte Einsatz von Benzol keine erkennbare Entspannung.
Wenn man heutzutage die Zeitung aufschlägt, dann werden fast täglich neue Stoffe als Krebserreger bekannt gegeben. Zwangsläufig fragt man sich jedoch, wie die Menschheit den Umgang mit diesen Stoffen sowie deren Verzehr früher überlebte? Heute meiden wir sie und sterben trotzdem an Krebs. Früher gehörte der Umgang damit zum Alltag und es starben offensichtlich weniger Menschen daran.
An diesem Abend wurde für die beiden Freunde das Spielen am Computer zur Nebensache und irgendwann schalteten sie das Gerät einfach ab. Sie diskutierten die ganze Nacht hindurch über den Krebs, seine möglichen Ursachen und Folgen, ohne jedoch zu einem Ergebnis zu gelangen, das ihnen plausibel erschien.
Für Rene waren Gespräche wie dieses eine Möglichkeit sich auf die bevorstehende Beerdigung am nächsten Morgen vorzubereiten und sich noch einmal mit Helgas Tod auseinanderzusetzen. In Andy fand Rene zudem noch einen Gesprächspartner, der seine momentane Situation nur zu gut nachvollziehen konnte. Auch er hatte vor einiger Zeit fast eine komplette Woche auf der Station von Rene verbracht, als seine Großmutter im Sterben lag. Immer wieder musste Rene ihn damals auffordern sich etwas Schlaf zu gönnen, weil es nichts mehr gab, was man hätte tun können. „Danke, dass du damals deine Schichten getauscht hast, um mir und meiner Familie in den schwersten fünf Tagen unseres Lebens beizustehen.“, waren die letzten Worte, die Rene an diesem Abend von seinem Freund hörte.
Andy hatte ein Thema angesprochen, das für Rene inzwischen zum beruflichen Alltag gehören sollte. Die meisten Ärzte und Pfleger, mit denen er es zu tun hatte, nahmen vieles einfach hin, ohne sich ernsthaft Gedanken darüber zu machen. Doch zu denen gehörte er mit Gewissheit nicht. Mit diesen Gedanken schlief Rene am Abend ein und erwachte mit ihnen am nächsten Morgen. Doch zunächst galt es von einer guten Freundin Abschied zu nehmen.
Die Beisetzung begann pünktlich um neun Uhr und fand im relativ kleinen Kreis statt. Rene, seine Mutter und Julia waren die ältesten Freunde der Verstorbenen, von der man sich an diesem Tag verabschiedete. Der Rest der Trauergäste bestand aus ehemaligen Arbeitskollegen und -kolleginnen sowie ein paar Leuten, mit denen Helga ab und zu musiziert hatte.
Zu gerne hätte Rene ihr die Freude bereitet und das Klavierspiel von ihr erlernt, doch sämtliche Versuche, die Helga diesbezüglich unternommen hatte, waren mangels Renes Talent gescheitert.
Da Helga seit ihrer Eheschließung keiner Religion angehört hatte, wurde ein kirchenunabhängiger Redner bestellt, der darauf verzichtete über Gott und „Das Leben danach“ zu sprechen. Beim Auszug aus der Friedhofskapelle ertönte eine Aufnahme von „Ballade pur Adeline“. Richard Clayderman hatte es mit diesem Stück zu, Weltruhm gebracht und auch Helga spielte es immer mit einer unglaublichen Hingabe. So auch die Aufnahme, die an diesem Morgen zu hören war.
Helga hatte sie selbst noch eingespielt. Sie war erst vier Monate alt und in Renes Gegenwart mithilfe eines Computerprogramms auf seinem Laptop entstanden. Helga war zu der Zeit schon davon überzeugt gewesen, diese Krankheit nicht zu überleben, weshalb sie Rene darum bat, dieses Vermächtnis mit ihr zusammen zu erstellen.
In dem Moment, als die ersten Tastenanschläge ertönten, konnte selbst er seine Tränen nicht zurückhalten.
Gemäß ihrem Wunsch fand Helgas Asche ihre letzte Ruhestätte auf einer Wiese neben anderen Gräbern. Die Friedhofsverwaltung hatte die dafür vorgesehene Stelle schon am Morgen vorbereitet, damit die Trauergäste ihre mitgebrachten Blumenarrangements dort ablegen konnten.
30 Minuten nachdem die kleine Trauergemeinde in ihre Autos gestiegen war, traf man sich in einem Restaurant am Rande der Stadt, wo die Tafel für die 26 Gäste bereits eingedeckt war.
Es war Helgas Lieblingsrestaurant gewesen und zugleich der Ort, an dem inzwischen ihr Klavier ein Zuhause gefunden hatte. Der Wirt hatte Helga und ihren Musikerfreunden vor vier Jahren einen Raum zur Verfügung gestellt, in dem sie ungestört üben konnten. Seine einzige Bedingung, die er daran geknüpft hatte, war, dass die Gruppe auch auf Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Konfirmationen spielte.
Rene blickte auf das Klavier, welches zu Helgas Ehren hier im kleinen Saal stand. Es war die erste Feierlichkeit seit vier Jahren, bei der sie nicht auf dem kleinen Hocker davor saß, um die anwesenden Gäste zu unterhalten. Noch eine Woche, bevor sie nach drei erfolglosen Chemotherapien stationär im Krankenhaus aufgenommen worden war, hatte sie es sich nicht nehmen lassen, dort zu spielen. Dass dies ihre Abschiedsvorstellung werden sollte, das vertraute sie nur Rene an. Weder seine Familie, noch einer der Musiker konnten erahnen, was an diesem Abend in den beiden vorgegangen war. Und nun, fast einen Monat später, schwieg es und sollte nie wieder in diesen Räumen erklingen. Rene musste daran denken, dass er das Instrument zusammen mit Andy seinerzeit zum Restaurant transportiert hatte. Es erschien ihm, als wären seitdem erst wenige Tage vergangen.
Sie hatten damals eigens dafür einen Lkw angemietet und das schwere Instrument unter Helgas wachsamen Augen ein- und auch wieder ausgeladen.
Das gleiche Instrument, das seine Besitzerin einst veranlasst hatte, an der Wohnungstür ihrer Nachbarn zu klingeln.
„Sage mal, Rene, du bist doch Krankenpfleger!“ Rene blickte etwas überrascht in die Augen einer weißhaarigen Dame, die ihm jedoch völlig unbekannt vorkam. Sie saß am Tisch zusammen mit Helgas Musikerfreunden neben Herbert, den er bereits kannte, weil dieser damals seine Geige aus der Hand gelegt hatte, um den beiden jungen Männern mit ihrem sperrigen Transportgut zu helfen.
„Ja, warum fragen Sie mich das jetzt?“
„Nun, unsere Freundin Helga, Gott sei ihrer Seele gnädig, ist in diesem Jahr bereits die dritte Freundin, die ich verloren habe. Gehst du als Fachmann davon aus, dass es jemals gelingen wird, ein Mittel gegen den Krebs zu finden?“
„Nun, ich würde mich nicht als Fachmann bezeichnen, immerhin bin ich nur Krankenpfleger und kein Arzt, weshalb ich wohl der falsche Ansprechpartner bin. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass selbst Professor Meinberg, der Leiter unserer Onkologie, diese Frage nicht beantworten könnte. Kurzum, wir können alle nur abwarten und hoffen.“ Keiner der Anwesenden hatte dem etwas hinzuzufügen.
Nur Herbert, der grad lieblos in einer Kompottschale herumstocherte, sprach mehr zu sich selbst als zu den Anderen. „Und wenn die eines Tages etwas finden, dann werden wir als normale Menschen wohl die Letzten sein, die davon erfahren.“ Jeder hatte den Satz gehört aber niemand wollte darauf eingehen. Erst jetzt hob er den Kopf und sah sich in der Runde um. „Oder kann mir zum Beispiel irgendjemand erklären, warum es bei Krebskranken fast immer den jeweils Zweitgeborenen einer Familie betrifft? Wenn ihr mich fragt, dann ist das schon mehr als merkwürdig.“
Alle Trauergäste sahen einander schweigend an. Man konnte förmlich spüren, wie sie über Herberts Bemerkung nachdachten. Einer nach dem anderen meldete sich zu Wort. Es schien tatsächlich etwas an dem zu sein, was Herbert mit ungerührter Miene öffentlich in den Raum gestellt hatte. Tatsächlich glaubten sich die Anwesenden daran zu erinnern, dass viele ihrer Freunde, die sie in den letzten Jahren zu Grabe trugen, einen älteren Bruder oder eine ältere Schwester hatten. Andere hingegen sahen die Ursachen vorrangig in steigenden Umweltbelastungen sowie verseuchten Lebensmitteln. Als Krankenpfleger hatte Rene schon viele Diskussionen dieser Art erlebt. Dieser Nachmittag sollte jedoch nicht irgendwelchen Grundsatzdiskussionen, sondern dem Gedenken an eine besonders liebenswerte Verstorbene gelten. Demonstrativ stand er auf und prostete den übrigen Trauergästen zu. „Auf Helga.“
Man redete noch viele Stunden über Helga bevor auch der letzte Gast gegen 21.00 Uhr von Rene und seiner Familie verabschiedet wurde.
Es war die eine Bemerkung von Herbert, die Rene in den nächsten Tagen immer wieder beschäftigte. Er hatte gerade seinen Dienst begonnen, als er wieder einmal daran denken musste.
Die Formulierung „wir als normale Menschen“ ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Sollte es wirklich Unterschiede zwischen normalen und weniger normalen Menschen geben? Und wenn ja, wer entscheidet, wann es sich um einen normalen und wann um einen besonderen Menschen handelt? Und wie verhielt es sich mit der Tatsache, dass es fast immer einen Zweitgeborenen betraf?
Biologisch und medizinisch war diese These mit Gewissheit nicht zu halten. Rene dachte an die Menschen, die er in den vergangenen Jahren auf ihrer letzten Reise begleitet hatte. Alle Patienten, mit denen er zu tun hatte, erschienen ihm eigentlich ganz normal, aber etwas hatten sie alle gemeinsam: Sie starben an der gleichen Krankheit.
KREBS
Heimtückisch, bösartig, immer unterschiedlich, aber unheilbar.
Plötzlich beschlich ihn das Gefühl, dass alle Begleitumstände des Todes, so wie er damit konfrontiert wurde, irgendwie einem Muster folgten. Er konnte nicht genau bestimmen, was es war, aber etwas war immer gleich. Er versuchte seine Gedanken zu ordnen, kam aber nicht dahinter, was ihm daran so merkwürdig vorkam.
War es die Behandlung? Oder die Diagnose? Waren es vielleicht die Patienten selbst? Oder spielte ihm Herberts Behauptung über die jeweils Zweitgeborenen einen Streich?
Rene schloss die Augen und versuchte sich zu konzentrieren. Als ehemaliger Abiturient müsste es doch möglich sein, eine Verbindung zu erkennen. Seine Schwester Julia war in solchen Dingen wesentlich besser als er. Sollte er sie anrufen? Julia würde wahrscheinlich wieder alles auf ihr Fachgebiet der Mathematik beziehen. Rene hingegen hatte es nie geschafft eine Verbindung zwischen Zahlen und beispielsweise Musik herzustellen. Wahrscheinlich war seine Denkweise für solche Zusammenhänge zu gefühlsbetont. Vor seinem geistigen Auge tanzten plötzlich Zahlen hin und her. Könnte Julia daraus wirklich etwas erkennen?
Rene versuchte sich darauf zu konzentrieren, doch es wollte ihm einfach nicht gelingen, es seiner Schwester gleichzutun.
Er entschied, diesen Gedanken für den Moment nicht weiter nachzugehen und widmete sich wieder seinen beruflichen Aufgaben.
Inzwischen lag bereits der zweite Patient nach Helga im selben Bett, in dem vor neun Tagen die beste Freundin seiner Familie gestorben war. Nur ein paar Tage zuvor hatte er wieder mit ansehen müssen, wie eine Frau die Hand ihres Mannes bis zur letzten Sekunde festgehalten hatte. Als es so weit war, wollte die Frau die Hand ihres Mannes gerade loslassen, als Rene sie bat noch einen Moment zu warten. Wieder hatte er begonnen innerlich zu zählen. „Einundzwanzig, zweiundzwanzig …“ Genau wie Rene wenige Tage zuvor, saß diese Frau fünf Tage am Sterbebett auf diesem einsamen Stuhl.
Und auch der Mann, der diesen Abend neben seiner sterbenden Tochter verbrachte, würde sich bald von ihr verabschieden müssen.
„Es ist heute bereits der vierte Tag, seit die Ärzte aufgegeben haben. Sind Sie wirklich sicher, dass niemand mehr etwas tun kann?“, fragte er Rene.
„In diesem Stadium dauert es höchstens noch 24 Stunden. Ich gehe davon aus, dass …“ Plötzlich unterbrach Rene mitten im Satz. „Einen Moment bitte ich bin gleich wieder bei Ihnen. Wenn sie mich brauchen, dann klingeln sie einfach nach mir.“ Er legte dem Vater noch einmal tröstend die Hand auf die Schulter, verließ das Krankenzimmer und ging in den Aufenthaltsraum. Sein Puls raste, doch er wusste nicht warum.
Was war es, das in ihm diese plötzliche Unruhe erzeugte. Es musste etwas mit dem zu tun haben, was er mit dem Vater der Patientin gesprochen hatte. Er versuchte alles noch einmal zu ordnen. ‚heute bereits der vierte Tag – höchstens noch 24 Stunden‘
Da waren sie: Julias Zahlen! Er schloss er die Augen. Die Zahlenreihe von 0 – 9 raste wie ein Eilzug immer wieder an ihm vorbei. Doch was wollten ihm diese Zahlen sagen? Krampfhaft versuchte er sich wieder auf seine Arbeit zu konzentrieren. Also ging er zurück ins Krankenzimmer, wo der Vater immer noch wie in Trance auf die Anzeigen des Monitors starrte. Rene stellte sich hinter ihm. „Wollen Sie sich nicht selbst etwas Schlaf gönnen?“, fragte er fast im Flüsterton. „Wenn sie nicht nach Hause wollen, dann könnte ich ihnen eine Liege ins Schwesternzimmer stellen lassen. Wir haben so etwas schon öfter gemacht.“ Langsam drehte sich der Mann zu Rene um. „Ich kann sie doch nicht alleine lassen. Was ist, wenn sie aufwacht und….“, Rene unterbrach ihn. „Sobald sich etwas ändert, rufe ich sie.“ Er sah dem Mann an, dass er kaum noch die Augen offen halten konnte. Trotzdem war er nicht bereit das Zimmer zu verlassen, wofür Rene das größte Verständnis hatte. Er nahm sich einen Stuhl und setzte sich neben dem Mann, der kurze Zeit später einschlief. Leise stand Rene auf und ging zurück in den Aufenthaltsraum, wo inzwischen auch Claudia eingetroffen war. „Nach einem kurzen „Hallo“ ließ er sich auf einen Stuhl fallen. Irgendwie musste es doch möglich sein, sich abzulenken. Claudia stellte ihm eine Tasse Kaffee hin und Rene griff sich eine Illustrierte, die auf dem Tisch lag. Lustlos blätterte er durch die Seiten, bis sein Blick auf eine fast komplett ausgefüllte Runde Sudoku fiel. „Zahlen“ Wohin er auch sah, immer wieder sah er Zahlen. Auf dem Herzmonitor, an den Zimmertüren, auf der Uhr und nun wieder. Rene rieb sich die Augen. Hätte er es nicht besser gewusst, dann hätte er schwören können, dass etwas mit seiner Sehkraft nicht in Ordnung war. Alles war plötzlich verschwommen. Trotzdem konnte er seinen Blick nicht abwenden. Wie aus einem dunklen Nebel trat eine einzige Ziffer immer wieder heraus. Es war die magische Zahl Fünf.
– Fünf Tage!!! –, schoss es ihm durch den Kopf.
War das ein Zufall? Rene versuchte sich zu erinnern.
Scheinbar waren es vom Zeitpunkt, in dem die Ärzte erklärten nichts mehr tun zu können, bis zum Eintreffen des Todes immer fünf Tage.
Wahrscheinlich spielte ihm seine Erinnerung nur einen Streich. Doch irgendwie konnte er die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Er musste sich unbedingt Gewissheit verschaffen. Also verließ er den Raum, um seinen Freund Andy anzurufen. Nach einem kurzen „Hallo“ kam Rene sofort zur Sache. „Ich habe nur eine kurze Frage. Wie lange lag deine Großmutter damals auf meiner Station? Du hast es neulich zwar erwähnt, aber ich bin mir unsicher, dass ich es noch richtig in Erinnerung habe.“ Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. „Fünf Tage, aber warum fragst du danach?“ „Ich wollte einfach nur wissen, wie viel Tassen Kaffee du mir von damals noch schuldest.“, log Rene seinen Freund kurzerhand an. „Wir sehen uns am Donnerstag. Mach‘s gut!“ Ohne eine weitere Erklärung abzugeben, beendete Rene das Gespräch und klappte sein Handy zu.
Anscheinend gab es tatsächlich ein Muster, nachdem die Menschen auf seiner Station verstarben und Rene war entschlossen der Sache auf den Grund zu gehen. Zweifellos brauche er noch mehr Informationen.
Irgendwo im Krankenhaus müssten Unterlagen existieren, die seinen Verdacht bestätigen oder ihn als Hirngespinst abtun würden. Auf der Station befanden sie sich nicht mehr, denn dafür hätten die wenigen Hängeregister nicht ausgereicht. Somit kam nur ein einziger Ort infrage, wo er danach suchen könnte. Das Aktenarchiv im Keller.