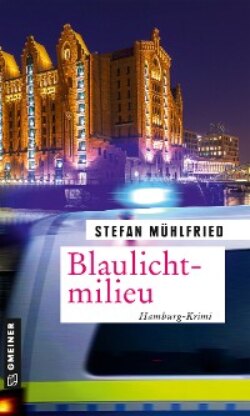Читать книгу Blaulichtmilieu - Stefan Mühlfried - Страница 8
Kapitel 3
Оглавление21. Mai
»Da«, sagte Harald, »Nummer 15. Fahr rechts ran.«
Es war später Vormittag und die meisten Anwohner waren bei der Arbeit. Die Erwerbslosenquote war hoch in Wilhelmsburg, aber es blieben genügend automobile Arbeitnehmer, um bequem einen freien Parkplatz in der Nähe des Hauses zu finden.
Marie und Harald stiegen aus dem BMW und gingen zum Eingang eines der typisch hamburgischen Wohnblöcke, vierstöckig und dunkelrot verklinkert. Auf der anderen Straßenseite standen keine Häuser, hier erhob sich sieben oder acht Meter hoch der Elbdeich.
Marie überlegte, ob man vom oberen Geschoss der Häuser aus das Wasser sehen konnte. Anderswo in Hamburg würde man für diese Lage am Ufer der Elbe horrende Mieten bezahlen, aber nicht hier auf der Veddel, einem der klassischen Arbeiterviertel Hamburgs. Noch nicht. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor gewiefte Immobilienspekulanten die Häuser aufkauften, grundsanierten und die alteingesessenen Multikulti-Einwohner gegen schicke junge Leute austauschten, die es hip fanden, in ein heruntergekommenes Viertel zu ziehen. Natürlich in Luxuswohnungen. »Gentrifizierung« hieß das, wenn sie sich recht erinnerte. Ein Prozess, der schon einige Stadtviertel vom authentischen Kiez zur Yuppie-Hochburg verwandelt hatte: Sankt Pauli, die Schanze, Ottensen … Lange würde es nicht mehr dauern, bis Wilhelmsburg dran war. Ging vielleicht schon los, wer weiß.
Harald studierte die Klingeltafel. »Kabaoglu, hier. Mann, haben die eine Sauklaue!« Er drückte den Knopf, und sie hörten weiter oben eine altmodische Türklingel schnarren.
Marie lehnte sich gegen die Tür und wartete auf den Summer.
Stattdessen wurde über ihnen ein Fenster geöffnet. »Ja bitte?«, fragte eine jung klingende Frauenstimme.
Sie traten einige Schritte zurück und blinzelten nach oben. Eine dunkelhaarige Frau Mitte 20 lehnte aus dem Fenster im zweiten Stock.
»Guten Tag, mein Name ist Marie Schwartz, und das ist mein Kollege Harald Grossmann. Können wir bitte Frau Kabaoglu sprechen?«
»Sind Sie Journalisten?«
»Nein.« Marie hielt ihre Dienstmarke hoch. Sie wollte vermeiden, das Wort »Polizei« laut nach oben zu rufen. Das brachte nur unerwünschte Aufmerksamkeit, speziell in Vierteln wie diesem.
Die junge Frau im Fenster nickte. »Kommen Sie rein, die Tür ist nicht verschlossen. Zweiter Stock links.«
Im Treppenhaus roch es nach Kohl, feuchten Wänden und exotischen Gewürzen. Der Handlauf war abgegriffen, die Wände schmutzig und von den Fenstern blätterte die Farbe ab. Umso überraschter war Marie, als die junge Frau die Wohnungstür öffnete und sie in ein blitzsauberes, wenn auch kitschiges Wohnparadies einließ. Auf den alten Bodendielen lagen kunstvoll geknüpfte orientalische Teppiche, die Wände waren mit einer dicken Stofftapete versehen, die obendrein glitzerte. Davor hingen Bilderrahmen mit Familienfotos und ein Spiegel mit einem breiten goldenen Rand in nachgemachtem Barockstil.
Aus dem Wohnzimmer klang ein aufgeregtes Durcheinander von Frauenstimmen bis in den Flur. »Haben Sie Besuch?«, fragte Marie.
Die junge Frau nickte und lächelte flüchtig. »Das sind Trauergäste«, sagte sie in akzentfreiem Deutsch. »Sie waren noch bei keinem türkischen Trauerfall, oder?« Sie war ausgesprochen hübsch, mit einem schwarzen Pferdeschwanz, hohen Wangenknochen und mandelförmigen dunklen Augen, denen man ansah, dass sie geweint hatte.
Marie lächelte verlegen. »Da haben Sie recht. Bitte verzeihen Sie uns, wenn wir uns mit Ihren Bräuchen nicht gut auskennen.«
Die junge Frau winkte ab. »Sie sind von der Polizei?«
»Ja«, sagte Marie und hielt ihr den Dienstausweis hin. »Ich bin Kriminaloberkommissarin Marie Schwartz, das ist Kriminalhauptkommissar Harald Grossmann. Dürfte ich fragen, wer Sie sind?«
»Şahika Kabaoglu. Mein Vater …« Sie schluckte schwer. »Entschuldigen Sie.« Sie zog ein Taschentuch aus der Jeans und putzte sich die Nase.
Marie nickte ihr freundlich zu. »Da gibt es nichts zu entschuldigen. Ihr Verlust tut mir sehr leid.« Sie hasste das Wort »Beileid« und die ganzen abgedroschenen Phrasen, aber sie wusste, dass alles, was sie sagte, lahm klingen musste.
»Danke«, sagte Şahika Kabaoglu. »Sie möchten sicher mit meiner Mutter sprechen, oder?«
»Wenn wir korrekt informiert sind, waren Sie beide am Flughafen. In diesem Fall würden wir gerne Sie beide sprechen«, antwortete Harald.
»Natürlich. Kommen Sie herein.« Sie ging voran ins Wohnzimmer, wo vier Frauen um den Couchtisch saßen.
Die Gespräche verstummten, als Marie und Harald den Raum betraten. Şahika Kabaoglu stellte sie kurz auf Türkisch vor; Marie verstand nur das Wort »Polis«. Kaum war es gefallen, da sprangen alle Frauen bis auf eine vom Sofa auf. Eine bot ihnen die frei gewordenen Plätze an, die beiden anderen liefen in die Küche und kamen gleich darauf mit Tee, Kaffee und Keksen zurück. Wortreich, halb auf Deutsch, halb auf Türkisch, nötigten sie Marie und Harald, sich zu setzen. Marie sah Hilfe suchend zu Şahika, die sich zu ihr beugte.
»Wir alle haben große Hoffnung, dass Sie denjenigen finden, der meinem Vater das angetan hat.«
»Das haben wir vor, das versichere ich Ihnen.«
Şahika Kabaoglu stellte sie ihrer Mutter vor, die neben ihnen auf dem Sofa saß. Sie war Anfang 60, hatte eine stämmige Statur, eine gepflegte Hochsteckfrisur und trug dunkle Trauerkleidung.
»Wollen Sie Kaffee«, fragte Mutter Kabaoglu mit einem mittelmäßig starken Akzent, »oder Tee?«
»Vielen Dank, ich –«
Harald fiel Marie ins Wort. »Tee, bitte. Für uns beide. Vielen Dank.«
Die Tochter goss ihnen ein und schob den Teller mit Keksen herüber. Dann nahm sie gegenüber auf der Vorderkante eines Sessels Platz.
»Frau Kabaoglu«, sagte Marie, »wir würden mit Ihnen und Ihrer Tochter gerne über das sprechen, was gestern auf dem Flughafen passiert ist. Ich verstehe, dass das alles noch sehr frisch und erschreckend für Sie ist. Trotzdem ist es leider notwendig, Sie jetzt schon zu befragen.«
Frau Kabaoglu nickte tapfer. »Ist wichtig, dass Sie alles wissen, damit Sie finden können den, der mein Mann getötet hat. Ich helfe Ihnen.«
»Vielen Dank. Ich –«
»Er war ein guter Mann. Ganz fleißig. Ist schon in der Nacht zu Großmarkt gefahren und hat Ware gekauft, jeden Tag. Immer gute Ware, immer frisch. Kunden waren immer zufrieden. Alle haben gerne gekauft bei uns. Immer freundlich zu den Kunden. Immer viel gearbeitet, damit Şahika und Altay gute Ausbildung bekommen. ›Wir sind doch jetzt Deutsche‹, hat er immer gesagt, und für deutsche Kinder ist Ausbildung wichtig. Noch wichtiger als für türkische Kinder.«
»Ihr Mann hat sich als Deutscher gefühlt?«
»Halb und halb. Ja, hat er gesagt, wir sind als Türken geboren, und wir gehen zu Allah als Türken, aber wir sind in Deutschland, und Deutschland ist gut zu uns, also wollen wir auch Deutsche sein. Er hatte viele deutsche Freunde.« Sie seufzte und hob die Arme. »Und wo sind sie alle? Keiner von ihnen kommt.«
»Ana, das ist anders hier in Deutschland«, sagte Şahika. »Die Deutschen kommen nicht zu Leuten, die trauern, weil sie Angst haben, zu stören.«
»Wirklich?« Frau Kabaoglu sah Marie entgeistert an, die zustimmend nickte. »Das ist doch dumm! Wer traurig ist, der braucht Freunde!« Sie hielt erschrocken die Hand vor den Mund. »Oh, das war schlecht gesagt. Ich wollte nicht sagen, dass Sie dumm sind.«
»Natürlich nicht.« Harald lächelte. »Wir sind ja hier.«
Frau Kabaoglu lachte leise und legte ihm und Marie die Hand auf den Arm. »Sie sind gute Menschen. Sie werden helfen zu finden den Mörder von meinem Ibrahim.«
Marie hatte einen Kloß im Hals. »Frau Kabaoglu, bitte erzählen Sie mir, wie der gestrige Morgen abgelaufen ist.«
Die Witwe nickte. »Wir sind ganz früh aufgestanden, weil Ibrahim sagte, wir müssen unbedingt zwei Stunden vorher an Flughafen sein.«
»Wann waren Sie am Flughafen?«
»20 nach sieben. Ich weiß noch genau, weil Ibrahim so froh war, dass alles gut geklappt hat. Altay hat uns gebracht mit Auto.«
»Wollte Altay nicht mit in die Türkei?«
Şahika schüttelte den Kopf. »Er arbeitet im Mercedes-Werk in Harburg, und er hat leider keinen Urlaub bekommen.«
»Weswegen wollten Sie in die Türkei? Wegen des Zuckerfestes?«
»Nein, mein Cousin wollte morgen heiraten.« Şahika seufzte tief. »Das ist natürlich abgesagt. Die ganze Familie ist völlig fertig.«
»Wo genau hat Ihr Bruder Sie abgesetzt?«
»Direkt vor dem Terminal. Vor der Abflugebene gibt es einen Parkstreifen, da hat er den Wagen abgestellt und ist noch kurz mit uns rein, um mit dem Gepäck zu helfen.«
»Heißt das, Ihr Bruder war in der Halle, als die Explosion stattfand?«
»Das haben wir am Anfang gedacht, aber wir haben ihn nicht gefunden. Irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, nach dem Auto zu sehen, und das war weg. Wir haben bis zum Schluss gehofft, dass mein Vater mit ihm gefahren ist.« Sie lachte trocken. »Völlig blöde Idee. Warum sollte er mit Altay wegfahren? Aber man klammert sich an jeden Strohhalm. Tja.« Sie drehte sich weg und suchte nach einem Taschentuch.
Marie wandte sich der Mutter zu, die zwar zu ihrer Tochter sah, doch offensichtlich tief in Gedanken versunken war. »Frau Kabaoglu?«
Sie schreckte auf. »Ja?«
»Sind Sie direkt in die Halle gegangen, nachdem sie aus dem Auto gestiegen sind?«
»Ja. Ibrahim raucht nicht mehr. Vor zwei Jahren hätten wir noch draußen stehen bleiben müssen.« Sie lachte leise und fing dann unvermittelt an zu weinen.
Marie machte ihren Platz auf dem Sofa frei, damit Şahika sich neben ihre Mutter setzen und sie trösten konnte. Sie ließ sich auf einem Sessel gegenüber nieder. »Was geschah danach?«, fragte sie.
Şahika hob den Kopf. »Wir sind direkt zum Check-in gegangen. Die Schlange war mächtig lang, und mein Vater hatte Panik, dass wir nicht rechtzeitig am Gate sein könnten. Na ja, und da haben wir erst einmal ein paar Minuten gestanden.«
»War Ihr Bruder dabei?«
»Ja, er wollte noch etwas bleiben, um meinen Vater zu beruhigen.«
»Beruhigen?«
»Dass es klappt mit dem Check-in und dass wir genug Zeit haben. Aber ich glaube, Altay war knapp dran, er wurde immer nervöser und schaute dauernd auf die Uhr.«
Marie und Harald tauschten einen raschen Blick aus. »Wie ging es weiter?«, fragte Marie.
»Dann sind wir alle auf die Toilette, ich und meine Mutter, und ein paar Minuten später mein Vater. Er meinte, wir sollten ausnutzen, dass Altay noch da ist und auf das Gepäck aufpassen kann.«
»Wie lange hat das in etwa gedauert?«
»Es war eine ziemliche Schlange vor dem Damenklo. Eine Viertelstunde bestimmt. Aber ich verstehe nicht …«
»Wir müssen den Ablauf der Tat so genau wie möglich rekonstruieren, wie bei einem Puzzle. Jedes kleinste Teil kann wichtig sein.«
»Na gut. Als wir fertig waren, haben wir nach meinem Vater geschaut. Weil er nicht mehr bei den Toiletten war, sind wir davon ausgegangen, dass er bereits zu Altay zurückgekehrt ist, und wollten zurück zum Check-in. Wir waren noch im Vorraum der Toilette, als es auf einmal krachte.«
»Sie haben die Explosion also nicht selbst gesehen?«
»Nein, zum Glück nicht. Aber es war auch so schrecklich genug.«
Frau Kabaoglu hob den Kopf von der Schulter ihrer Tochter. »Ja, schrecklich. Wir sind gleich raus in Halle und haben gerufen: Ibrahim, Ibrahim, Altay, Altay. Aber keine Antwort. War gar nicht laut nach Explosion. Ganz schrecklich, wie leise das war. Ibrahim hätte uns gehört, wenn er …« Sie vergrub ihren Kopf wieder an der Schulter ihrer Tochter.
Şahika sprang ein. »Wir wollten dorthin, wo wir meinen Bruder und das Gepäck zurückgelassen hatten, doch da war totales Chaos. Wir haben nach meinem Vater gesucht, aber wir konnten ihn nicht finden. Und irgendwann hat uns die Polizei fortgeschickt. Da waren überall Rauch und Feuer und Trümmer und Blut. Und Menschen lagen da. Manche haben sich noch bewegt oder geschrien, aber die meisten … Ich wollte auch nicht, dass meine Mutter meinen Vater so sieht.«
Marie nickte. »Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen an dem Morgen?«
Şahika lachte trocken. »Sie meinen, außer dass der Flughafen in die Luft geflogen ist?«
»Haben Sie jemanden beobachtet, der sich auffällig verhalten hat? Vielleicht jemanden, der besonders nervös war oder der unpassend wirkte?«
»In ein paar Tagen ist das Zuckerfest. Halb Deutsch-Anatolien war am Flughafen. Die waren alle genauso nervös wie mein Vater, und praktisch keiner von denen wirkte passend dort.«
»Frau Kabaoglu? Ist Ihnen am Flughafen etwas Besonderes aufgefallen?«
Die Mutter hob den Kopf und schüttelte ihn. »Nein, gar nicht. War ich doch selber so aufgeregt, habe ich gar nicht auf andere geachtet.«
»Das kann ich verstehen. Ich glaube, das ist für heute genug. Wir werden Sie sicher noch einige Male befragen, aber im Moment möchte ich Sie nicht zu sehr belasten.« Sie zog zwei Visitenkarten heraus und gab sie Mutter und Tochter Kabaoglu. »Wenn Ihnen etwas einfällt oder Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an. Auf der Karte steht auch meine Mobilfunknummer, unter der können Sie mich Tag und Nacht erreichen.«
»Wo ist eigentlich Ihr Sohn? Sollte er nicht bei Ihnen sein?«, fragte Harald.
Şahika antwortete für ihre Mutter. »Er war gestern hier und sagte, er müsse heute arbeiten und könne nicht freinehmen.«
»Könnten Sie uns bitte seine Anschrift und seine Telefonnummer geben? Wir würden uns gerne auch mit ihm unterhalten.«
Harald notierte die Nummer, die Şahika nannte.
Marie stand auf. »Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gibt es noch etwas, was wir für Sie tun können?«
»Mein Ibrahim«, sagte Frau Kabaoglu. »Können wir ihn bald bekommen? Der Koran sagt, Tote sollen schnell begraben werden. Ist schon ganzer Tag jetzt.«
»Es tut mir leid, aber das wird leider dauern. Der Leichnam Ihres Mannes muss genau untersucht werden.«
»Wird mein Ibrahim gut behandelt?«
»Wie bitte?«
»Gut behandelt. Ich habe gehört, dass Deutsche sagen, Tote sind nur noch …«, sie suchte nach einem passenden Wort, »… Ding. Für Moslem, Toter muss Respekt bekommen, weil Seele noch da ist.«
»Frau Kabaoglu, ich versichere Ihnen, die Rechtsmediziner werden Ihren Mann mit dem größten Respekt behandeln. Die Untersuchungen sind wichtig. Ihr Mann beziehungsweise sein Körper kann uns Hinweise darauf geben, was geschehen ist. Er hilft uns.«
Frau Kabaoglu nickte. »Das ist gut. Dann wird Allah vergeben, dass er so spät begraben wird.«
Marie und Harald verabschiedeten sich. Şahika brachte sie bis zur Wohnungstür. Kaum hatten sie das Wohnzimmer verlassen, kamen die drei Besucherinnen aus der Küche, verabschiedeten sich höflich von den beiden und liefen ins Wohnzimmer, wo sie das unterbrochene Gespräch fortsetzten. Marie konnte sie nicht verstehen, aber sicher wollten sie jedes Detail über den Besuch der Polizei wissen.
»Vielen Dank für die Hilfe«, sagte Marie zum Abschied. »Wir werden uns wieder bei Ihnen melden. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Kraft.«
Sie gingen zurück zum Auto. »Kommt dir das nicht auch seltsam vor?«, fragte Harald. »Dass der Sohn sagt, er bekomme nicht frei, obwohl sein Vater gestorben ist? Ich meine, selbst wenn es so wäre – jeder normale Mensch pfeift doch auf so etwas.«
Marie warf Harald den Schlüssel zu. »Schon. Vielleicht ist er einer von der ganz ehrgeizigen Sorte?« Sie stiegen ein.
»Also …« Harald ließ den Motor an.
»… auf zu Altay Kabaoglu«, ergänzte Marie.
Harald zog vom Parkplatz auf die Fahrbahn und steuerte in Richtung der Wilhelmsburger Reichsstraße, der Schnellstraße von Wilhelmsburg nach Harburg.
Sie fuhren eine Viertelstunde bis zum Mercedes-Werk. Obwohl hier nur Teile und keine kompletten Autos gefertigt wurden, hatte das Gelände eine beeindruckende Größe. Sie brauchten weitere 20 Minuten, bis sie die richtige Halle, und noch einmal fünf, bis sie den Vorarbeiter gefunden hatten.
»Altay?«, fragte der Vorarbeiter und stemmte die Arme in die Hüften. »Wenn Sie den finden, dann sagen Sie ihm, er soll auf der Stelle antanzen und sich seinen Einlauf abholen. ’tschuldigung, seine Abmahnung.« Er blinzelte zu Marie.
»Sie meinen, er ist nicht aufgetaucht?«
»Nee. Gestern nicht und heute auch nicht. Was hat er denn ausgefressen?«
»Wir führen nur einige routinemäßige Befragungen durch. Ist Ihnen in den letzten Tagen etwas an Altay aufgefallen?«
Der Vorarbeiter spitzte die Lippen und ließ den Atem entweichen. »Also, ein bisschen komisch war er schon.«
Marie und Harald wechselten einen raschen Blick.
»Inwiefern?«, fragte Harald.
»Na ja, er war irgendwie nicht richtig bei der Sache. Ist sonst ein prima Kerl und immer voll dabei. Leistet gute Arbeit, wirklich. Aber in den letzten Tagen … Er war ganz woanders mit seinem Kopf. Und in jeder Pause ist er raus, dabei raucht er gar nicht mehr. Ich glaube, er hat telefoniert.«
»Wissen Sie, mit wem?«
»Nee, keine Ahnung.«
»Könnten Sie uns bitte informieren, wenn Herr Kabaoglu wiederauftaucht? Wir würden ihm gerne ein paar Fragen stellen. Hier ist unsere Visitenkarte.«
»Klar«, sagte der Vorarbeiter und steckte die Karte in die Brusttasche seiner Latzhose.
»Vielen Dank.«
»Ist ein guter Kerl.«
»Wie bitte?«
»Altay. Ist ein guter Kerl. Das mit der Abmahnung nehmen Sie man nicht zu ernst.«
»Natürlich.«
Sie fuhren zu Altays Wohnanschrift und klingelten. Keine Antwort.
»Habe ich mir schon gedacht«, sagte Harald und drückte zum dritten Mal den Klingelknopf.
»Zu wem wollen Sie?«, fragte jemand hinter ihnen.
Sie drehten sich um. Eine ältere Frau blickte halb misstrauisch, halb neugierig zwischen ihnen hin und her.
»Zu Herrn Kabaoglu«, sagte Marie.
»Der ist nicht da. Soll ich ihm etwas ausrichten?«
»Nein, danke. Wir kommen später wieder.«
»Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen?«
»Wir wollten mit Herrn Kabaoglu über die Bibel sprechen«, sagte Marie. »Es ist nie zu spät, gerettet zu werden. Wie steht es um Ihr Seelenheil?«
»Gott bewahre«, schnaubte die Frau und verschwand im Haus.
»Marie«, tadelte Harald sie, konnte sich ein Grinsen aber nicht verkneifen.
»Ach, ich kann diese neugierigen alten Schachteln nicht ab.«
»Und wenn wir sie noch befragen müssen?«
»Schicken wir die Evangelisten Johannes und Markus.«
Sie setzten sich in den Wagen. Harald zog sein Telefon heraus und wählte Altays Mobilnummer. Über die Freisprechanlage hörten sie die Ansage: »Diese Nummer ist zurzeit nicht erreichbar.«
»Aha«, sagte Harald. »Allmählich wird es auffällig, meinst du nicht?«
»Ja, scheint fast, als wolle er nicht gefunden werden.«
»Mich würde interessieren, mit wem er die letzten Tage telefoniert hat.«
»Lass es uns herausfinden.«
Seit dem Anruf am Vortag hatte Altay gebetet, so oft er konnte und die Vorschriften es zuließen. Um Vergebung, dass er seinen Vater getötet hatte. Um Verständnis, dass er es nicht mit Absicht getan hatte. Aus Dankbarkeit, weil Schwester und Mutter lebten. Und für eine Eingebung, wie er mit seinen Glaubensbrüdern umgehen sollte.
Es war nicht recht, was sie getan hatten. Ungläubigen den Tod zu bringen, war gerecht und gottgefällig, aber es waren nicht nur Ungläubige in die Hölle geschickt worden. Sein Vater und viele der Toten waren gläubige Moslems – manche zwar nicht auf dem rechten Pfad der Tugend, den Versuchungen der Heiden anheimgefallen, schwach im Glauben und unwillig zu kämpfen. Aber musste ein gerechter Krieg nicht bei den Leugnern und Heiden, den falschen Propheten und Verkündigern der Sünde anfangen? Das Übel an der Wurzel ausreißen?
Wie konnten sie ihn nur so benutzen? Sie wollten ihm nicht sagen, was in dem Paket war, das er in den Koffer gelegt hatte. Was du nicht weißt, kannst du nicht verraten, hatten sie gemeint. Was sollte in so einem Paket schon sein? Geld wahrscheinlich. Oder Drogen, um ihren heiligen Krieg zu finanzieren. Das hatte er vermutet und es nicht genauer wissen wollen.
Aber Sprengstoff? Er war bereit, Ungläubige zu töten, ja, das war er. Sie hätten ihn nur fragen müssen, und er hätte den Sprengstoff am Flughafen versteckt und eigenhändig gezündet. Aber so?
»Allah ist mit dir. Du hast Großes vollbracht. Unsere Bewunderung und Dankbarkeit wird dir für immer sicher sein.«
Lächerlich! Bewunderung? Dankbarkeit? Wofür? Dafür, dass er ein nichtsahnender nützlicher Idiot war? Dafür, dass er keine Fragen stellte?
Sie hatten ihn geopfert. Ein Bauernopfer, das sie jetzt mit Geld und falschen Papieren abspeisen wollten. Ihm zur Flucht verhelfen, ja, das war bequem. Wahrscheinlich wäre es ihnen am liebsten gewesen, wenn er gleich mit in die Luft geflogen wäre. Oder war das sogar ihr Plan gewesen? Die ganze Familie am Flughafen, fröhlich, vollkommen unverdächtig, und dann – bumm!
Und jetzt hing die verdammte Polizei vor seiner Wohnung herum. Sie trugen Zivil, aber es waren Polizisten, ganz sicher. Er hatte nur ein paar Sachen von zu Hause holen wollen, bevor er endgültig untertauchte, doch daraus wurde nun nichts mehr. Sie waren auf seiner Fährte. Er konnte nirgends mehr hin, wo man ihn vermutete, mit niemandem reden, den er kannte, nichts tun, was verdächtig war. Nicht einmal seinen Vater zu Grabe tragen.
Und das war nur ihre Schuld.
Tim schloss die Wohnungstür hinter sich und warf den Schlüssel auf die Flurkommode. Er holte sich ein Bier aus dem Kühlschrank, setzte sich aufs Sofa, legte die Füße hoch und trank einen großen Schluck.
Der heutige Tag war im Vergleich zu gestern ruhig gewesen. Einiges an Kleinkram – ein umgeknickter Knöchel, eine Platzwunde und ein Verkehrsunfall mit einer Person, die Schmerzensgeld witterte, jedoch offensichtlich unverletzt war. Dazu einige ernst zu nehmende Einsätze – Asthma, Herzprobleme, ein gebrochenes Bein nach Motorradunfall.
Trotzdem war Tim rechtschaffen fertig, und er fragte sich warum. Klar, das Ding am Flughafen war nicht ohne gewesen, aber kein Grund, in den Seilen zu hängen. Lag es an der Sache mit Marie?
Er stand auf, ging zum Schlafzimmer und lehnte sich an den Türrahmen. Er hatte das Bett gestern Abend noch frisch bezogen – er hatte es nicht ertragen, ihren Geruch um sich zu haben. So großartig die Nacht gewesen war, so ernüchternd war der Morgen. Machte ihm die Abfuhr so zu schaffen? Er überlegte. Nein, sicher nicht. Damit konnte er leben. Auch er war das eine oder andere Mal vor dem Frühstück gegangen – das war halt so bei One-Night-Stands.
Er ging zurück ins Wohnzimmer und ließ sich wieder aufs Sofa fallen. Die Bierflasche schäumte über, und er bemühte sich, den Schaum aufzuschlürfen, bevor er auf den Boden tropfte.
One-Night-Stand – ja, das war es wohl gewesen. Von Zeit zu Zeit ganz okay, wenn man solo war, aber nur, solange keiner von beiden mehr erwartete.
Und nun hatte es ihn erwischt. So fühlte sich das also an.
Er ging in die Küche und holte Gemüse aus dem Kühlschrank. Kochen, fand er, war eine wunderbare Sache, um die Nerven zu beruhigen. Gemüse schnippeln hatte für ihn etwas geradezu Meditatives. Er hatte das Gefühl, die Pesto-Gemüsepfanne würde heute Abend ziemlich groß ausfallen.
Das Telefon klingelte. Er ging ran, ohne vorher auf die Nummer zu sehen. Großer Fehler.
»Roth.«
»Ich muss mit dir reden.«
Natürlich. Welchen Grund sollte man sonst haben, jemanden anzurufen? Von Liebesgeflüster konnte sicher keine Rede sein, wenn die Ex anrief.
Tim verbiss sich einen Kommentar. »Was gibt’s?«, fragte er.
»Das Wochenende. Es wird nichts.«
»Aber …« Er rammte das Gemüsemesser ins Brett und ging ins Wohnzimmer. »Es ist mein Wochenende! Das kommt überhaupt nicht infrage!«
»Melanie will unbedingt auf diesen Reiterhof. Du kannst ihr gerne sagen, dass das nicht geht. Soll ich sie holen?«
»Und auf die Idee mit dem Reiterhof ist sie ganz alleine gekommen, richtig?«
»Jaqueline geht da hin und sie möchte Melanie mitnehmen.«
»Schackeline ist eine dumme Ziege, genau wie ihre Mutter.«
»Jaqueline ist zufällig Melanies beste Freundin.«
»Nein, Schackelines Mama ist deine beste Freundin. Gib ihr einen Tritt von mir, sie sitzt ja garantiert neben dir.«
Kurze Stille. »Es ist besser, wenn du auf das Wochenende verzichtest. Für Melanie.«
»Für dich, meinst du. Weil du mir mal wieder eins auswischen willst.«
»Das ist doch lächerlich. Warum sollte ich dir eins auswischen wollen?«
»Lass mich überlegen … Weil du mich zwingen wolltest, meinen Job aufzugeben?«
»Wenn man eine Familie will, muss man eben Zugeständnisse machen.«
»Komisch. Meine Kollegen kriegen das prima unter einen Hut.«
»Also, was ist jetzt mit dem Wochenende?«
»Ich hole sie am Freitag ab. Punkt.«
»Tja, das wird leider nichts, wir fahren am Donnerstag.«
»Petra, möchtest du, dass ich mit dem Jugendamt vor der Tür stehe? Frau Berger hat deine Nummer doch schon auf der Kurzwahltaste.«
»Du willst wirklich die Mutter deines Kindes beim Jugendamt denunzieren? Was bist du nur für ein Vater!«
»Gib mir die Adresse des Reiterhofs, ich hole …«
Es klickte im Telefon, dann war die Leitung unterbrochen.
Fassungslos sah Tim den Hörer an, dann feuerte er ihn auf das Sofa und fluchte, was das Zeug hielt.
Anschließend nahm er die Jacke vom Haken. Er brauchte jetzt keine meditative Gemüsepfanne, er brauchte Ablenkung. Und ein paar Bier. Beides würde er im »Eden« finden. Plus einen fetten Burger.