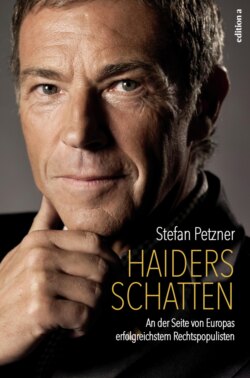Читать книгу Haiders Schatten - Stefan Petzner - Страница 6
Im Herz der Karawanken
ОглавлениеWir stiegen mit Atemwolken vor den Mündern und umgeschnallten Rucksäcken durch den frühen Morgen den Berg hinauf. Im Gegensatz zu Jörg Haider hatte ich nie viel Spaß am Wandern und Bergsteigen gehabt. Für mich als Bergbauernkind war die Natur kein so großes Abenteuer wie für ihn, und mit ihm war es besonders anstrengend, weil er Sport immer gleich als Wettkampf interpretierte. Doch an diesem sonnigen 28. Dezember des Jahres 2007 hatte ich keine Wahl. Haider hatte seine Funktion als Kärntner Landeshauptmann von Anfang an als eine Art Dauerwahlkampf angelegt und ließ sich Veranstaltungen wie die »Eierspeisparty« in der Klagenfurter Hütte im Bärental nicht entgehen. Umso weniger, als das Bärental seine Wahlheimat war. Er wollte, dass ich mitkomme, und ich hatte mich schließlich überreden lassen.
Uriges Beisammensein mit dem Zweck, Spenden für die Bergrettungen Klagenfurt und Ferlach zu sammeln, Zieharmonika-Musik, Gesang, Tanz, und zur »Eierspeis« viel Alkohol, das war das so einfache wie beliebte Konzept der Veranstaltung. Seit 1984 war sie Tradition, und auch dieses Jahr würden sich an die zweitausend Menschen bei dem ländlichen Spektakel einfinden, alle mit rohen Eiern im Gepäck, aus denen ihnen der Hüttenwirt ihre »Eierspeis« zubereiten würde. Einem Volkspolitiker wie Haider bot das eine perfekte Bühne. Während ich als sein Pressesprecher und engster Mitarbeiter eher widerwillig und einsilbig durch den Schnee stapfte, riss mich ab und zu das Gelächter der kleinen Wanderergruppe um ihn aus meinen Gedanken.
Als wir oben ankamen, war die Hütte bereits gefüllt, doch wie immer strömten über den Tag verteilt immer mehr Gäste in das kleine Alpenvereinshaus inmitten der Karawanken, bis es darin drückend eng wurde. Haider störte das nicht. Er kam umso mehr in Fahrt, je voller die Hütte wurde. Bis zum frühen Abend mischte er sich unter die Menschen, ging von Tisch zu Tisch, schüttelte Hände, scherzte, sang und tanzte. Obwohl der Mann auf die Sechzig zuging und damit mehr als dreißig Jahre älter war als ich, hatte er eine scheinbar unerschöpfliche Energie.
An der Volksnähe, die er in der Hütte an den Tag legte, wirkte nichts inszeniert. War es auch nicht. Haider liebte das Bad in der Menge. Während anderen Politikern der direkte Kontakt zu den Bürgern suspekt bis unheimlich ist, eine lästige Pflichtübung vor allem in Wahlkampfzeiten, blühte Haider im Umgang mit Menschen erst richtig auf. Sie waren es, die seine Akkus mit Energie speisten. Tag für Tag aufs Neue. Je mehr Menschen er begegnete, umso größer war seine Energie.
Noch dazu hatte er die erstaunliche Gabe, sich Menschen, die er nur ein einziges Mal gesehen hatte, über Jahre hinweg zu merken, meist samt ihren Geschichten. Oft genug verblüffte er einen Gesprächspartner, wenn der »kennst mich eh nimmer« sagte, und Haider Jahre nach der ersten und einzigen Begegnung mit dem Mann, antwortete: »Klar, du bist doch der Heinz aus dem Maltatal. Wie geht es deinen beiden Töchtern? Die müssen jetzt auch langsam groß sein.«
Er wisse auch nicht, woher er das habe, hatte Haider einmal zu mir gesagt, er benütze es einfach. Jedem einzelnen seiner Gesprächspartner gab er damit das Gefühl, ihm ganz nahe und verbunden zu sein. Als wären sie alle keine Wähler, sondern ein fixer Teil seines Lebens, an den er sich zu jeder Zeit an jedem Ort erinnerte. Sie liebten ihn dafür und er war damit für sie weniger die Respektperson eines Landeshauptmannes, sondern vielmehr ein Freund, ein Kumpel, sie fühlten sich als Teil seiner großen Familie, die er Kärnten nannte und als dessen Oberhaupt er sich ansah.
Als die Dämmerung hereinbrach, stiegen wir mit ein paar Anderen wieder ab und erreichten schließlich das Anwesen der Haiders. Haider hatte natürlich noch lange nicht genug und wollte die Feierei noch im Haus ausklingen lassen. Das renovierte alte Bauernhaus lag abgeschieden in dem Tal, das seinen Namen von den vielen Bären hat, die es dort einmal gab. Ringsum erstreckte sich dichter Nadelwald. Unweit des Anwesens, auf einer Waldlichtung, stand eine kleine Kapelle. Nähere Nachbarn gab es in dieser Abgeschiedenheit keine, und auch keinen Handyempfang.
Wir polterten in das längst verdunkelte Haus und unterhielten uns in der rustikalen Bauernstube mit einer kleinen Gruppe von Begleitern noch lautstark über das Erlebte und den hinter uns liegenden Tag. Nach gut einer Stunde verabschiedete ich mich, stieg in meinen silbergrauen Nissan und fuhr los.
Die Straße nach Klagenfurt, die durch das Rosentaler Idyll führt, ist bei Tageslicht für Urlauber eine echte Traumstraße. Bei der herrschenden Witterung konnte ich mich darauf allerdings nicht konzentrieren, zumal nach einer derart ausgelassenen Feier. Ich richtete meine ganze Aufmerksamkeit also auf die Fahrbahn, die in engen Serpentinen einen Berg hinab und dann wieder hinauf führte, und auf der eine dünne Schneedecke lag.
Ich fuhr langsam und vorsichtig und kam gut voran. Bis zu dem Moment als ich mit meinen Rädern auf eine spiegelglatte Eisfläche traf und die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Auto ließ sich nicht mehr steuern, schleuderte und glitt geradewegs auf eine steile Böschung zu. Leitplanken gab es dort keine. Meine Tasche, mein Handy und ein paar andere Dinge, die am Beifahrersitz gelegen waren, flogen durcheinander, als der Wagen einen Erdwall am Straßenrand durchbrach und über die Böschung hinunterstürzte.
Mit aufgerissenen Augen sah ich mit Schnee bedeckte Fichten auf mich zukommen, während mein Wagen durch das Strauchwerk rutschte. Mit einem dumpfen Knall kam der Nissan zum Stillstand. Er hing jetzt, abgefangen von einem Baumstumpf umgekippt im Gebüsch, sodass von der Straße her die Bodenplatte und die Räder zu sehen gewesen wären.
Ich hing still im Gurt und sah mich um, bis mich ein Knarren aus der Starre riss. Ich bekam Angst. Was, wenn das Auto weiter die Böschung hinunter purzelt? Ich löste den Gurt, prallte gegen die Fahrertür und kletterte auf allen Vieren über die Beifahrerseite hinaus ins klirrend kalte Freie und hinauf auf die Straße.
Es war längst stockdunkel. Ich stand mitten im Dezember in der Einöde, weit und breit kein Mensch, die Jacke im Auto, das Auto im Gebüsch. Wenigstens war ich relativ unversehrt, wie ich nach gründlichem Abtasten feststellte. Neben dem Handy hatte ich im Auto noch schnell meine Zigaretten zusammengesucht, und zündete mir eine an. Zwar war ich durch den Unfall in einem leichten Schock, mir war aber klar, dass ich noch nicht weit weg vom Anwesen der Haiders sein konnte. Also wählte ich die Festnetznummer im Bärental. Haider hob sofort ab. Ich redete bewusst beschwichtigend. »Ich habe ein kleines Problem«, sagte ich. »Ich habe gerade einen Unfall gebaut.«
»Um Gottes Willen, wo bist du? Ist dir etwas passiert?«
Ich beruhigte ihn. »Alles in Ordnung. Ich muss nur irgendwie das Auto aus der Böschung kriegen«, sagte ich.
»Rühr dich nicht vom Fleck, ich bin gleich da«, sagte Haider, nachdem ich ihm die Stelle so genau wie möglich beschrieben hatte.
Da stand ich also frierend mitten in diesem winterlichen Nirgendwo, wartete und starrte auf die leuchtenden Scheinwerfer meines Wagens. Nach kaum zehn Minuten hörte ich in der Ferne Sirenen aufheulen. Zuerst stellte ich keinen Zusammenhang zwischen ihnen und meinem Missgeschick her, schon gar nicht, als es anscheinend mehrere Sirenen wurden. Doch sie kamen näher, und wenige Minuten später war es, als würden aus allen Ecken des Tals Einsatzfahrzeuge auf mich zurasen.
Eine Heerschar an Einsatzkräften rückte an. Offensichtlich hatte Haider sie persönlich verständigt. Es war mir peinlich und ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. So ein Aufwand, bloß um mein Auto aus der Böschung zu ziehen, dachte ich und erklärte den Einsatzleuten fast entschuldigend, was geschehen war. Da brauste auch schon Haider in seinem schwarzen Phaeton daher, stellte ihn mitten im Geschehen ab und sprang heraus.
Nachdem er sich kurz vergewissert hatte, dass es mir halbwegs gut ging, verschaffte er sich einen Überblick über die Lage. Während ich auf und ab lief, eine Zigarette nach der anderen rauchte und anfing, mir darüber Gedanken zu machen, wie mein Auto wieder halbwegs unbeschädigt aus der Böschung zu kriegen wäre, dirigierte Haider gemeinsam mit dem Feuerwehr-Kommandanten die Einsatzkräfte. Die befestigten an den Vorder- und Hinterrädern Seile und hoben den Nissan mit einem Kran hoch in die Luft und aus der Böschung heraus.
Ein Polizist trat auf mich zu. Ich hatte noch gar nicht bemerkt, dass in der Zwischenzeit auch die Polizei eingetroffen war. »Haben Sie Alkohol getrunken?«, fragte er.
Ich sah ihm in die Augen und schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte ich.
Vielleicht glaubte er mir, vielleicht auch nicht, jedenfalls fragte er nicht weiter. »Die Kurve liegt tagsüber im Schatten. Da bilden sich bei etwas milderer Witterung regelmäßig Eisplatten«, sagte er stattdessen. Schon vor mir seien einige Fahrer hier weggerutscht. »Da sollte die Straßenmeisterei in Zukunft wohl Schotter streuen.« Damit ging er wieder.
Sie stellten meinen Wagen behutsam auf die Straße und nach Aufforderung Haiders drehte ich am Zündschlüssel. Niemand rechnete damit, dass das leicht verbeulte Ding anspringen würde, aber einen Versuch war es wert. Nach kurzem Rattern lief der Motor tatsächlich.
Am liebsten wäre ich gleich losgefahren, aber das ließ Haider nicht zu. »Du fährst sicher nicht selbst«, sagte er.
Ein junger BZÖ-Parteifunktionär, Fred Reininger, sollte mich chauffieren. Er war zuvor bei der kleinen Runde im Anwesen der Haiders dabei gewesen. Doch wir konnten noch nicht aufbrechen. Denn mit großer Geste verkündete Haider, dass alle Anwesenden zum Dank für die schnelle und professionelle Aktion in das nächste Wirtshaus eingeladen seien.
»Wir müssen das machen«, sagte er, als er bemerkte, wie müde und geknickt ich war. »Es dauert auch nicht lang.« Ich wollte nach der Unfall-Aufregung nur noch heim, fühlte mich aber in der Schuld der Feuerwehrleute und widersprach daher nicht.
Gegen zehn Uhr abends kamen wir in einem netten, aber mit seinem Stil der Siebzigerjahre schon etwas verkommenen Wirtshaus an. Die Tischtücher waren aus Plastik, die hölzernen Stühle mit Schaumgummi gepolstert und die bunten Tapeten an der Wand verblasst. Der Wirt staunte nicht schlecht, als rund zwanzig Gäste zur Tür herein strömten, die noch dazu der Landeshauptmann anführte. Schließlich war das Gasthaus eher als Treffpunkt der slowenischsprachigen Volksgruppe bekannt. Nachdem Haider dem verdutzten Wirt mit einem lauten »servas« die Hand entgegengestreckt hatte, wandte er sich an mich und senkte die Stimme. »Es ist gut, dass wir hier auch einmal vorbei schauen«, sagte er.
Haider hatte halb Kärnten schon einmal die Hand geschüttelt und sprach ohnedies die meisten Kärntner per du an. Allen Sicherheits-Warnungen seiner Mitarbeiter und der Exekutive zum Trotz hatte er nicht die geringste Schwellenangst und ging überall hinein, selbst in die windigsten Spelunken, aus denen angesichts der dunklen Gestalten darin der Großteil der bürgerlichen Gesellschaft Kärntens gleich wieder geflüchtet wäre.
Wir saßen also dort, zwei Feuerwehrautos, einen Phaeton und einen verbeulten Nissan vor dem Gasthaus geparkt, und Haider schwang sich vor der versammelten Truppe zu einer Dankesrede auf. Er war verzückt. Der Abend bot ihm unversehens schon wieder eine Bühne, was ihm schon immer mehr Freude bereitet hatte, als einmal einen stillen Dezemberabend zurückgezogen mit sich selbst zu verbringen.
Er redete über Verlässlichkeit und andere Werte, und zwischendurch drang wieder entspanntes Gelächter, untermalt vom Klirren der Gläser, zu mir. Ich war leicht benommen, doch als Mann der zweiten Reihe, in jener Rolle, die ich mir für mein Leben ausgesucht hatte, wollte ich Haider nicht allein lassen und schon gar nicht ihm die Show stehlen.
Ziemlich einsilbig wartete ich darauf, endlich heimfahren zu können, doch es sah nach einer Stunde noch immer nicht gut für mich aus. Die Rede war zwar vorbei, aber die zweite Runde bereits bestellt. »Entschuldige, könnten wir dann bald aufbrechen?«, sagte ich nach fast zwei Stunden zu ihm. »Irgendwie geht es mir nicht so gut.«
Haider klopfte mir auf die Schultern. »Gleich«, sagte er.
Während die Gruppe immer ausgelassener wurde, verfiel ich zusehends. Schließlich wurde mir übel. Mit der Hand vor dem Mund riss ich gerade noch die Klotür auf und übergab mich im nächsten Augenblick. Obwohl ich nach wie vor halb ohnmächtig war, putzte ich das Klo mit Papier, um es halbwegs zivilisiert zu hinterlassen. In meiner Funktion brauchte ich keine Reden zu halten, aber ich durfte auch keinen schlechten Eindruck machen. Als ich zum Tisch zurückkam, sah mich Haider aufmerksam an. »Dir geht es wirklich nicht gut«, sagte er.
Ich wusste, dass ich käsebleich war. »Ich habe gerade gekotzt. Aber ich glaube, das war nur vom Schock«, sagte ich.
Er stand auf. »Wir fahren ins Krankenhaus«, sagte er.
Ich schüttelte müde den Kopf. »Ich brauche nur etwas Schlaf.«
»Wir fahren jetzt sofort.«
Ich hasste Krankenhausaufenthalte und wollte tatsächlich nur ausschlafen, aber Haider machte sich nun offensichtlich wirklich Sorgen und duldete daher keinen Widerspruch. Also nahm ich am Beifahrersitz seines Phaeton Platz und er fuhr mich ins Landeskrankenhaus Klagenfurt, während Fred Reininger meinen demolierten Nissan zu meiner Wohnung brachte.
Eine Menge Schwestern liefen zusammen, als der Landeshauptmann persönlich einen Patienten in die Notaufnahme brachte. Er schüttelte allen die Hand. Einige kannte er auch hier, die sprach er mit ihrem Vornamen an. »Schaut ihn euch bitte genau an, Monika. Er hatte einen Unfall mit dem Auto. Wer weiß, was da passiert ist.«
»Mir geht es eh ganz gut. Alles halb so wild«, sagte ich, doch niemand hörte mir zu. Was mich nicht kränkte. Ich wusste, dass mir die Sonderbehandlung nicht zuteil wurde, weil ich Stefan Petzner war, sondern weil ich Haiders rechte Hand war. Meine Rolle privilegierte mich in Kärnten und das war reizvoll, aber ich war mir des Unterschiedes immer bewusst: Ohne Haider wäre ich nichts in Kärnten.
Ich konnte in Krankenhäusern nie gut schlafen, doch Haider bestand darauf, dass ich blieb. Ich kannte ihn als hilfsbereiten Menschen, der da war, wenn ihn jemand brauchte. Das zeichnete ihn aus. Andererseits war er nicht in der Lage, einer Bühne zu widerstehen, die sich ihm bot. Deshalb hielt ich mich nach meinem ungehörten Einwand auch hier im Hintergrund. Auch das Krankenhaus war sein Auftritt, nicht meiner, und seine Fürsorge gehörte zumindest zum Teil zum Programm.
»Wir machen das schon, Herr Landeshauptmann«, sagte Schwester Monika zu ihm. »Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Herrn Petzner wird es hier an nichts fehlen.«
Ich kam in den Genuss aller Annehmlichkeiten, über die ein Krankenhaus verfügt. Die Ärzte stellten nichts weiter als eine leichte Gehirnerschütterung fest, trotzdem bestanden die Schwestern weiterhin darauf, dass ich für die Nacht blieb, selbstverständlich in einem Einzelzimmer, das sofort bereitstand.
Als ich am nächsten Tag aufwachte, hatte ich Lust auf eine Morgen-Zigarette. Ich suchte das halbe Krankenhaus ab, bis ich einen Raucherhof fand. Kaum hatte ich mir eine angesteckt, stand ein Arzt neben mir, als hätte er mich die ganze Zeit beschattet. »Sie dürfen noch nicht rauchen«, maßregelte er mich. »Warten Sie bitte die weiteren Untersuchungen ab.« Es klang nach Rundum-Check vom Haaransatz bis zu den Zehennägeln.
Ich hatte genug. »Ich habe nichts und ich gehe jetzt nachhause«, antwortete ich, was der Arzt erst akzeptierte, nachdem ich einen Revers unterschrieben hatte. Am Weg aus dem Krankenhaus rief ich Haider an, sagte ihm, dass alles in Ordnung sei, und nahm mir ein Taxi. Unterwegs nach Hause hörte ich im Radio die Nachrichten. »Unfall des Pressesprechers von Landeshauptmann Dr. Jörg Haider. Stefan Petzner kam gestern in den späten Abendstunden im Rosental mit dem Wagen von der Straße ab.«
Die nächsten zwei Stunden musste ich damit verbringen, meiner Familie, Verwandten und Freunden am Telefon zu erklären, dass mir nichts fehlte. Zwischendurch tauchte auch schon mediale Kritik auf, weil bei der Bergung meines Wagens niemand einen Alko-Test mit mir gemacht hatte.
Als sich der Rummel legte und ich mich daheim in meiner kleinen Sofa-Ecke zurücklehnte, um meinen Unfall am vergangenen Freitag-Abend noch einmal Revue passieren zu lassen, fiel mir ein Traum ein. Einer, den ich immer wieder hatte, und der einer von diesen intensiven und besonders real scheinenden war.
Darin ging es auch um einen Unfall, bloß war nicht ich das Opfer. Alles lief in diesem Traum immer genau gleich ab. Mitten in der Nacht läutete mein Handy. Es war immer der gleiche Mann, dessen Stimme ich nicht kannte. Sein letzter Satz war immer der gleiche: »Der Landeshauptmann ist tot«, sagte er.