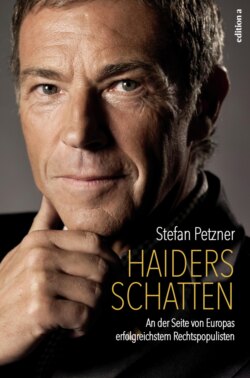Читать книгу Haiders Schatten - Stefan Petzner - Страница 8
Mein politischer Hintergrund
ОглавлениеIch habe mich nie für Ideologien interessiert. Meine Begeisterung für die Politik galt immer nur dem Handwerk. Als Kind interessierte mich, wer die Kugelschreiber, Sticker und Aufkleber machte, die ich im Kofferraum meines Vaters fand. Je mehr ich über diese Dinge herausfand, desto mehr faszinierte mich, womit sich Menschen begeistern ließen und womit nicht, oder wie Wahlkämpfe funktionierten und welche Dynamik ihnen innewohnte. Schuld daran war wohl eine Prägung durch meine Familie, die mütterlicherseits aus einem christlich-sozialen und väterlicherseits aus einem freiheitlichen Teil bestand. Die politischen Wurzeln beider Teile reichten weit in die Vergangenheit.
Meine Mutter, eine geborene Kocher, bekam von ihren Eltern den Namen der österreichischen Kaiserin Maria-Theresia. Die Kochers waren eine von zwei großen Bauernfamilien in unserem Tal. Ihr erster politischer Funktionär war Friedrich Kocher, mein Ururgroßvater, der von 1919 bis 1920 für die Christlich-Sozialen Mitglied der konstituierenden Nationalversammlung der Ersten Republik war. In diesem ersten, vom Volk frei gewählten Parlament in der Geschichte Österreichs, nach dem Ersten Weltkrieg, beschloss er die Bundesverfassung mit und stimmte bei der Ratifizierung des Friedensvertrags von St. Germain ab. Schon während der Anfänge des Nationalsozialismus waren die Kochers offen gegen Hitler, dessen Schergen den damaligen christlich-sozialen Bundeskanzler Österreichs, Engelbert Dollfuß, ermordeten. Der Name meiner Großmutter war ein Tribut an ihn: Engelberta. Einer unserer Familienlegenden zufolge verweigerte meine Ururgroßmutter Wehrmachtssoldaten einmal sogar Verpflegung. »Für den Hitler gib i nix«, soll sie gesagt haben.
Auch die politische Tradition der väterlichen Linie in meiner Familie reichte weit zurück. Klement Wallner, mein Ururgroßvater väterlicherseits, war Mitglied im Landbund, einer deutsch-nationalen, antiklerikalen Bauernbewegung, die in Deutschland entstanden war und sich auch in Österreich verbreitet hatte. Wie viele zur damaligen Zeit war wohl auch er für den Anschluss Österreichs an Deutschland. Denn nur wenige glaubten damals an das Überleben dieses kleinen Rest-Österreichs, das von der einst so großen K&K-Monarchie übrig geblieben war.
Mein Großvater väterlicherseits, Rudolf Petzner, war ein klassischer Mitläufer. Über seine Haltung im Dritten Reich sprachen wir nie viel. Es hieß von ihm nur, dass er im Zweiten Weltkrieg als Soldat in Deutschland stationiert gewesen sei. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war er Anhänger und Mitglied des VDU, des Verbandes der Unabhängigen, einem nach dem Krieg neu entstandenen Sammelbecken national gesinnter Kräfte. Später wurde er Mitglied der Freiheitlichen Partei Österreichs, der FPÖ, die Ende der Fünfzigerjahre aus dem VDU hervorging.
Mein Vater Hubert wurde 1968 ebenfalls Mitglied der FPÖ. Er übernahm bereits in jungen Jahren sein Mandat als Gemeinderat in unserem Dorf, das damals immer die ÖVP dominierte. Er wurde FPÖ-Ortsparteiobmann und kandidierte später auch für den steirischen Landtag.
Mit meinen Eltern begegneten sich also zwei Kinder aus zwei Familien, die politisch völlig konträr waren. Noch dazu waren die Petzners neben den Kochers die zweite große Bauernfamilie in unserer Gegend, weshalb beide Familien besondere Beachtung und Aufmerksamkeit fanden. Die Liebe wollte es so, dass mit meinen Eltern ausgerechnet zwei Kinder aus diesen beiden großen Familien zueinander fanden und heirateten.
Da es damals üblich war, um Erlaubnis zu bitten, wollte meine Mutter ihrer Urgroßmutter ihre Wahl möglichst schonend beibringen. »In Ordnung«, sagte die. »Der Hubert ist ein anständiger Bauer.« Dann hob sie einen Finger. »Aber dass er ein Freisinniger ist, das passt mir gar nicht.« Die Anhänger der Freiheitlichen Partei nannten sie bei uns damals noch »Freisinnige«.
Trotz dieser gegensätzlichen Einstellungen befreundeten sich beide Familien eng miteinander. Die einzige Folge der politischen Trennlinie zwischen ihnen war eine besonders intensiv gelebte politische Diskussionskultur. Politik war bei uns immer Thema. Wir waren alle daran interessiert. Wie das bei einer großen Bauernfamilie mit fünf Kindern so ist, saßen im Haus Petzner immer alle am Küchentisch und debattierten. Wir lernten dabei die Materie spielerisch kennen, indem wir anfangs nur zuhörten und dann immer mehr mitredeten. Mein Vater gab uns nie eine Linie oder eine Ideologie vor. Er war eher darauf bedacht, uns zu mündigen und selbstbestimmten Bürgern zu erziehen.
Nachrichtensendungen im Fernsehen waren bei uns Fixtermine, nach denen wir das Weltgeschehen besprachen. In unserem Tal war das Fernsehen das einzige richtige Fenster zur Welt. Sonst gab es nur Wald, Wiesen und Kühe, was idyllisch sein mochte, aber auch sehr abgeschieden. Wir waren als Bauernfamilie nie im Ausland auf Urlaub gewesen. Schon ein Ausflug zum Wörthersee war etwas Besonderes für uns, obwohl er kaum eine Stunde Autofahrt entfernt lag. Als ich mit knapp elf Jahren zum ersten Mal eine Rolltreppe sah, war das wie ein Weltwunder für mich. Über Politik zu diskutieren war für mich deshalb auch eine Form, am Rest der Welt teilzuhaben.
Der Fall der Berliner Mauer etwa war für mich ein einschneidendes Erlebnis. Dass der Kommunismus im Osten Deutschlands gescheitert war, verstand ich damals nicht wirklich, dennoch saß ich mit den anderen vor dem Fernseher und sah mit großen Augen all diese Menschen auf der Mauer stehen. Etwas Gewaltiges, Weltveränderndes passierte da, das begriff ich. Mein Vater, der neben mir saß, war aufgelöst und glückselig. »Passt auf und merkt euch das«, sagte er zu uns Kindern. »Schaut zu, denn in diesem Moment wird Weltgeschichte geschrieben.« Sein Versuch, uns die Hintergründe zu erklären, schlug fehl, doch eine Sache verstand ich: Politik verändert die Welt.
Der Sturz des rumänischen Diktators Nicolae Ceaușescu war auch so ein Ereignis. Die Fernsehbilder waren gespenstisch: Der Diktator, der mit geballter Faust vom Balkon seines Palastes spricht, die demonstrierenden Massen vor ihm zu beschwichtigen und mit neuen Versprechungen zu besänftigen versuchte. Das Volk, das das Gebäude stürmte und ihn zur Flucht im Hubschrauber vom Dach seines eigenen Palastes zwang. Drei Tage später seine Verhaftung, der Schauprozess und seine Hinrichtung durch ein Erschießungskommando, das ihn an eine Ziegelwand an einem geheim gehaltenen Ort irgendwo in Rumänien stellte. Diese Bilder verfolgten mich tagelang in meinen Träumen. Mit acht Jahren verstand ich, dass es in der Politik nicht nur geliebte und geehrte Menschen gab, sondern dass politisches Handeln auch düstere Konsequenzen haben konnte. Den Tod inklusive.
Mein Vater hatte immer ein gespaltenes Verhältnis zu Haider. Zum einen freute er sich über die steigende Bedeutung, die seine Partei, für die er im Laßnitzer Gemeinderat saß, durch die von Haider erzielten Wahlerfolge auf einmal hatte. Vor Haider war die FPÖ eine Kleinstpartei mit gerade einmal vier, fünf oder höchstens acht Prozent gewesen, erst mit Haider an ihrer Spitze begann ihr Siegeszug. Wir saßen an jedem Wahlabend vor dem Fernseher, egal ob gerade Landtagswahl oder Nationalratswahl war, und fieberten dem Ergebnis entgegen. Dass Haider wieder einmal gewinnen würde, war damals schon vor der ersten Hochrechnung dem ganzen Land klar, die Frage lautete stets nur noch, wie hoch.
Andererseits fühlte sich mein Vater immer dem liberalen Lager innerhalb der FPÖ zugetan, das sich von vielen Ideen des nationalen Lagers, dem die Burschenschaften angehörten, distanzierte. Auf einem Bundesparteitag der FPÖ stimmte er seinerzeit daher auch für den liberalen Norbert Steger als Parteiobmann und gegen den Kandidaten des nationalen Lagers. Jenem Norbert Steger, der später von Jörg Haider gestürzt werden sollte. Denn obwohl mein Vater als Bauer aus einer konservativen und ländlich-traditionell geprägten Region stammte, war er ein weltoffener und liberaler Mensch. Als solcher war er ein glühender Anhänger des vereinten Europa, des Euro als gemeinsame Währung und des Beitritts Österreichs zur EU. Haider hingegen schürte zuerst die Ängste der Menschen vor diesen Veränderungen, und benützte sie dann, um zu polarisieren.
Die kalkulierten Skandale, die Haider regelmäßig lieferte, verabscheute mein Vater. Als Haider Österreich als »ideologische Missgeburt« bezeichnete und wochenlang Historiker und Politikwissenschaftler darüber diskutierten, war auch er aufgebracht. »Was ist ihm da wieder eingefallen?«, schimpfte er. »Das geht doch nicht. Das ist eine Beleidigung aller Österreicher. Ich kann das nicht unterstützen.«
Auch als Haider das Thema Zuwanderung entdeckte und 1993 sein Ausländer-Volksbegehren startete, weigerte sich mein Vater, es zu unterstützen und zu unterschreiben. »Das ist menschenverachtend«, sagte er zu mir, und Hetze würde seiner politischen Haltung widersprechen. Zu den grundlegenden christlichen Werten, die ausgesprochen oder unausgesprochen meine gesamte Familie prägten, gehörte auch die Hilfe für Menschen, die Hilfe benötigten. Egal welcher Herkunft.
Ich hingegen sah die Dinge emotionslos. Ich sah in Haider den geschicktesten politischen Taktiker im Land, der mit seinen Gegenspielern meist machte, was er wollte. Bei seinen polarisierenden Äußerungen interessierte mich vor allem, wie weit er gehen konnte. Ich entdeckte die schmale Grenze zwischen Applaus und Ekel bei solchen Äußerungen, und Haider als waghalsigen Grenzgänger zwischen den Fronten. Als Haider etwa im TV-Duell im Zuge der Nationalratswahl 1994 den damaligen sozialdemokratischen Bundeskanzler Franz Vranitzky vor laufenden Kameras mit einem »Taferl« auf dem die Mehrfach-Einkommen eines SPÖ-Multifunktionärs angeführt waren, völlig aus der Fassung und aus dem Konzept brachte, war ich nicht nur fasziniert. Die dahinter steckende Machart solcher Aktionen und ihre Wirkungsweise beschäftigten mich intensiv.
Doch die Kluft zwischen mir und meinem Traumberuf erwies sich, als ich in die Hauptschule in der Bezirkshauptstadt Murau wechselte, noch größer, als es in der Laßnitzer Volksschule den Anschein gehabt hatte. Dort sah es für mich weder nach einer Laufbahn in der Politik, noch in irgendeinem anderen Bereich, der eine höhere Bildungslaufbahn voraussetzte, aus. Denn ich kam mit dem Schulwechsel schwer zurecht. Für einen Bauernjungen wie mich war Murau eine große fremde Stadt mit vielen unbekannten Gesichtern. Alleine in meiner Klasse waren jetzt mehr Schüler als bisher in der ganzen Schule, und insgesamt gab es hier mehrere Hundert. Das machte mir Angst. Ich zog mich in mich selbst zurück und wurde ein extrem schüchterner Junge.
Meine wenigen Freunde aus der Volksschule fanden rasch Anschluss und waren für mich schon bald keine Bezugspersonen mehr. Auch deshalb, weil ich im Unterricht weiterhin nur Mittelmaß war. Außer in Deutsch war ich in allen Fächern in der zweiten von drei Leistungsgruppen, während meine Kindheitsfreunde sich alle in der ersten Gruppe befanden. Dabei musste ich ständig fürchten, in die dritte Leistungsgruppe abzurutschen. Einmal sollte ich im Mathematik-Unterricht an der Tafel ein Beispiel vorrechnen. Ich hatte keine Ahnung und brach in Tränen aus. »Ich will nicht in die dritte Leistungsgruppe, ich will nicht in die dritte Leistungsgruppe«, schluchzte ich. In der dritten Leistungsgruppe wäre ich der einzige Schüler meiner Klasse gewesen, was auch daran lag, dass damals alle guten Schüler in die eine Klasse gesteckt wurden und die schlechten Schüler in die andere. Als Schüler des Mittelmaßes fiel ich diesem selektionsartigen Einteilungsprozess, der nur schwarz oder weiß kannte, zum Opfer. Für die schlechte Klasse war ich zu gut, und für die gute Klasse war ich zu schlecht. Am Ende landete ich in der guten Klasse, war dort aber der Schlechteste unter lauter Einser-Schülern.
Im Sport konnte ich auch nicht mithalten. Bei Völkerball oder Fußball wählten mich die anderen immer als wenn nicht Letzten, als Vorletzten unter großem Seufzen in die Mannschaft. Meiner ohnehin sensiblen Natur tat das gar nicht gut. Ich fühlte mich hilflos, ausgeliefert, allein gelassen und zog mich noch mehr zurück. Ich sprach während der ersten beiden Jahre in der Hauptschule mit fast niemandem meiner Mitschüler ein Wort.
Ab der dritten Klasse verbesserten der Deutsch- und der Geografie-Unterricht mein Selbstbewusstsein zumindest ein wenig. Beide Fächer unterrichtete eine Lehrerin namens Juliane Höfinger, die uns politische Bildung vermitteln und uns für das nationale und internationale politische Geschehen interessieren wollte. Die Erfolge der anderen Schüler in diesem Bereich waren mäßig, aber ich war aufgrund der elterlichen Prägung über alle politischen Entwicklungen genau informiert und sammelte so bei Juliane Höfinger Punkte. »Stefan hat es als Einziger gewusst«, sagte sie, wenn sie mit Verweis auf die darin enthaltenen politischen Fragestellungen unsere Tests zurückgab.
Es waren kleine Lichtblicke in meiner Isolation. Doch selbst bei diesen Gelegenheiten quälte mich das Stottern, das mir mittlerweile als Problem voll bewusst geworden war, und das mich alljährlich für einige Zeit heimsuchte, um dann ebenso leise und unauffällig wieder zu verschwinden, wie es gekommen war. Einmal war die Apartheid in Südafrika Thema. Nelson Mandela kam gerade frei, Frederik Willem de Klerk dankte ab und ein neues Zeitalter begann für das Land. »Wie hieß das abgelöste politische System in Südafrika?«, fragte Höfinger.
Schweigen in der Klasse. Ich wusste es aus den Nachrichten, die bei uns daheim nach wie vor Fixtermine für alle waren. Doch ich zögerte, meine Hand zu heben. Ich wusste wie jeder Stotterer, dass jedes Wort, das mit einem Vokal beginnt, besonders schwierig ist. Sekunden verstrichen. Juliane Höfinger streifte mich mit einem halb fragenden Blick.
Auf die Toleranz meiner Mitschüler in Sachen Stottern konnte ich in der Hauptschule nicht zählen. Besonders Klaus, der beliebteste Junge in unserer Klasse und Klassensprecher, war in dem Punkt gnadenlos. Er stellte mich regelmäßig bloß und hänselte mich dafür, was mein Problem nur noch schlimmer machte. Mir fiel auch keine Möglichkeit ein, das »A« in »Apartheid« durch eine andere Satzkonstruktion zu umgehen.
Ich lasse mich davon nicht unterkriegen, ich kriege das weg und dann werde ich Generalsekretär der FPÖ unter Haider, dachte ich während Höfinger das Wort in den Raum schmetterte, das ich die ganze Zeit im Kopf gehabt hatte.
Daheim sahen wir uns in dieser Zeit einmal eine Übertragung einer Nationalratssitzung an. Mein Vater saß in seinem Couchsessel und ich auf der Ofenbank direkt in seinem Rücken. »Weißt du, was ich mir wünsche?«, sagte er, mitten aus dem Nichts.
Ich erwartete eine der üblichen Belehrungen, dass ich mich mehr anstrengen sollte, damit etwas aus mir wird. Doch er hatte anderes im Sinn. »Ich wünsche mir, dass einmal einer meiner Söhne im Nationalrat sitzt«, sagte er. Er hätte das selbst auch gerne geschafft, aber für ihn hätte es sich nie ergeben. »Das würde mich sehr stolz machen«, sagte er.
Ich schwieg. Ich antwortete nur innerlich: Ja Papa, ich werde einmal dort sitzen. Das verspreche ich dir.
Ich war in diesem Moment sicher, dass jeder Mensch eine Bestimmung im Leben hatte, und dass meine trotz meiner Schulleistungen die Politik war. Diese Gewissheit in mir war so groß, dass ich trotz meiner Isolation und den damit verbundenen Demütigungen alle Probleme und Hürden als Aufforderung sah, härter zu arbeiten, härter zu kämpfen und alles zu unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen.
Ich fing an, dafür zu üben. Vor dem Badezimmerspiegel hielt ich Reden. Ich war vielleicht vor Menschen blockiert, aber das hinderte mich nicht daran, hier an meiner Mimik, Gestik und Rhetorik zu arbeiten. Ich stützte die Hände auf den Rand des Waschbeckens, das mir als Rednerpult diente, und legte los. Es waren keine konkreten politischen Themen, die ich da mit mir selbst besprach, ich übte eher die Stilmittel, Techniken und rhetorischen Kunstgriffe der Politiker. Ich studierte Gesten ein, Stehsätze und einzelne Bauteile. »Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, es ist wichtig, dass wir uns unserer Verantwortung im Bereich der Ausländer- und Sicherheitspolitik stellen. Hier geht es um den Schutz unserer Heimat Österreich!«
Die Fragen der Fernseh-Moderatoren an Politiker merkte ich mir, um damit vor dem Spiegel zu üben. Selbst beim Spielen oder bei Hofarbeiten murmelte ich politischen Argumentationen vor mich hin. Am meisten Inspiration holte ich mir von der FPÖ. Sie zeigte damals im Vergleich zu den anderen Parteien einen anderen, neuen und aggressiven rhetorischen Stil. Ich sah die FPÖ-Politiker Peter Westenthaler und Walter Meischberger Journalisten und politische Gegner regelrecht niederreden. Sie brachten im Fernsehen die Fragesteller meist schon aus dem Konzept, ehe die überhaupt richtig angefangen hatten.
In etwa dieser Zeit organsierte die FPÖ-Bezirkspartei von Murau eine Fahrt nach Wien mit einem Besuch des Parlaments. Mein Vater meldete sich und mich zu dieser Fahrt an. Wien war mir egal, nur das Innenleben dieses Gebäudes mit seinen wuchtigen Säulen und der steinernen Pallas Athene vor dem Eingang interessierten mich. Ehrfürchtig ging ich durch die langen Gänge und versuchte dabei mit allen Sinnen, die Eindrücke zu erfassen und einzuprägen, die sich mir boten. Ich sog die Luft auf, die nach dem alten Gemäuer dieses historischen Gebäudes roch und sah den verstreut vorbei eilenden Mitarbeitern und Abgeordneten, mit ihren Akten und Unterlagen unter dem Arm, hinterher. Als Höhepunkt lauschte ich an der Seite meines Vaters von der Besuchergalerie aus der gerade laufenden Nationalratssitzung im großen Plenarsaal. Ich sah das hölzerne Rednerpult mit den schwarzen Mikrofonknöpfen, um das sich wie in einer Arena die Sitzreihen der Abgeordneten auftürmten. Auf einem dieser Sessel werde ich sitzen, dachte ich. Von diesem Rednerpult aus werde ich sprechen. In diesem Haus werde ich arbeiten. Ich war überwältigt von dieser Flut an Eindrücken und fühlte mich dennoch zuhause und angekommen. Nur widerwillig räumte ich nach Aufforderung einer Saalordnerin meinen Platz auf der Galerie, um für die nächste Besuchergruppe Platz zu machen. Ich komme wieder, als einer von ihnen, sagte ich still in mich hinein, während mein Blick ein letztes Mal über die Reihen der Abgeordneten strich.
Als in der vierten Klasse die Nationalratswahlen 1994 vor der Tür standen, ließ uns Juliane Höfinger die Runde der Spitzenkandidaten im Fernsehen nachstellen. Jeweils ein Schüler sollte eine der Parteien vertreten, und dann würde die Klasse mit Stimmzetteln wählen. Beim Völkerball und beim Fußball wurde ich noch immer als Letzter in die Mannschaften gerufen, aber wenn es um die FPÖ ging, war ich der Erste. Es stand in der Klasse außer Streit, wer die FPÖ in dieser Diskussion vertreten sollte, den von meinem politischen Interesse wussten längst alle. »Das macht der Stefan«, hieß es.
In den nächsten Tagen bereitete ich mich intensiv darauf vor. Ich las Hintergrundinformationen und übte wuchtige Ansagen über die rot-schwarze »Freunderlwirtschaft« und die »Privilegienritter« ein. Bepackt mit Unterlagen ging ich in die Diskussion.
Für die SPÖ trat Klaus an, der auch unser Klassensprecher war. Es war meine Chance, mich für die Jahre der Ausgrenzung zu revanchieren. Mir war klar, dass sich niemand so intensiv auf diese kleine Übung in der Klasse vorbereitet hatte wie ich, dass ich in politischem Wissen allen anderen überlegen war und dass es mir leicht fallen würde, meine Gegner rhetorisch zu besiegen. Nun konnte ich zeigen, was ich die Jahre zuvor heimlich zuhause vor dem Spiegel wieder und wieder geübt und geprobt hatte. Nur eines konnte mich noch stoppen: Das Stottern. Ich wusste aber auch, ich konnte diese Sprachbarriere überwinden, wenn ich nur wollte und die Angst davor überwand.
Mit voller Konzentration legte ich los. Der erste Satz gelang mir perfekt, der zweite ebenfalls. Damit war der Damm gebrochen und die Worte und Sätze sprudelten nur so aus mir heraus. Klaus knickte ein, als ich Argument um Argument und Beispiel um Beispiel brachte. »Mit solchen Mitteln arbeitet ihr! Das ist ein Skandal!«, sagte ich einmal, während ich ein Plakat der Sozialistischen Jugend hochhielt. »Inländer sind faul und stinken«, stand darauf. Es war ein Versuch der Sozialistischen Jugend gewesen, die Diktion der FPÖ zu karikieren, doch im Getöse eines Nationalratswahlkampfes hat solche Ironie keinen Platz und die Sache war für die SJ nach hinten losgegangen. Die FPÖ hatte das Plakat sogar groß in ihrer Parteizeitung abgedruckt. »Das ist also eure Meinung über uns«, sagte ich in Richtung Klaus, »dass wir faul sind und stinken.«
Nach der Auszählung durch unsere »Wahlkommission« war ich klarer Sieger, und Juliane Höfinger wirkte leicht pikiert. Sie dachte anscheinend, sie hätte im Unterricht etwas falsch gemacht, weil alle FPÖ wählten, eine Partei, die für sie offenbar unwählbar war. Niemand meiner Mitschüler gratulierte mir, dem Außenseiter. Mir jedoch reichte das Wissen, endlich einmal gewonnen zu haben. Gegen Klaus. Auch gegen mich selbst. Und für die FPÖ. Es gab ein Gebiet, auf dem ich, nun auch nachweislich, der Beste war.
Als in der Folge die Entscheidung über meine Zukunft nach Beendigung der Schulpflicht anstand, war Juliane Höfinger die Einzige, die mich dann in ein Oberstufenrealgymnasium schicken wollte. Alle anderen Lehrer sahen mich angesichts meiner bis zum Schluss mäßigen Schulerfolge eher in einem Lehrberuf und rieten meinen Eltern von ihrem Vorhaben ab, mich an eine höhere Schule zu schicken. Doch Höfinger hielt dagegen. »Der Stefan schafft das«, sagte sie meinen Eltern. Sie setzte sich durch und ich konnte im musischen Zweig des Gymnasiums mit neuen Mitschülern neu anfangen.
Vielleicht war es mein Sieg in der nur für mich so wichtigen »Elefantenrunde«, der mir das Gefühl gab, nicht nur in meinen Träumen, sondern auch im richtigen Leben für etwas gut sein zu können. Jedenfalls vollzog ich in der neuen Schule einen kompletten Wandel. In kürzester Zeit wurde ich von einem schüchternen Außenseiter zu einem aufgeweckten und besonders kommunikativen Jungen. Ich kompensierte jetzt, was ich vier Jahre lang an Freundschaft und Austausch verpasst hatte.
Ich musste mich zwar mit dem Unterrichtsstoff abmühen, doch jetzt war ich fester Bestandteil einer richtig gut funktionierenden Klassengemeinschaft und entwickelte das Talent, nicht nur meine Mitschüler, sondern auch meine Lehrer mit lausbübischem Charme und einem gewissen ironischen Witz für mich einzunehmen. Mich verblüffte es am Anfang selbst, wie effizient sich diese Instrumente einsetzen ließen. Einmal erklärte ich unserer Englischprofessorin anhand des wenigen, das ich über ein uns zur Lektüre aufgetragenes Theaterstück wusste, dass ich es einfach zu langweilig und die im Stück erzählte Liebesgeschichte viel zu kitschig gefunden hätte, um nach ein paar Seiten weiter zu lesen. »Für so etwas habe ich schlicht keine Zeit. Da mache ich das, was dort steht, doch viel lieber selbst«, sagte ich. Obwohl sie davor alle anderen, die es nicht gelesen hatten, mit einem »Nicht genügend« abgestraft hatte, antwortete sie mir mit einem Lachen. »Du hast recht, Stefan«, sagte sie. »Das Stück ist wirklich mies.« Auf das »Nicht genügend« verzichtete sie.
In dieser Zeit fing ich auch zu rauchen an, denn wer damals zur coolen Avantgarde der Schule gehören wollte, der hatte sich bei den Rauchern im Raucherhof einzufinden. Die Pausen zwischen den Unterrichtsstunden bedeuteten für mich beinahe schon Strapazen, weil ich längst mit der halben Schule bekannt war, und mit jedem Schüler, dessen Wege ich in den Gängen kreuzte, ein paar Worte wechselte. Ich veränderte mich auch äußerlich. Eben war ich noch blass, etwas pummelig und total out gekleidet gewesen, doch jetzt war ich schlank, sonnengebräunt und achtete sorgfältig auf mein optisches Erscheinen.
Am Ende war ich der Klassensprecher und schaffte die Matura locker im ersten Anlauf. Das bestätigte mich neuerlich in meinen jungenhaften Vorstellungen vom Politikerdasein. Der Weg zu meinem Traumberuf, den es bisher nur in meiner Phantasie gegeben hatte, schien sich vor mir aufzutun.