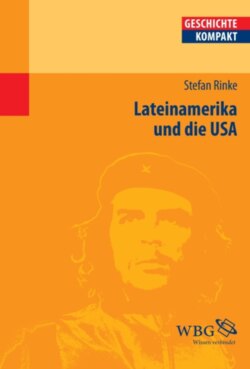Читать книгу Lateinamerika und die USA - Stefan Rinke - Страница 13
2. „Kein Frieden jenseits der Linie“
ОглавлениеAmerika als res nullius
Um die Wende vom 16. und 17. Jahrhundert hatte sich damit ein Gegensatz zwischen Spanien und England verfestigt, der in der Folgezeit prägend bleiben sollte. Dieser Gegensatz basierte letztlich auf der Nichtanerkennung des iberischen Alleinherrschaftsanspruchs durch die englische Krone. Auch in diesem Zusammenhang blieb die Verflechtung mit dem spanischen Vorbild, wenn auch als Antithese, offensichtlich, denn britische und kreolische Autoren betonten, dass es sich in Amerika um eine res nullius handelte, die im Besitz der gesamten Menschheit gewesen sei. Die Legitimität von Herrschaft basierte demnach auf der effektiven Inbesitznahme und Inwertsetzung durch Siedler. Natürlich wollte man damit den spanischen, vom Papst bestätigten Anspruch unterlaufen. Das gelang jedoch bis ins 18. Jahrhundert hinein nur ansatzweise, wie etwa die Auseinandersetzungen in umstrittenen Grenzgebieten wie etwa Britisch-Honduras oder Carolina zeigen sollten. Die Einwohner dieser Gebiete waren eben nicht eindeutig der einen oder dem andern Herrschaft zuzurechnen. Sie blieben in einem Zwischenraum der Staatenlosigkeit. Letztlich blieb die englische Rechtsposition umstritten und musste sich in diskursiver Auseinandersetzung mit den Spaniern immer wieder neu beweisen.
Die Engländer folgten mit ihrem Vorgehen dem Beispiel der Franzosen, deren Aktivitäten schon früh zu heftigen Auseinandersetzungen mit Portugal und Spanien geführt hatten. Im spanisch-französischen Friedensschluss von Cateau-Cambrésis (1559) soll daher in einer mündlichen Übereinkunft festgelegt worden sein, dass der Friede jenseits des ersten Meridians im Westen keine Gültigkeit habe. Die Engländer folgten diesem Prinzip, das angeblich Francis Drake auf die griffige Formel „no peace beyond the line“, „kein Frieden jenseits der Linie“, brachte, einer Linie, die später als Freundschaftslinie bekannt werden sollte. Wenn auch nicht de iure, so stellte die Neue Welt damit doch de facto einen eigenen rechtlosen Raum dar, in dem weitergekämpft, geplündert und gekapert wurde, auch wenn in Europa noch oder längst wieder Frieden herrschte.
E
Freundschaftslinie
Den euphemistischen Begriff „Freundschaftslinie“ verwendete Kardinal Richelieu 1634. Der Begriff bezeichnete gedachte Linien auf den Weltmeeren, jenseits derer die zwischen den europäischen Mächten geschlossenen Friedensverträge außer Kraft waren. Dort verübte kriegerische Handlungen wie Raub oder Freibeuterei sollten keine Rückwirkung auf den Frieden in Europa haben. Seit der ersten Erwähnung einer solchen Demarkationslinie in einer mündlichen Absprache zwischen Frankreich und Spanien zum Frieden von Cateau-Cambrésis (1559) wurden die Freundschaftslinien immer wieder verschoben.
Unter Rechsthistorikern wurde lange darüber debattiert, ob es sich nach dem damals geltenden Völkerrecht bei Amerika um einen rechtlosen Raum gehandelt habe oder ob der Begriff „kein Frieden jenseits der Linie“ nicht vielmehr nur auf die tatsächliche Friedlosigkeit in der Region hinwies.
Karibik
In den Kerngebieten der iberischen Herrschaft hatten sich die Engländer im 16. Jahrhundert noch nicht festsetzen können. Die Spanier, die die englische Expansion im Norden als Bedrohung erkannten, waren bemüht, diesen Zustand zu wahren. Schon 1565 gründeten sie mit dem Fort San Agustín in Florida ein Bollwerk und bauten ihre Positionen im heutigen Südwesten der USA schrittweise aus. Die besonders schwierige Verteidigungssituation in der Karibik stellte sie jedoch vor kaum lösbare Probleme. Die Inseln der Großen Antillen, Kuba, Hispaniola, Jamaika und Puerto Rico, erlebten seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts einen relativen Abstieg, da das Festland viele Siedler lockte. Allerdings blieben diese Inseln noch unumstritten im spanischen Besitz und Häfen wie San Juan und Havanna erfüllten wichtige Verteidigungsfunktionen. Die Inseln der Kleinen Antillen waren dagegen von den Spaniern gar nicht erst besetzt worden, weil dazu die militärischen Mittel fehlten. Hier setzten sich die europäischen Rivalen relativ problemlos fest.
Die Engländer errichteten schon in den 1620er-Jahren auf Barbados und Barbuda sowie wenig später auf Antigua und Montserrat Stützpunkte. Der Besitz dieser kleinen Inseln blieb heftig umstritten und oft wechselten sie die Besitzer. Lukrativ waren die Aktivitäten dennoch, denn vor allem der Schmuggelhandel blühte. Die Siedler, die unter dem spanischen Handelsmonopol Mangel litten, trieben gerne Geschäfte mit den Schmugglern. Häufig duldeten die Kolonialbeamten diese Machenschaften. Hinzu kam, dass die englischen Interessen in das lukrative Geschäft mit dem Zucker einstiegen und von afrikanischen Sklaven bearbeitete Plantagen auf ihren Karibikinseln aufbauten. Aus spanischer Sicht noch bedrohlicher waren die Vorstöße der Engländer auf dem mittelamerikanischen Festland, unter anderem im holzreichen Britisch Honduras, dem heutigen Belize, sowie an der Moskitoküste des heutigen Nicaragua.
Lordprotektor Oliver Cromwell (1599 – 1658) forderte Spanien dann erneut offiziell heraus. Angespornt von dem abtrünnigen Dominikaner Thomas Gage (ca. 1590 – 1656), der als einer der ganz wenigen Ausländer die Kolonien aus eigener Anschauung kannte, ließ Cromwell 1654 die spanischen Besitzungen mit einer großen Flotte angreifen. Der groß angelegte Eroberungsplan mit dem Namen „Western Design“ scheiterte fast auf ganzer Linie. Immerhin gelang mit der Eroberung Jamaikas (1655), das zum Zentrum der englischen Aktivitäten in der Karibik werden sollte, ein verglichen mit den ursprünglichen Zielen sehr bescheidener Erfolg. In der Folgezeit kooperierten die Engländer mit Piraten aller Herren Länder, die 1660 Port Royal auf Jamaika als Hauptstadt für ihre Raubzüge gegen die spanischen Küstenstädte wählten. Besonders spektakulär war der Überfall auf Panama 1671 durch eine Flotte unter Henry Morgan (ca. 1635 – 1688), der sogar offiziell zum Gouverneur von Jamaika (1674 – 82) aufstieg. Die Seeräuber genossen dort praktisch den Schutz der Engländer, bis 1692 ein Seebeben Port Royal zerstörte.
Methuen-Vertrag
Mit dem Spanischen Erbfolgekrieg (1701 – 1713) wendete sich das Blatt. Nicht mehr der englisch-spanische Gegensatz, sondern der zwischen England und Frankreich bestimmte fortan das Geschehen. England schloss sich 1701 der großen Haager Allianz an, um die Thronfolge eines französischen Bourbonen in Spanien zu verhindern. Auch Portugal gehörte ab 1703 zur Allianz und stellte sich damit offen an die Seite Englands, was durch einen Handelsvertrag, den so genannten Methuen-Vertrag (1703) noch unterstrichen wurde. Durch das Abkommen erhielten portugiesische Weine in England eine zollmäßige Vorzugsbehandlung, während Portugal umgekehrt den englischen Stoffen Präferenzen im eigenen Land und in Brasilien einräumte. Dieser Vertrag richtete Portugal einseitig auf die englische Wirtschaft aus und sollte auf lange Zeit die enge Beziehung, ja die Unterordnung der portugiesischen Außenpolitik gegenüber England begründen. Der Vertrag öffnete auch den brasilianischen Markt für die Engländer, die ihn schnell mit ihren Waren überschwemmten. Eine eigenständige Textilindustrie konnte sich vor diesem Hintergrund weder in Portugal noch in Brasilien entwickeln. Stattdessen floss das gerade entdeckte brasilianische Gold nun in großen Strömen nach England.
In Amerika fand der Krieg als Seekrieg statt, bei dem die Engländer bei weitem überlegen waren. 1703 griffen sie Kuba und die Inseln der Kleinen Antillen erfolgreich an, 1707 suchten sie die Städte der südamerikanischen Nordküste und erneut Kuba heim. Die Folge war die weitgehende Vernichtung der Überseeflotte Frankreichs und die Schwächung der Verteidigungsfähigkeit der Spanier in den Kolonien. Im Frieden von Utrecht (1713) ging das Monopol des Sklavenhandels für 30 Jahre an England. Gleichzeitig erhielt es das Sonderrecht des direkten Handels mit Amerika. Wenn dies auch formell auf nur ein Schiff pro Jahr beschränkt war, öffnete die Regelung dem Schmuggel noch weiter Tür und Tor. Vom Stapelplatz Jamaika aus fuhren die englischen Handelsschiffe nun mehr oder weniger regelmäßig die hispanoamerikanischen Häfen an, wo ihre Waren dankbar angenommen wurden. Spanien fehlten nun schlicht die Machtmittel, um daran etwas zu ändern. Schrittweise gab man die Universalansprüche auf und duldete die Existenz der englischen Besitzungen in Amerika. Gemeinsam einigten sich die europäischen Rivalen auf die Einstellung der Freibeuterei und begannen, die Seeräuber massiv zu verfolgen.
Dauerhaften Frieden brachte das 18. Jahrhundert jedoch nicht. Im Gegenteil, die Zusammenstöße zwischen englischen Schmugglern und spanischen Küstenwachen nahmen mit der Zeit zu. Durch die harte Haltung Spaniens, das die fremden Seefahrer in amerikanischen Gewässern als Piraten behandelte, gewannen die Kämpfe oft eine zusätzliche Schärfe. Gleichzeitig drängten die Koloniallobby in England und die Handelsinteressen in den nordamerikanischen Kolonien auf ein aggressiveres Vorgehen in der Karibik. Im so genannten Krieg von Jenkins’ Ohr (1739 – 1748), der als österreichischer Erbfolgekrieg in Europa ausgetragen wurde, zeigte sich erneut, dass Spanien über eine Statistenrolle in der internationalen Politik kaum mehr hinauskam.