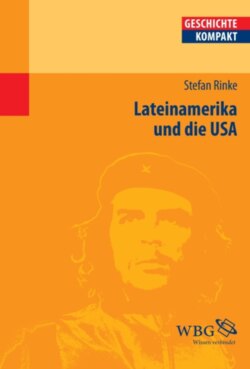Читать книгу Lateinamerika und die USA - Stefan Rinke - Страница 18
3. Die lateinamerikanischen Unabhängigkeitsrevolutionen
ОглавлениеSklavenrevolution Haitis
In der Tat bildeten die revolutionären Ereignisse in Europa, die 1789 in Frankreich begannen, den Auslöser für die Unabhängigkeitsbewegungen im Süden der Amerikas. Den Anfang machte die französische Karibikkolonie St. Domingue, wo sich ab 1791 die einzige erfolgreiche Sklavenrevolution der Weltgeschichte abspielte, die 1804 in die Gründung des unabhängigen Haitis mündete. Der Zusammenbruch Spaniens und Portugals angesichts der napoleonischen Expansion verursachte wenige Jahre später die hispanoamerikanischen Unabhängigkeitsbewegungen und als Spätfolge auch die Loslösung Brasiliens aus dem portugiesischen Reichsverband. Die Prozesse unterschieden sich nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der drei Großregionen erheblich voneinander. Ein Faktor spielte aber bei allen drei Entwicklungen zur Unabhängigkeit eine wichtige Rolle. Dabei handelte es sich um die Einbindung in den atlantischen Kontext. In erster Linie hieß dies natürlich die Beziehungen zu den europäischen Mutterländern. Allerdings gewannen auch die USA mit der Zeit an Relevanz.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren die Vereinigten Staaten noch kaum in der Lage, eine selbstbewusste und eigenständige Politik gegenüber den Unabhängigkeitsbewegungen im Süden zu betreiben. Allerdings zeigte sich ein prägendes Element schon früh: die Abneigung gegen sozialrevolutionäre Bewegungen. Das galt insbesondere, wenn sie ein ethnisches Element in sich trugen und damit die Angst vor Befreiungsbewegungen heraufbeschworen, die auch auf die eigene afroamerikanische Bevölkerung übergreifen konnten. Das wurde bei der haitianischen Revolution deutlich. Unterhielt Präsident John Adams zumindest noch Handelskontakte mit den haitianischen Revolutionären, so lehnte sein Nachfolger Jefferson, selbst Sklavenhalter, diese unmissverständlich ab. Jefferson fürchtete einen negativen Einfluss auf die Vereinigten Staaten. Haiti war seines Erachtens unwürdig, ein unabhängiger Staat zu werden. Die Eruption der Gewalt dort und das Ergebnis einer unabhängigen schwarzen Republik gaben Anlass zur Sorge um die zukünftigen Entwicklungen in Lateinamerika, eine Sorge die die kreolischen Eliten dort durchaus teilten.
westliche Hemisphäre
Jefferson war jedoch auch ein Vertreter der Vorstellung von einer eigenen räumlichen Sphäre, die die Neue Welt umfasste. Die Idee einer solchen westlichen Hemisphäre schimmerte schon bei Washingtons Abschiedsrede von 1796 durch, wenn er betonte, dass man sich aus den europäischen Verwicklungen besser heraushalte. Jefferson sollte diesen Gedanken weiter ausformulieren und einen amerikanischen Raum der Freiheit proklamieren, der sich von den „Leidenschaften und Kriegen“ Europas positiv abhob.
Als dann ab 1809 / 10 die zunächst erfolgreiche Bildung von Regierungsjuntas den Beginn der lateinamerikanischen Unabhängigkeitsbewegungen anzeigte, musste man auch in Washington früher oder später dazu Stellung beziehen. Allerdings zogen weder die Junta-Bildungen noch die ersten meist noch vorsichtig formulierten Unabhängigkeitserklärungen eine klare Aussage der US-amerikanischen Außenpolitik nach sich. Dazu war die internationale Lage aus Sicht der Vereinigten Staaten zu problematisch, bestanden doch seit Längerem Spannungen mit England wegen der Blockadepolitik gegen Frankreich. Außerdem wollte Washington nicht die Sympathien der Spanier – und damit letztlich auch der Franzosen, die die iberische Halbinsel zu diesem Zeitpunkt bereits besetzt hielten – riskieren, denn man hoffte auf deren Nachgeben in den Verhandlungen um den Besitz Floridas.
Daher waren die Vereinigten Staaten zunächst nur zur moralischen Unterstützung für den Süden bereit. So gründete der US-Kongress 1811 das Committee on the Spanish American Colonies. Präsident James Madison erlaubte den Waffenhandel und entsandte private Handelsvertreter nach Lateinamerika. Im Mittelpunkt der US-Außenpolitik stand jedoch die Nutzung der internationalen Verwicklungen für den eigenen Vorteil. So begünstigte die napoleonische Besetzung Spaniens den US-amerikanischen Zugriff auf Westflorida, wo sich eine sehr heterogene Bevölkerung aus Banditen, Deserteuren, entlaufenen Sklaven und Einwanderern unter der nominellen Herrschaft Spaniens herausgebildet hatte. Diese rebellierte 1810 und erklärte sich für unabhängig. Wenige Wochen später annektierten die Vereinigten Staaten das Territorium. Damit war ein Modell geschaffen, das nordamerikanische Desperados weiter westlich Jahrzehnte später nachahmen konnten.
Zwar protestierten die Engländer im Namen des freien Spaniens, das sich gegen Napoleon erhoben hatte, gegen die Annexion, doch wiesen die USA den Protest zurück. Im US-Kongress einigte man sich auf die so genannte No Transfer-Doktrin, die im Januar 1811 als Gesetz verabschiedet wurde. Danach sollte es in Zukunft für die USA ein Anlass zur ernsten Sorge sein, falls ein benachbartes Kolonialgebiet in Amerika von einer europäischen Macht an eine andere weitergegeben werden sollte. Ein Beispiel dafür war die Abtretung des Louisiana-Territoriums von Spanien an Frankreich. Diese Doktrin hatte in außenpolitischer Hinsicht zunächst keinerlei Konsequenzen, ja sie wurde sogar noch bis 1818 geheim gehalten. Dennoch legte man damit ein sehr wichtiges Prinzip fest, das die interamerikanischen Beziehungen in der Folgezeit prägen sollte.
Mit Blick auf die Entwicklungen in Lateinamerika blieb man dagegen zurückhaltend. Durch den Krieg von 1812 – 1814 gegen England hatten die Vereinigten Staaten keinen Spielraum. Dieser Krieg führte trotz einiger militärischer Misserfolge zu nationalistischer Begeisterung und vertiefte die Vorstellung einer besonderen Mission der westlichen Hemisphäre. Außerdem kamen schon in diesem Zusammenhang expansionistische Forderungen innerhalb der USA auf, die sich vor allem auf Florida und Texas richteten. Dass es sich dabei um Gebiete, handelte, die noch zum spanischen Kolonialreich gehörten, tat im Überschwang der Begeisterung nichts zur Sache.
Für derart raumgreifende Pläne war die Zeit allerdings noch nicht reif. Als Spanien nach der Niederlage Napoleons und der Rückkehr Ferdinands VII. auf den Thron 1814 wieder mit Waffengewalt in die Geschehnisse in Lateinamerika eingriff und große Gebiete zurückeroberte, verhielten sich die USA weiter neutral. Präsident Madisons Neutralitätserklärung war mit einer Warnung an US-amerikanische Bürger verbunden, sich nicht in die Auseinandersetzungen einzumischen. Erneut standen dabei eigene territoriale Ziele im Hintergrund, denn man wollte Spanien zum Verkauf von Ostflorida – das Gebiet des heutigen Bundesstaats Florida – überreden. Dafür waren gute Beziehungen zur spanischen Krone Voraussetzung. Diesem Ziel wurden andere Aspekte wie die Solidarität mit den um ihre Existenz kämpfenden Republiken des Südens untergeordnet.
Verdrängung Spaniens
1819 ging das Kalkül tatsächlich auf. Im nach den Unterhändlern Adams-Onís-Vertrag bezeichneten Übereinkommen von 1819 ging Florida endgültig in den Besitz der USA über. Dieser Vertrag brachte auch eine Grenzziehung im Westen, wonach die USA auf Texas und gleichzeitig Spanien auf Nordwestamerika – das so genannte Oregon-Territorium – verzichteten. Damit war die seit dem Louisiana-Kauf offene Frage des Grenzverlaufs im Westen fürs Erste geklärt. Außerdem war für die Vereinigten Staaten der Weg frei bis zur Pazifikküste. Der Vertrag wurde zu einer entscheidenden Grundlage für die US-amerikanische Westexpansion. Die USA schufen sich damit eine hervorragende Ausgangsbasis für die Verdrängung des spanischen Reichs und seiner Nachfolgestaaten aus dem nordamerikanischen Raum.
Derweil setzten sich die Unabhängigkeitsbewegungen in Lateinamerika auch ohne US-amerikanische Unterstützung durch. Unter der Führung Simón Bolívars (1783 – 1830) im nördlichen Andenraum und José de San Martíns (1778 – 1850) im La Plata-Gebiet vertrieben die Heere der Aufständischen in langjährigen blutigen Kämpfen bis 1826 die Spanier, während sich Neu-Spanien 1821 durch eine eher unblutige konservative Revolution vom Mutterland löste. Ähnliches galt für Brasilien, das seit 1822 ein unabhängiges Kaiserreich bildete.
Noch vor Ende der Kriegshandlungen bemühten sich die bereits befreiten Regionen in Südamerika um diplomatische Anerkennung. Doch der vermeintlich natürliche Bundesgenosse, die Vereinigten Staaten, verhielt sich in dieser Frage sehr zurückhaltend. Erst als mit der Ratifizierung des Adams-Onís-Vertrags in Spanien 1821 das eigentliche Ziel erreicht war, zeigte sich Washington auch unter dem Eindruck der militärischen Erfolge der Lateinamerikaner verhandlungsbereit. Dabei ging es ihnen weniger um hehre republikanische Werte, sondern letztlich um die Schaffung einer guten Ausgangsposition für den Wettbewerb mit Großbritannien um den zukünftigen Einfluss in der Region. 1822 brachen die USA dann mit der Anerkennung Groß-Kolumbiens tatsächlich das Eis. Noch im selben Jahr folgte die Anerkennung Mexikos, Chiles, der Vereinten Provinzen des Río de la Plata und Brasiliens. Außerdem schickte man nun die ersten offiziellen Gesandten nach Lateinamerika.
keine Interessengemeinschaft
Letztlich waren nicht die USA, sondern England der entscheidende Verbündete der Lateinamerikaner in ihrem Kampf um Unabhängigkeit, denn von dort kamen Waffen, Söldner und diplomatische Unterstützung. Dies hinderte aber die US-amerikanischen Politiker nicht daran, die Vereinigten Staaten schon früh als quasi natürlichen Anführer der Amerikas zu sehen. In der Beurteilung der Fähigkeiten der neuen lateinamerikanischen Schwesterrepubliken waren die US-amerikanischen Eliten sehr zurückhaltend. Insbesondere Präsident Monroes Außenminister, der spätere Präsident John Quincy Adams machte mehr als einmal klar, dass es keine Interessengemeinschaft zwischen Nord- und Südamerika geben könne. Damit verband sich eine unverhohlene Geringschätzung der kreolischen Führungsschichten des Südens, die nicht die Freiheiten eines Engländers genossen hätten und noch dazu durch den Katholizismus in ihrem Denken gehemmt seien. Die seit Langem bestehenden Vorurteile gegen das spanische Erbe wurden bedenkenlos auf Lateinamerika übertragen.
Q
Thomas Jefferson an Alexander von Humboldt (Monticello, 14. 4. 1811)
Aus: Thomas Jefferson: Writings, Cambridge 1984, S. 1247 – 1248.
[Die lateinamerikanischen Staaten] werden jetzt zum Schauplatz politischer Revolutionen, um ihren Platz als integrale Mitglieder der großen Familie der Nationen einzunehmen. … Welche Regierungsform werden sie errichten? Wie viel Freiheit können sie vertragen ohne Trunkenheit? … Ich glaube, sie werden das Muster unserer Konföderation und gewählten Regierung kopieren, die Rangunterschiede abschaffen, ihre Nacken vor ihren Priestern beugen und in der Intoleranz verharren. Ihr größtes Problem wird die Schaffung ihrer Exekutive sein. Ich befürchte, dass sie ungeachtet der Experimente Frankreichs und der Vereinigten Staaten von 1784 mit einem Direktorium beginnen werden und dass, wenn die unvermeidbaren Schismen in dieser Art von Exekutive sie zu etwas anderem treiben, ihre große Frage sein wird, ob man eine auf Jahre zu wählende, eine auf Lebenszeit bestimmte oder gar eine erbliche Exekutive einsetzt. Aber wenn nicht Bildung unter ihnen schneller verbreitet werden kann, als die Erfahrung verspricht, könnte der Despotismus über sie kommen, bevor sie die erforderliche Befähigung besitzen, um das bereits Erreichte abzusichern.
Formulierte Jefferson seine Skepsis Lateinamerika gegenüber noch einigermaßen zurückhaltend, so sollten die Urteile in der Folgezeit härter ausfallen. Oft fielen Begriffe wie unzivilisiert, knechtisch, von der katholischen Religion verdummt etc. Grundlegend war die Erkenntnis, dass die Lateinamerikaner trotz der gemeinsamen Erfahrungen des Kriegs gegen das Mutterland und der republikanischen Staatsbildungsprozesse anders waren. Lateinamerika war das Fremde, von dem man sich besser fernhielt, um nicht selbst von den Untugenden und Schwächen, die man dort vermutete, angesteckt zu werden.
Unterschiede
Die Erkenntnis von den Unterschieden hatten allerdings nicht nur US-Amerikaner, sondern auch führende Lateinamerikaner gewonnen. Dass das auch Konsequenzen bei der Schaffung politischer Institutionen hatte, zeigte sich vor allem bei Simón Bolívar. In seiner Eröffnungsrede an den Kongress von Angostura im Februar 1819, als der Unabhängigkeitskrieg noch in vollem Gange war, präzisierte Bolívar seine Verfassungsvorstellungen in Abgrenzung von dem, was er als das zwar „vortreffliche“, aber für Lateinamerika wenig praktikable angloamerikanische Modell ansah. Vor dem Hintergrund der Wahrnehmung einer absoluten Alterität des Nordens konstruierte er ein Verfassungsmodell, das in der Abkehr vom Föderalismus und in der Stärkung der Exekutive ein Gegenprojekt dazu sein sollte.
Q
Simón Bolívar: Rede vor dem Kongress von Angostura (15. 2. 1819)
Aus: Simón Bolívar: Reden und Schriften Hamburg 1984, S. 50 – 51.
Ich muss sagen, dass mir nicht im entferntesten der Gedanke gekommen ist, Lage und Wesen von zwei so unterschiedlichen Staaten wie dem englisch-amerikanischen und dem spanisch-amerikanischen gleichzustellen. Wäre es nicht sehr schwer, auf Spanien den Kodex der politischen, bürgerlichen und religiösen Freiheit Englands anzuwenden? Nun, noch schwerer ist es, die Gesetze Nordamerikas auf Venezuela zu übertragen. Sagt nicht der Geist der Gesetze, dass diese für das Volk geeignet sein müssen, welches sie sich schafft …? Das ist der Kodex, den wir um Rat fragen müssen, und nicht der von Washington!