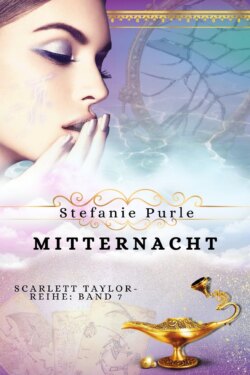Читать книгу Scarlett Taylor - Mitternacht - Stefanie Purle - Страница 7
Kapitel 5
ОглавлениеNach rund zwei Stunden haben wir endlich das Küstengebiet erreicht. Ich dirigiere Chris anhand einer auf meinem Handy aufgerufenen Karte durch das kleine Dorf, vorbei an zahlreichen Fischrestaurants und Backsteinhäuser, deren kleine Fenster so tief liegen, dass die Fensterbänke beinahe mit dem Fußgängerweg auf der gleichen Höhe sind.
„Irgendwie urig hier“, stellt Naomi fest und blickt mit einem Lächeln hinaus. „Ich kann verstehen, dass Elvira und Ella hier wohnen wollten. Es ist wirklich bezaubernd!“
Kitty ist wenig beeindruckt. „Bezaubernd? Die Straßen sind viel zu eng, und dieses holprige Kopfsteinpflaster ist so mittelalterlich! Außerdem stinkt es nach Fisch!“
Chris gibt ein kehliges Kichern von sich und biegt links in eine Straße ein, die auf der rechten Seite von einem grasbewachsenen Deich begrenzt wird. „Was du riechst ist kein Fisch, sondern die frische Seeluft“, korrigiert er sie.
„Was auch immer“, winkt Kitty ab und verzieht angewidert das Gesicht.
„Auf dieser Straße muss es sein“, sage ich und betrachte jedes einzelne der sich aneinanderreihenden Häuser auf der linken Seite. „Hausnummer sechsundzwanzig.“
Es ist kurz nach Mittag, die Sonne steht an ihrem höchsten Punkt und wirft kaum einen Schatten, doch ich sehe trotzdem welche. Manchmal sind sie in den Fenstern der kleinen Häuser zu sehen, oder sie lauern hinter Hecken. Ein länglicher Schatten gleitet wie ein Aal über den Fußgängerweg und verschwindet dann im Gulli. Sie sind überall und ich frage mich, ob sie schon immer da waren und ich sie nur nicht gesehen habe, oder ob sie erst jetzt aufgetaucht sind. Doch niemand sonst scheint sie zu bemerken und deswegen ignoriere ich sie auch. Vielleicht habe ich auch einfach nur ein Problem mit den Augen, immerhin war ich vor Kurzem noch tot!
„Da ist es, Nummer sechsundzwanzig“, ruft Naomi aus und zeigt nach vorne auf ein rotes Backsteinhaus mit kleiner, blauweißer Windmühle im Vorgarten.
Chris blinkt und biegt auf die schmale, lange Einfahrt ein. Noch ehe wir alle dem Bulli entstiegen sind, öffnet sich die Haustür und Elvira kommt heraus.
„Kinder, ihr hättet doch nicht alle herkommen brauchen!“, ruft sie und ihre rot geränderten Augen füllen sich mit Tränen. Sie breitet die Arme aus und läuft zuerst auf mich zu, um mich fest an sich zu drücken. Ihr Schluchzen wird stärker und ihre Tränen durchnässen den Stoff auf meiner Schulter.
Ich tätschle ihren Rücken und versuche sie zu beruhigen. „Es wird alles wieder gut, Elvira. Glaube mir“, sage ich.
Sie hebt den Kopf und sieht mich ein wenig verwirrt und fragend an, doch dann kommt Naomi und zieht sie in ihre Arme, gefolgt von Kitty. Zum Schluss ist Chris dran, der sie nach der Umarmung am Unterarm stützend zurück ins Haus begleitet. Mit Schrecken sehe ich, wie meine Tante nach dem Verlust ihrer Schwester scheinbar über Nacht um zwanzig Jahre gealtert ist. Ihrer Haltung fehlt jegliche Spannung, die Schultern sind vornübergebeugt, ihr Gang ist zittrig und ihr gräulicher Bob mit den weißen Strähnen wirkt nun nicht mehr schick und edel, sondern nur noch alt.
Kitty stößt mir mit dem Ellenbogen in die Seite und sieht mich kopfschüttelnd und mahnend an.
„Was?“, frage ich, obwohl mir bereits klar ist, dass sie meine Gedanken ein weiteres Mal gelesen hat.
„Sie steht unter Schock, Scarlett! Da ist es doch wohl egal, wie sie aussieht!“, zischt sie und folgt Chris und Elvira hinein ins Haus.
Ich habe keine Kraft um meine gedachten Gedanken zu verteidigen oder wieder darüber zu diskutieren, warum es falsch von ihr ist, anderleuts Gedanken überhaupt zu lesen. Deshalb seufze ich nur und warte auf Naomi, die ihren Rucksack aus dem hinteren Teil des Bullis holt, um mit ihr gemeinsam den anderen ins Innere des Hauses zu folgen.
Ich schließe die alte, leicht verzogene Haustür hinter uns und laufe Naomi einen langen, dunklen, schmalen Flur hinterher, der in ein geräumiges Wohnzimmer führt. Hellgrüner Teppich bedeckt den Boden, beige Polstermöbel mit braunem Blumenmuster stehen an der einen Wand, eine drei Meter lange Fensterbank mit rund zwanzig Orchideen darauf nimmt die andere Wand ein. Das Fenster ist mit weißem Organza verhangen, doch dahinter sehe ich schemenhaft mehrere Leute hin und hergehen.
Naomi zieht die Gardine zur Seite und schaut auf die Terrasse hinaus. „Jo und Berny sind ja auch hier!“, ruft sie freudig aus, lässt die Gardine wieder fallen und steuert auf die offenstehende Tür zu, die in die Küche führt.
Ich gehe ihr hinterher und zusammen entdecken wir eine Glastür, die von der Küche auf eine kleine überdachte Terrasse hinausführt. Jo und Berny sitzen nebeneinander auf einer Bank und geben jedem die Hand. Vor ihnen stehen jeweils Gläser mit Eistee und leere Kuchenteller.
„Seid ihr schon lange hier?“, frage ich ein wenig verwirrt, nachdem auch ich die beiden begrüßt habe.
„Wir sind sofort losgefahren, als Elvira uns angerufen hat“, antwortet Berny, nippt an seinem Eistee und lehnt sich zurück.
„Vielleicht eine Stunde“, ergänzt Jo und tauscht einen Blick mit Elvira aus.
„Ja, ungefähr. Ich habe sie angerufen, nachdem ich dich angerufen habe. Eigentlich hatte ich gar nicht damit gerechnet, dass du überhaupt abnimmst, aber…“, stammelt sie und ihr Schluchzen wird bei jedem Wort heftiger.
Ich lege den Arm um ihre dünnen Schultern und beuge mich zu ihr hinab. „Hast du gedacht wir wären tot?“, hake ich leise flüsternd nach und sie nickt.
„Ein Missverständnis“, geht Berny dazwischen. „Ein makabres Missverständnis.“
Ich begegne seinem Blick. Er schüttelt unmerklich mit dem Kopf und gibt mir zu verstehen, dass ich die Wahrheit über unseren Tod jetzt besser für mich behalte. „Ja, ein Missverständnis“, sage ich nun ebenfalls.
Chris, der aus einem kleinen Holzschuppen auf dem Grundstück noch weitere Gartenstühle geholt hat, schiebt mir einen rüber und ich nehme neben Elvira Platz. Immer wieder schnäuzt sie in ein bereits nasses Stofftaschentuch und zittert dabei am ganzen Körper. Naomi setzt sich auf ihre andere Seite und zieht Elviras Hand in ihre.
„Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid“, schnieft meine Tante und blickt von einem zum anderen. „Wo ist Kitty?“
Ich blicke mich ebenfalls um, doch draußen ist sie nicht. „Ich schaue mal nach, wo sie sein könnte. Dann bringe ich auch noch ein paar Gläser für den Eistee mit, okay?“
Elvira nickt. „Im Schrank neben dem Kühlschrank sind die Gläser. Und auf dem Herd steht noch Zitronenkuchen. Teller findest du ebenfalls da, wo die Gläser sind.“
Es fühlt sich seltsam an, dass meine Tante mir erklären muss, wo ihre Gläser und Teller stehen. Ich ging bei ihr ein und aus, wusste manchmal besser wo ihre Sachen verstaut sind, als sie selbst. Doch jetzt bin ich eine Fremde in ihren vier Wänden, und wäre Mama nicht verschwunden, wären sicherlich noch Wochen vergangen, bis ich ihr neues Zuhause zum ersten Mal gesehen hätte.
Ich gehe wieder hinein, durch die kleine Küche zurück ins Wohnzimmer und in den Flur. „Kitty?“, rufe ich alle paar Meter, bekomme jedoch keine Antwort. Vom Flur geht eine Tür ab, die in ein Gästebad führt. Ich zucke zusammen, als ich einen schwarzen Schatten dabei erwische, wie er sich im Inneren des Waschbeckens windet und dann durch den Abfluss verschwindet. Schnell ziehe ich die Tür wieder zu und gehe die mit Teppich ausgelegten Stufen nach oben. Das Geländer fühlt sich speckig und splitterig an, meine Schritte sind nur dumpf auf dem eingetretenen Fußbodenbelag zu hören. Oben angekommen habe ich die Wahl zwischen zwei Zimmertüren. Ich öffne die erste davon und entdecke ein Schlafzimmer. Das Bett in der Mitte des Raumes ist ordentlich gemacht und anhand des Sommerkleides, das auf einem Bügel an der Schranktür hängt, erkenne ich, dass es Elviras Schlafzimmer ist. Ich schließe die Tür wieder und mache mich darauf gefasst, im nächsten Zimmer das Schlafzimmer meiner Mutter zu sehen.
„Kitty? Bist du hier oben?“, rufe ich, bevor ich die Tür öffne.
Ich erhalte keine Antwort, doch ich sehe sie zwischen dem Bett meiner Mutter und dem geöffneten Fenster stehen. Wind bläst ins Zimmer, als ich in der offenen Tür stehenbleibe und sie betrachte. Ihr weißes Haar weht nach hinten, der Rock ihres elfenbeinfarbenen Kleides ebenfalls. Sie hat die Augen geschlossen, die Handflächen nach oben gerichtet, und lauscht auf das Echo meiner Mutter. Ich bleibe ganz still, versuche meine Gedanken ruhig zu halten, um ihr die Ruhe zu geben, die sie braucht.
Nach wenigen Minuten öffnet sie die Augen und lässt die Hände sinken. „Nichts!“
„Wie meinst du das? Nichts?“
„Nothing! Nada! Niente! Hier ist nichts, rein gar nichts!“, sagt sie und lässt sich enttäuscht auf das gemachte Bett mit der Rosenbettwäsche plumpsen. „Kein Nachhall, keine Spur, kein Hauch ihrer Seele. Nichts!“
Ich setze mich neben sie und schaue aus dem Fenster hinaus, welches über die Siedlung blickt. Möwen kreischen und das Gelächter von Kindern dringt von draußen zu uns hinauf. „Kitty, was wäre, wenn die Frau, die du als Ella kennst, gar nicht meine Mutter war? Was, wenn sie nur ein Double war? Dann würdest du doch keinen Nachhall ihrer Seele spüren, weil sie gar keine Seele hatte, oder?“
Kitty dreht ihren Kopf langsam in meine Richtung und sieht mich aus großen Augen an. „Ein Double? Wie meinst du das? Ein magisches Double?“
Ich nicke und starre weiter hinaus auf die vorbeiziehenden Wolken. „Genau. Ein mit Magie erschaffenes, seelenloses Double. Könntest du das auch mit deinen medialen Sinnen erspüren?“
Sie lässt sich Zeit mit ihrer Antwort, doch ich lasse sie keine meiner Gedanken lesen, sondern konzentriere mich ganz auf die Wolkenfetzen am Himmel.
„Soweit ich weiß, hat alles was lebt eine Seele. Aber ich habe auch schon Gegenstände aufspüren können, und die haben ja bekanntlich keine Seele.“
„Ich glaube nämlich, dass die Frau mit der Elvira hierhergezogen ist, gar nicht meine Mutter war. Sie war ein Double, eine seelenlose, fleischliche Kopie meiner echten Mutter. Und dass du hier nichts von ihrer Seele spürst, bestätigt meinen Verdacht.“
Wieder lässt sie mich auf ihre Reaktion warten. Ich nehme den Blick vom Fenster und schaue stattdessen sie an, als ich im Augenwinkel wieder einen dieser Schatten sehe. Offenbar hat er nur darauf gewartet, dass ich den Blick abwende und huscht somit nun aus der Zimmerecke hinaus auf meine Beine zu. Mit einem ängstlichen Quieken hebe ich meine Füße gerade noch rechtzeitig an, sodass der Schatten darunter hindurchgleitet und unter dem Bett verschwindet. Ich robbe rückwärts weiter in die Mitte des Bettes und keuche. „Oh man…“, ist alles, was ich sagen kann.
Kitty erhebt sich, dreht sich zu mir und stemmt die Hände in die Hüfte. „Was war das?“, will sie wissen und sieht mich dabei finster an.
„Nichts… Ich… Ähm“, stammle ich, obwohl ich weiß, dass es zwecklos ist.
„Seit wann siehst du diese Schatten?“
Ich verdrehe die Augen und setze mich zurück auf die Bettkante. „Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Außerdem geht es hier um meine Mutter! Wir sind hier, um meine Mutter wiederzufinden“, erinnere ich sie und unterdrücke das mulmige Gefühl, dass meine Füße genau dort stehen, wo sie gerade eben noch von einem Schatten attackiert wurden.
„Du hast Angst“, schlussfolgert sie, doch ich schüttle mit dem Kopf. „Leugne es doch nicht, Scarlett! Du hast Angst vor den Schatten!“
Ihr Grinsen wird immer breiter und ich fühle mich zunehmend unwohler.
„Nein, so ein Quatsch! Aber darum geht es hier auch gar nicht, können wir uns nicht lieber wieder auf das Wesentliche konzentrieren?“
Sie schüttelt mit dem Kopf. „Deine Mutter ist nicht hier und sie war auch nie hier, soviel ist klar. Also gibt es dazu auch nicht mehr viel zu sagen. Was aber hier ist, sind die Schattenwesen, die du plötzlich sehen kannst. Also lass uns doch darüber sprechen.“
Es hat keinen Zweck mehr, es weiterhin zu leugnen. Seufzend nicke ich. „Ja, okay, ich kann seit Kurzem Schatten sehen und ja, sie machen mir Angst!“, gebe ich schließlich zu und erwarte bereits, von Kitty ausgelacht zu werden.
Doch zu meiner Überraschung setzt sie sich wieder neben mich, ohne zu lachen. „Wie lange siehst du sie schon?“
Ich presse die Lippen zusammen. Es fühlt sich noch immer falsch an, gerade jetzt darüber zu reden, wo wir doch wirklich Wichtigeres zu tun haben. „Seitdem ich gestorben bin. Allerdings nur in der realen Dimension. Als ich bei Roberta in der Zeitschleife war, habe ich keine Schatten gesehen.“
Meine Gedanken reisen zu der Zeit, als ich nachts mit Chris´ schwebendem Körper über den Friedhof lief und als wir zusammen einige Zeit später dort waren, um die leeren Särge mit Double-Leichen zu füllen. Dieses Stöhnen aus den Gräbern überall auf dem Friedhof werde ich wohl niemals vergessen.
Kitty nickt. „Das Stöhnen und Jammern ist wirklich unangenehm. Man braucht jede Menge Konzentration, um diese Geräusche auszublenden.“
„Du hörst es auch?“, frage ich ein wenig verwundert.
Jetzt lacht sie. „Ja, natürlich! So ist es, ein Medium zu sein! Nicht nur die Geister und Seelen die ich rufe, kommunizieren mit mir. Ich höre sie alle, immer, andauernd!“
Diese Information muss ich erst einmal verdauen. Sie hört immer Geister? Tag und Nacht, zu jeder Zeit? Das muss überaus anstrengend sein.
„Ist es auch. Aber mit der Zeit lernt man, wie man die Stimmen ausblendet und nur denen zuhört, die man auch hören will.“
„Aber mit den Gedanken anderer klappt das nicht?“, hake ich mit ironischem Unterton nach.
Sie zieht die Augenbrauen zusammen. „Theoretisch schon, aber dann verpasse ich ja das Beste“, scherzt sie und auf ihrem Gesicht breitet sich ein schelmisches Grinsen aus.
„Oh man, es ist bestimmt interessant, die Gedanken aller lesen zu können, oder?“
Jetzt wird ihr Gesicht ernst. „Interessant ja, das schon. Andererseits ist es oft auch sehr verletzend. Zumal die Gedanken nur in den seltensten Fällen mit dem ausgesprochenen Wort identisch sind.“
„Wie meinst du das?“
Sie legt den Kopf in den Nacken und seufzt. „Die meisten Menschen denken in die eine Richtung und reden aber in die andere. Sie denken Nein und sagen Ja, oder umgekehrt. Kaum einer sagt wirklich, was er denkt, und in den meisten Fällen ist das auch gut so. Allerdings macht es dir bewusst, wie unaufrichtig das Verhalten der meisten doch ist.“
Ich frage mich, ob ich selbst auch so handle, wie sie es beschreibt, und ertappe mich dabei, dass ich sehr oft eine Meinung zu einem Thema habe, und dann doch anders handle, weil ich niemanden verletzen will oder gezwungen bin, meine Prioritäten neu zu ordnen.
„Es gibt hunderte Beispiele dafür“, fährt sie fort. „Fast jeder Mensch macht es. Was denkst du, warum ich Single bin und es auch bleiben werde? Die wahren Gedanken eines Menschen zu hören, den du liebst, kann sehr weh tun.“
Ich schaue sie an und sehe eine tiefe Verletzlichkeit in ihrem Blick. Es ist offensichtlich, dass die Gedanken anderer sie schon oft verletzt haben. Ihre Arroganz und Überheblichkeit sind nur eine Fassade, hinter der sie sich selbst versteckt, um nicht verletzt zu werden, das wird mir nun klar.
„Siehst du?“ Sie deutet auf mich und ihre Lippen nehmen die Form eines falschen Lächelns ein. „Das meine ich. Du hältst mich für arrogant und überheblich, hast es aber nicht laut gesagt. Soll ich nun also sauer sein, oder so tun, als hätte ich das nicht gehört?“
Das Blut rauscht in mein Gesicht und meine Wangen beginnen zu glühen. „Tut mir leid“, flüstere ich kleinlaut und senke den Blick. „Ich halte dich nicht für arrogant und überheblich.“
Sie nickt. „Doch, das tust du. Und das ist auch in Ordnung so. Es steht dir frei, zu denken, was du willst. Denn nur ich weiß, wie es in mir drinnen wirklich aussieht. Und meine Meinung über mich ist die einzige, die zählt.“
Sie erhebt sich und ich schaue noch immer ein wenig betreten an ihrer schlanken Statur empor. Man kann sie nur bewundern. Tagein, tagaus muss sie die gedachten Worte der Menschen ertragen, gerade bei ihrer doch recht auffälligen Erscheinung, mit den schneeweißen Haaren, der blassen Haut, den violetten Lippen und Augen. Sie war ein ganz normales Mädchen, doch ein Zauber meines Vaters hat sie so weiß werden lassen. Von einer Sekunde auf die andere wurde sie zum Albino; Ein makabrer Scherz des schwarzen Königs, weil sie einen seiner dunklen Hexen-Coven auflösen wollte. Und doch steht sie jeden Morgen erhobenen Hauptes wieder auf. Ich wünschte, ich könnte mir eine Scheibe ihres Selbstbewusstseins abschneiden.
„Komm, lass uns nach unten gehen und den anderen sagen, dass Ella niemals hier war“, sagt sie, legt für den Bruchteil einer Sekunde die Hand auf meine Schulter und geht dann mit wehenden Gewändern voran.