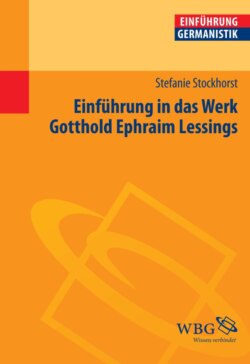Читать книгу Einführung in das Werk Gotthold Ephraim Lessings - Stefanie Stockhorst - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Lessings Werdegang (Herkunft, Vita, Umfeld)
ОглавлениеEine schwierige Biographie
Obgleich Lessing vor allem als Dramatiker, Literaturkritiker und Altertumswissenschaftler große Anerkennung fand, verlief sein Leben im persönlichen Bereich überaus glücklos (vgl. Fick 2010, 43f.), war es doch geprägt durch ständige Geldnot, häufige, mitunter fluchtartige Ortswechsel (vgl. Barner in Stenzel/Lach 2005, 69 – 78), hypochondrische Neigungen, Unzufriedenheit und enttäuschte Hoffnungen. Zeitlebens bemühte er sich vergeblich um materielle Unabhängigkeit, denn er hatte, wie er seinem Vater am 3. April 1760 brieflich gestand, „nicht die geringste Lust, der Sklave eines Amts zu werden“ (B 11 / 1, 346). Seine fortwährende Überschuldung lag nicht nur daran, dass er nur über ein geringes, oft unregelmäßiges Einkommen verfügte, sondern vor allem an einer Mischung aus Großzügigkeit und Leichtsinn in Geldangelegenheiten sowie an seinem leidenschaftlichen Hang zum Glücksspiel.
Elternhaus und Schulbesuch
Am 22. Januar 1729 wurde Lessing in Kamenz (Oberlausitz) als drittes von zwölf Geschwistern geboren, von denen fünf bereits im Kindesalter starben. Er entstammte einer protestantischen Pastorenfamilie, also einem typischerweise finanziell eingeschränkten, aber zutiefst pflicht- und bildungsorientierten Milieu: Seine Mutter, Justina Salome Lessing, geb. Feller (1703 – 1777), war die Tochter des damaligen Kamenzer Oberpfarrers, dessen Amtsnachfolge sein Vater, Johann Gottfried Lessing (1693 – 1770) im Jahr 1733 antrat. Für das bürgerliche Selbstverständnis, das im 18. Jahrhundert verstärkt aufkam, stellte Bildung eine wichtige Legitimationsgrundlage dar, ermöglichte sie doch gesellschaftliche Mobilität und Abgrenzung. So besuchte Lessing die Lateinschule in Kamenz, durfte aber nicht beim Schultheater mitwirken, weil sein Vater diese Einrichtung als Theologe sittlich beargwöhnte. Mit zwölf Jahren bestand Lessing die Aufnahmeprüfung für die renommierte sächsische Fürstenschule St. Afra in Meißen. Der Lehrplan umfasste dort neben Religion vor allem den altsprachlichen Unterricht (Latein, Griechisch und Hebräisch). Als moderne Fremdsprachen lernte Lessing Französisch und etwas Englisch, hinzu kamen Rhetorik, Mathematik, Geschichte und Geographie sowie am Rande ein wenig Naturkunde und Gegenwartsphilosophie. Aufgrund seiner herausragenden Leistungen erhielt Lessing ein Stipendium und durfte die Schule bereits ein Jahr früher als üblich abschließen.
Studium
Als Stipendiat der Stadt Kamenz nahm Lessing 1746 das Studium der Theologie in Leipzig auf, wo er sich mit seinem entfernten Verwandten Christlob Mylius (1722 – 1754) sowie mit dem jungen Schriftsteller Christian Felix Weiße (1726 – 1804) anfreundete. Mit besonderem Interesse widmete er sich fachfremden Gegenständen wie der Altertumskunde, der Epigrammatik und vor allem dem zu dieser Zeit in Leipzig florierenden Theater, für das er Übersetzungen und erste eigene Stücke anfertigte. Als seine Eltern von dieser Neigung, infolge derer Lessing erstmals Schulden machte, erfuhren, riefen sie ihn unter dem Vorwand, seine Mutter liege im Sterben, zurück nach Kamenz. Im Jahr 1748 wechselte Lessing zum Medizinstudium, das er erst in Leipzig aufnahm, dann aber kurzfristig in Wittenberg fortführte, weil er sich in Leipzig durch eine Bürgschaft für Schauspieler, mit denen er bekannt war, erneut verschuldet hatte. Letztlich beglich er die ausstehenden Forderungen mit dem Rest seines Stipendiums, hatte danach aber nicht mehr genügend Geld, um sein Studium fortsetzen zu können. Er ging nach Berlin, wo er zusammen mit Mylius wohnte und sich in der lebendigen Schriftsteller- und Verlegerszene als freier Kritiker und Übersetzer verdingte. Gemeinsam gründeten die beiden 1750 die Theaterzeitschrift Beyträge zur Historie und Aufnahme des Theaters, von der zwar nur vier Hefte erschienen, was aber auf dem schnelllebigen Zeitschriftenmarkt der damaligen Zeit keineswegs unüblich war.
Missverständnis um ein Voltaire-Manuskript
Unter anderem arbeitete Lessing nun als Übersetzer für den französischen Philosophen Voltaire (1694 – 1778), durch dessen Sekretär Richier de Louvain er 1751 die Korrekturabzüge zu Voltaires großer, noch streng geheim gehaltener Geschichtsstudie Le si›cle de Louis XIV. (1751; dt.: Das Zeitalter Ludwigs XIV.) erhielt. Unvorsichtigerweise verlieh er den Text nicht nur weiter, sondern reiste auch noch sehr plötzlich aus Berlin ab, um sein Studium in Wittenberg zu beenden, wobei er vergaß, das Werk zurückzugeben. Dieser Vorfall kostete Richier seine Anstellung und Lessing seinen guten Ruf, denn Voltaire nahm an, er habe die vermeintlich gestohlenen Bögen für einen Raubdruck oder für eine nicht autorisierte Übersetzung nutzen wollen (vgl. Nisbet 2008, 129ff.).
Berliner Literatenkreise
Nach dem Magisterabschluss im Frühjahr 1752, vermutlich mit einer nicht überlieferten Arbeit über die Charakterlehre des spanischen Arztes Juan Huarte (um 1529 – 1588), hielt Lessing sich wieder in Berlin auf, wo er in Wirtshäusern und intellektuellen Zirkeln wie dem sog. Montagsklub zahlreiche Bekanntschaften schloss. Zu seinen engeren Freunden zählten der Schriftsteller Karl Wilhelm Ramler (1725 – 1798), der Philosoph Moses Mendelssohn (1729 – 1786), der Verleger, Literaturkritiker und Satiriker Friedrich Nicolai (1733 – 1786) sowie der Schriftsteller und Offizier Ewald Christian von Kleist (1715 – 1759). Auch den Anakreontiker (vgl. Kap. V.1) Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719 – 1803) lernte Lessing während dieser Berliner Zeit kennen. Recht plötzlich gab er 1755 seine durch Mylius vermittelte Stelle als Redakteur der Berlinischen privilegierten Zeitung (nach ihrem Herausgeber Christian Friedrich Voß auch: Vossische Zeitung) auf, um nach Leipzig aufzubrechen.
Gescheiterte Europareise
Aus Mangel an beruflichen Alternativen erklärte er sich vertraglich bereit, den Leipziger Kaufmannssohn Gottfried Winkler (1731 – 1795) bei festem Gehalt und Erstattung der Aufwendungen auf eine vierjährige Tour durch Europa zu begleiten. Die 1756 angetretene Reise führte über verschiedene norddeutsche Städte bis nach Amsterdam, musste dort jedoch bei Beginn des Siebenjährigen Krieges (1756 – 1763) vorzeitig abgebrochen werden. Als freier Übersetzer kehrte Lessing nach Leipzig zurück, bekam jedoch die angefallenen Reisekosten erst durch ein langwieriges, kostspieliges Gerichtsverfahren zugesprochen.
Breslau und Berlin
Ab 1758 wohnte Lessing abermals in Berlin, wo er in geselligem Umfeld einige gemeinsame publizistische Unternehmungen vor allem mit Ramler, Mendelssohn und Nicolai verwirklichte. Allerdings folgte bereits 1760, kurz nach der Ernennung zum auswärtigen Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften, ein weiterer abrupter Aufbruch, dieses Mal nach Breslau. Lessing trat eine Stelle als Sekretär des preußischen Generalleutnants Bogislaw Friedrich von Tauentzien (1710 – 1791) an und nahm in dieser Funktion am Siebenjährigen Krieg teil. Seine ständige Unzufriedenheit mit sich und seinen Verhältnissen hielt unverändert an. Eine kurze, aber heftige Fiebererkrankung, die Lessing im Jahr seines 35. Geburtstags durchmachte, erklärte er in einem Brief an Ramler vom 5. August 1764 zum Wendepunkt seines Lebens, habe er doch „in diesem hitzigen Fieber den letzten Rest“ seiner „jugendlichen Torheiten verraset“ (B 11 / 1, 415). An seiner Lage änderte sich durch diese Feststellung freilich wenig: Nach der Kündigung bei Tauentzien ließ er sich 1765 abermals in Berlin nieder, wieder ohne festes Gehalt. Zudem hatte sein Diener, den er mit seinen Habseligkeiten vorausgeschickt hatte, ihn nicht nur bestohlen, sondern auch in seinem Namen Schulden gemacht (vgl. Nisbet 2008, 434). Während seine Versuche, eine Anstellung als königlicher Bibliothekar in Berlin, bei den Kunstsammlungen in Dresden oder beim Antiken- und Münzkabinett in Mannheim zu erlangen, allesamt erfolglos blieben, seufzte Nicolai im Mai 1765 in einem Brief an Ramler über Lessings „gute Gewohnheit, das, was seine Freunde glauben, daß er thun werde, gerade nicht zu thun“ (in Dvoretzky 1971, 44).
Das Hamburger Nationaltheaterprojekt
Im Jahr 1767 ging Lessing auf das vielversprechende Angebot ein, das in Hamburg neu gegründete Nationaltheater als Dramatiker und Rezensent zu unterstützen. Dieses Projekt kam seinen Fähigkeiten und Neigungen durchaus entgegen, scheiterte aber bereits im Folgejahr (vgl. Kap. IV.4). Parallel dazu kaufte Lessing sich auf Kredit als Teilhaber in die Verlagsdruckerei seines Hamburger Freundes Johann Bode (1730 – 1793) ein, in der die theaterkritische Zeitschrift Hamburgische Dramaturgie (vgl. Kap. IV. 4) erschien. Eine Buchreihe mit dem Titel Deutsches Museum blieb im Stadium der Planung stecken, weil sich die Druckerei letzten Endes als Verlustgeschäft erwies. Lessing sah sich gezwungen, in drei Auktionen nach und nach fast seine gesamte Bibliothek zu veräußern, die mit rund 6.000 Bänden für eine Privatsammlung dieser Zeit außerordentlich umfangreich war. Zu Lessings Hamburger Freundes- und Bekanntenkreis gehörten neben den Schriftstellerkollegen Friedrich Gottlieb Klopstock (1724 – 1803) und Matthias Claudius (1740 – 1815) auch der Theologe Hermann Samuel Reimarus (1694 – 1768) und seine Familie sowie der Kaufmann Engelbert König (1728 – 1769) und seine Frau Eva Katharina, geb. Hahn (1736 – 1778).
Bibliotheksdienst in Wolfenbüttel
Hoch verschuldet übernahm Lessing Ende 1769 die Position des Bibliothekars an der herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel, die über einen weithin berühmten Bestand verfügte. Mitte 1770 begann er einen Briefwechsel mit der im Vorjahr verwitweten Eva König; er stellt mit zusammengerechnet 193 Briefen den ausgedehntesten dar, den Lessing, der seinen Freunden sonst oftmals Antworten schuldig blieb, jemals führte (vgl. Nisbet 2008, 573). Trotz anregender Bekanntschaften, etwa mit dem Theologen Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem (1709 – 1789) und dem Literatur- und Philosophieprofessor Johann Joachim Eschenburg (1743 – 1820) in Braunschweig, klagte Lessing über einen Mangel an Geselligkeit. Überhaupt wurde er, bei anhaltenden finanziellen Sorgen, der neuen Tätigkeit rasch überdrüssig, obwohl sie mit 600 Reichstalern vergleichsweise gut bezahlt war und ihm viel Zeit für das eigene schriftstellerische Schaffen ließ. Unmissverständlich schrieb er am 30. April 1774 an Ramler: „Es ist nie mein Wille gewesen, an einem Orte, wie Wolfenbüttel, von allem Umgange, wie ich ihn brauche, entfernt, Zeit meines Lebens Bücher zu hüten.“ (B 11 / 2, 641)
Abb. 1: Gotthold Ephraim Lessing (1770). Ölgemälde von Anton Graff [alte Kopie oder Original]. Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, B 119. Werk-Verzeichnis Nr. 870 (aus Raabe 1981, nach 18).
Verlobung und Freimaurertum
Im Spätsommer 1771 bat Lessing um eine Beurlaubung für Reisen nach Berlin und Hamburg. Er verlobte sich mit Eva König und wurde in die Hamburger Freimaurer-Loge „Zu den drei Rosen“ aufgenommen, nachdem er schon länger die Nähe zum Freimaurertum gesucht hatte. Als einflussreiche Geheimbünde, die sich bereits im Großbritannien des 17. Jahrhunderts zu formieren begannen, richteten sich die Ziele der aufklärerischen Logen in ganz Europa auf die Selbstvervollkommnung (Perfektibilität) des Individuums, auf die gelebte Menschlichkeit jenseits von ständischen und konfessionellen Grenzen sowie auf das Engagement in den Künsten, in der Politik und im Gemeinwesen. Die tatsächlichen Abläufe, Regularien und Systemstreitigkeiten ernüchterten Lessing indes so sehr, dass er nicht mehr an den Aktivitäten der Loge teilnahm und die Absicht einer Logengründung in Wolfenbüttel aufgab.
Späte Reisen
Für weitere Reisen nach Leipzig, Berlin, Dresden und Wien ließ sich Lessing 1775 nochmals beurlauben. Als berühmter Dramatiker wurde er mit den größten Ehren von Kaiser Joseph II. (1741 – 1790) empfangen. Unterdessen traf Prinz Leopold von Braunschweig (1752 – 1785) in Wien ein, der Lessing ersuchte, ihn auf eine Reise nach Italien zu begleiten. Damit erfüllte sich für Lessing eigentlich ein langgehegter Wunsch, hatte er doch nach dem Zusammenbruch der Nationaltheaterunternehmung in Hamburg ernsthaft über eine Flucht nach Rom nachgedacht, wo er sich aufgrund der verklärenden Schwärmereien etlicher Schriftstellerkollegen sowohl finanziell als auch geistig angenehmere Lebensbedingungen erhoffte. In der biographischen Situation jedoch, die er mittlerweile erlangt hatte, kam ihm die Reise, nun keine Gelehrtenfahrt, sondern eine adlige Cavaliertstour, äußerst ungelegen. Nach seinen brieflichen Auskünften stand die Reise, die Lessing trotzig in einer Kutsche mit zugezogenen Vorhängen absolvierte, im Zeichen von Verzögerungen, zeremoniellen Verpflichtungen und der Sorge um Eva König, deren Briefe nicht an ihn weitergeleitet wurden. Mit längeren Stationen in Mailand, Venedig, Bologna, Florenz, Rom und Neapel verbrachte Lessing deshalb mehr als sieben Monate in Italien, ohne einen nennenswerten Ertrag für sich daraus ziehen zu können (vgl. Nisbet 2008, 587f.). Auch hinterließ er im Unterschied zu vielen Schriftstellern seiner Zeit keinen literarisierten Reisebericht, sondern lediglich ein vergleichsweise schmales Notizheft, in dem er allerdings weder die Kunstschätze noch die Naturschönheiten beschrieb, sondern lediglich ein trockenes, beinahe listenartiges Inventar der italienischen Gelehrtenrepublik anlegte (vgl. Wiedemann 1997, 217).
Glück und Unglück der letzten Jahre
Zurück in Wolfenbüttel, erhielt Lessing 1776 den Titel eines braunschweigischen Hofrats sowie eine Gehaltserhöhung. Des Weiteren wurde er zum Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Mannheim ernannt. Dort sollte er außerdem beim Aufbau eines Nationaltheaters mitwirken, aber seine Entwürfe, die er vor Ort präsentierte, führten letztlich nicht zu einem Vertragsabschluss. Am 8. Oktober 1776 heiratete er Eva König. Am 25. Dezember 1777 kam der gemeinsame Sohn Traugott zur Welt, starb jedoch innerhalb eines Tages an den Folgen einer schwierigen Zangengeburt, welche auch die Mutter nur bis zum 10. Januar 1778 überlebte. Am 31. Dezember 1778, während seine Frau im Sterben lag, schrieb Lessing an Eschenburg einen der traurigsten Briefe der deutschsprachigen Literaturgeschichte:
„Ich ergreife den Augenblick, da meine Frau ganz ohne Besonnenheit liegt, um Ihnen für Ihren gütigen Anteil zu danken. Meine Freude war nur kurz: Und ich verlor ihn so ungern, diesen Sohn! denn er hatte so viel Verstand! so viel Verstand! – Glauben Sie nicht, daß die wenigen Stunden meiner Vaterschaft, mich schon zu so einem affen von Vater gemacht haben! Ich weiß, was ich sage. – War es nicht Verstand, daß man ihn mit eisern Zangen auf die Welt ziehen mußte? daß er sobald Unrat merkte? – War es nicht Verstand, daß er die erste Gelegenheit ergriff, sich wieder davon zu machen? – Freilich zerrt mir der kleine Ruschelkopf auch die Mutter mit fort! – Denn noch ist wenig Hoffnung, daß ich sie behalten werde. – Ich wollte es auch einmal so gut haben, wie andere Menschen. Aber es ist mir schlecht bekommen.“ (B 12, 116)
Während Lessing schwer unter dem persönlichen Verlust seines Sohnes und seiner Frau litt, kamen noch weitere Rückschläge in anderen Bereichen hinzu. So löste seine Veröffentlichung von Texten aus dem Nachlass von Reimarus einen erbitterten Streit mit dem Hamburger Hauptpastor Johann Melchior Goeze (1717 – 1786) aus (vgl. Kap. IV.1), durch den Lessing 1777 die Zensurfreiheit für seine seit 1773 erscheinende Zeitschrift Zur Geschichte und Litteratur verlor. Seit dem Winter 1779 / 80 verschlechterte sich überdies sein Gesundheitszustand dergestalt, dass es ihm häufig Mühe bereitete, wach zu bleiben und sich zu konzentrieren. Er starb am 15. Februar 1781, mutmaßlich an einer schon länger vorhandenden Herzerkrankung (vgl. Nisbet 2008, 842) im Haus eines Bekannten in Braunschweig.