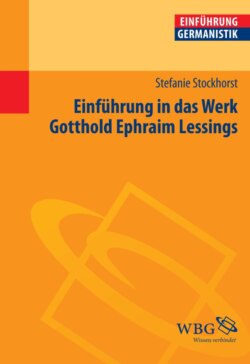Читать книгу Einführung in das Werk Gotthold Ephraim Lessings - Stefanie Stockhorst - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Entwicklungsphasen seines Werks im Kontext der Aufklärung
ОглавлениеSchaffensphasen als Methodenproblem
So nützlich eine Phasengliederung einerseits als Orientierungshilfe ist, um sich dem literarischen Schaffen eines Autors überblicksartig anzunähern, so problematisch wird sie andererseits, wenn man ihre Erklärungskraft überschätzt. Denn bei zeitlichen Schnitten und begrifflichen Etikettierungen handelt es sich oftmals weit weniger um historische Tatsachen als um nachträgliche Zuschreibungen durch die Literaturwissenschaft: Aus dem ,jungen‘ Lessing wird nicht von heute auf morgen der ,mittlere‘ oder der ,späte‘, manche Eigenheiten (z.B. die Begeisterung für Kritik und Polemik) und Interessen (z.B. am Drama, an der Fabel und am Epigramm) ziehen sich durch sein gesamtes Werk, und spätere Überlegungen gehen oft aus früheren hervor, so dass sie sich schwerlich isoliert verstehen lassen. Eine kurze, schematische Darstellung der Entwicklung Lessings als Schriftsteller im Kontext seiner Epoche kommt mithin nicht ohne erhebliche Vereinfachungen aus. Sie bedarf daher einer Differenzierung und Ergänzung durch die zusätzliche Lektüre tiefergreifender Forschungsarbeiten zu den einzelnen hier angerissenen Themen.
Aufklärung als Epoche
Lessings Werk steht im Zeichen der Aufklärung, einer denkgeschichtlichen Epoche, die sich bei einer zeitlichen Ausdehnung etwa von den 1680er Jahren bis ins ausgehende 18. Jahrhundert mit verschiedenen, teils sogar gegenläufigen Strömungen durch bestimmte, überwölbende Annahmen über den Menschen und seine Stellung in der Welt kennzeichnet. Die elementaren Forderungen der Aufklärung brachte der Philosoph Immanuel Kant (1724 – 1804) in seinem vielzitierten Aufsatz mit dem programmatischen Titel Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1784) auf den Punkt. Ausgehend von der Annahme einer prinzipiellen Vernunftbegabung des Menschen, die es zu entfalten gilt, heißt es dort: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit.“ (Kant 1784, 481) Diese Mündigwerdung gelinge allein durch die furchtlose Entschlossenheit eines jeden Individuums: „Sapere aude! Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“ (ebd.)
Programmwerte der Aufklärung
Als Zeitalter der Glaubens- und Aberglaubenskritik wies die Aufklärung kirchliche Lehren von der göttlichen Vorherbestimmung des Schicksals (Prädestination) und volkstümliche Weltdeutungen zurück. Der Mensch wurde zunehmend als aktiv gestaltendes Subjekt der Geschichte verstanden, wobei sich sowohl fortschrittsoptimistische als auch zivilisationskritische Tendenzen feststellen lassen. Nicht zuletzt markiert die Aufklärung den Beginn der bürgerlichen Emanzipation, in der absolutistische Herrschaftsansprüche mit naturrechtlichen Argumenten hinterfragt wurden, so dass leistungsethische Maßstäbe das Gottesgnadentum als Legitimationsgrundlage für weltliche Macht zurückdrängten. Im Vertrauen auf einen menschlichen Gemeinsinn (lat.: sensus communis) bzw. auf ein natürliches Moralempfinden (engl.: moral sense) bestand ein zentrales Anliegen der Aufklärung darin, den Menschen zu eigenverantwortlichem und rational begründetem Handeln sowie zur Kritik als öffentlicher Form des Vernunftgebrauchs zu erziehen.
Strukturwandel der Öffentlichkeit
Für das literarische Leben des 18. Jahrhunderts führten die Bildungs- und Diskussionsbestrebungen der Aufklärung zu einschneidenden Veränderungen in der Medien- und Kommunikationslandschaft, zu einem Strukturwandel der Öffentlichkeit, wie Jürgen Habermas dieses Phänomen 1962 in einer Studie gleichen Titels bezeichnete. Gemeint ist damit das Aufkommen einer bürgerlichen, d.h. allgemein zugänglichen Öffentlichkeit im Unterschied zu der repräsentativen, also auf eine jeweils recht enge Personengruppe beschränkte Öffentlichkeit früherer Zeiten, wie sie sich beispielsweise im höfischen, universitären und akademischen oder kirchlichen Umkreis manifestierte. Obwohl Habermas oft und auch durchaus berechtigt kritisiert wurde, bleibt an seiner Beobachtung festzuhalten, dass im 18. Jahrhundert ein fundamentaler Umbruch der Kommunikationsverhältnisse stattfand. Er lässt sich insofern als Demokratisierung des öffentlichen Diskurses kennzeichnen, als ein immer größerer Anteil der Bevölkerung an der Meinungsbildung in politischen und kulturellen Zusammenhängen partizipierte und dementsprechend auch zunehmend eine Teilhabe an der staatlichen Macht verlangte. Vor diesem Hintergrund geriet die Zensur, die bis dahin als legitime Kontrollinstanz der Obrigkeit zur Aufrechterhaltung von Herrschaft und öffentlicher Ordnung anerkannt war, in die Kritik, beschnitt sie doch den kritischen Austausch über aktuelle Fragen mit den Mitteln der Publizistik bisweilen ganz erheblich. Dementsprechend gehörte die Meinungs- und Pressefreiheit, deren erreichtes Ausmaß als Gradmesser für politische Fortschrittlichkeit gelten konnte, zu den grundlegenden Voraussetzungen und Forderungen der Aufklärung. So liest man bei Kant über die Notwendigkeit eines freien, öffentlichen Räsonnements:
„Daß aber ein Publikum sich selbst aufkläre, ist eher möglich; ja es ist, wenn man ihm nur Freiheit läßt, beinahe unausbleiblich. Denn da werden sich immer einige Selbstdenkende sogar unter den eingesetzten Vormündern des großen Haufens finden, welche, nachdem sie das Joch der Unmündigkeit selbst abgeworfen haben, den Geist einer vernünftigen Schätzung des eigenen Werts und des Berufs jedes Menschen selbst zu denken um sich verbreiten werden. […] Zu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit; und zwar die unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die: von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen.“ (Kant 1784, 483f.)
Leseverhalten in der Aufklärung
Durch bessere Bildungsvoraussetzungen und den allmählichen Anstieg der Lesefähigkeit in der Bevölkerung von rund 5% auf rund 15% im Laufe des 18. Jahrhunderts wuchs der Markt für Druckerzeugnisse nicht nur quantitativ erheblich an, sondern er brachte auch eine historisch neuartige Vielfalt an Lesestoffen hervor. Es erfolgte ein Übergang vom sog. intensiven Lesen, also von der wiederholten Lektüre von einzelnen, vorzugsweise erbaulichen Büchern, hin zum sog. extensiven Lesen, also zur einmaligen Lektüre von vielen, durchaus verschiedenartigen Schriften: Der Buchmarkt expandierte, und dazu erschienen neben zahlreichen Zeitungen auch Moralische Wochenschriften, Almanache und Kalender, Literaturzeitschriften und andere Blätter, die sich speziellen Themenfeldern oder Publikumsgruppen widmeten, um einen kritischen Informations- und Meinungsaustausch zu ermöglichen. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts kamen Lesezirkel auf, in denen Bücher und Zeitschriften zum einen kostengünstig erhältlich waren und zum anderen mit Gleichgesinnten diskutiert werden konnten. Erst im letzten Jahrhundertviertel entstanden vermehrt auch Lesekabinette und öffentliche Leihbibliotheken gegründet.
Frühe Schaffensphase: 1745 bis 1755
Mitte der 1740er Jahre, als die rationalistisch geprägte Frühaufklärung bereits stark durch sensualistische und empiristische Tendenzen der Hochaufklärung zurückgedrängt wurde (vgl. Alt 2007, 7f.), setzte Lessings literarische Produktivität ein. Noch als Schüler unternahm er im Alter von 16 Jahren seine ersten lyrischen Experimente, die sowohl Modisches wie die Anakreontik als auch Altmodisches wie die Lehrdichtung umfassten (vgl. Kap. V.1). Eine frühe, nicht überlieferte Fassung seiner Typenkomödie Der junge Gelehrte (vgl. Kap. V.2) stammt ebenfalls bereits aus dieser Zeit. Während der Leipziger Studienjahre, in denen Lessing Übersetzungen für die Schauspieltruppe der Theaterreformerin Friederike Caroline Neuber (1697 – 1760) anfertigte, folgten weitere Lustspiele, die sich vorerst noch recht konventionell mit aufklärerisch geprägten Problemen beschäftigten, darunter das Verhältnis von Wissenschaft und Lebenswelt, Fragen der Humanität und Selbstverwirklichung, die oft erhobene, aber selten eingelöste Toleranzforderung sowie alltägliche Laster und Tugenden. Neben Damon oder die wahre Freundschaft, das 1747 als erstes von Lessings Dramen im Druck erschien, wurden auch Der Misogyn, Die Juden, Der Freigeist, Die alte Jungfer und Der Schatz vollendet. Weitere dramatische Versuche wie Der Leichtgläubige, Die Matrone von Ephesus und das Zeitgeschichtsstück Samuel Henzi blieben hingegen fragmentarisch. Etwa gleichzeitig entstanden auch Lessings älteste Fabeldichtungen (vgl. Kap. V.4).
Publizistische Vielseitigkeit
Als Herausgeber der Zeitschriften Ermunterungen zum Vergnügen des Gemüts und Der Naturforscher veröffentlichte Christlob Mylius (1722 – 1754), mit dem Lessing weitläufig verwandt und eng befreundet war, ab 1747 auch dessen Lieder und Gedichte. Außerdem etablierte sich Lessing schnell als ebenso stilsicherer wie streitbarer Literaturkritiker, der mit zahlreichen Rezensionen, kritischen Briefen und sog. Rettungen (vgl. Kap. IV.1) an die Öffentlichkeit trat. Um 1750 werden erstmals theologische Neigungen erkennbar, denn er verfasste ein unveröffentlichtes Aufsatzfragment mit dem Titel Gedanken über die Herrnhuter, in dem er die Lebens- und Glaubenspraxis des Pietismus, einer protestantischen Frömmigkeitsbewegung, verteidigte. Seine Fähigkeiten als Altphilologe erprobte Lessing im selben Jahr mit einer Abhandlung über Leben und Werk des römischen Komödiendichters Plautus (ca. 254 – 184 v. Chr.), mit dem er sich intensiv auseinandersetzte. Nachdem schon 1751 die erste Gedichtsammlung in selbständiger Buchform unter dem Titel Kleinigkeiten erschienen war, zog spätestens die zwischen 1753 und 1755 erschienene Ausgabe seiner Schriften eine Bilanz aus dem Frühwerk. Die sechs Bände enthielten Gedichte, Fabeln, Kritiken, Jugendkomödien sowie das erste bürgerliche Trauerspiel Miß Sara Sampson (1755), mit dem Lessing den Weg zum Ausnahmedramatiker einschlug.
Mittlere Schaffensphase: 1756 bis 1769
Die nächste Schaffensphase, die sich aufgrund von unsteten Lebensverhältnissen mit „Wanderjahre“ (Fick 2010, 44) bezeichnen lässt, erwies sich als publizistisch außerordentlich ertragreich, insbesondere in der Verbindung mit Mendelssohn, Nicolai und später Ramler. So schrieb Lessing über seine Aktivitäten am 8. Juli 1758 an Gleim: „Herr Rammler und ich, machen Projecte über Projecte. Warten Sie nur noch ein Vierteljahrhundert, und Sie sollen erstaunen, was wir alles werden geschrieben haben. Besonders ich!“ (B 11 / 1, 293) Hatte Lessing bereits 1755 gemeinsam mit Mendelssohn die methodenkritische Schrift Pope ein Metaphysiker! (vgl. Kap. IV.3) geschrieben, so lieferte er in den Jahren 1757 und 1758 einige Artikel für die von Mendelssohn und Nicolai herausgegebene Zeitschrift Bibliothek der schönen Wissenschaften und freien Künste. Zu dritt verfassten die Freunde von 1759 bis 1765 die literaturkritischen Briefe, die neueste Literatur betreffend (vgl. Kap. IV.2). Mit Ramler gab er 1759 eine Auswahl der Epigramme des Barockdichters Friedrich von Logau (1605 – 1655; vgl. Kap. V.1) heraus, zu der er die theoretische Vorrede und ein Glossar beisteuerte, das Besonderheiten des älteren Sprachgebrauchs verzeichnet und damit seinen ursprünglichen Plan eines Deutschen Wörterbuchs zumindest teilweise verwirklicht. Sein Fabelbuch, das neben Fabeldichtungen auch ausführliche theoretische Erläuterungen zu dieser Gattung enthält (vgl. Kap. V.4), erschien ebenfalls 1759.
Theorie und Praxis des Dramas
Im Bereich des Dramas versuchte sich Lessing während der zweiten Hälfte der 1750er Jahre an verschiedenen Stoffen, die mehrheitlich auf das Ziel, ein heroisches Trauerspiel zu schaffen, hindeuten. Als Fragemente wurden die antikisierenden Dramen Codrus und Kleonnis skizziert. Außerdem interessierte Lessing sich für den antiken Virginia-Stoff, woraus 1757 die Fragmente Das befreite Rom und Virginia sowie 1772 Emilia Galotti hervorgingen (vgl. Kap. V.6), und 1758 bis 1760 arbeitete er an einem Faust-Drama, das er allerdings trotz großer Anstrengungen nicht fertigzustellen vermochte. Auch ein zweiter Anlauf zu Die Matrone von Ephesus gelang ihm nicht. Abgeschlossen wurde das einaktige Trauerspiel Philotas (1759; vgl. Kap. V.3), in dem der Krieg ebenso problematisiert wird wie in dem 1767 nach dreijähriger Bearbeitungszeit uraufgeführten Lustspiel Minna von Barnhelm (vgl. Kap. V.5). Hinzu kommt die Übersetzung zweier Komödien des französischen Aufklärers Denis Diderot (1713 – 1784), die 1760 unter dem Titel Das Theater des Herrn Diderot erschien. Im selben Jahr ging auch der erste Teil einer Biographie über den griechischen Tragödiendichter Sophokles (um 497 – 405 v. Chr.) in den Druck, dem jedoch keine weiteren Teile folgten. Mit der Hamburgischen Dramaturgie (1767 – 69) lieferte Lessing einen maßgeblichen Beitrag zur Dramentheorie (vgl. Kap. IV.4).
Altertumskunde
Einen zweiten Schwerpunkt der mittleren Schaffensphase bildet die Altertumskunde. Hatte Lessing sich schon 1754 in seinem Vade mecum für den Herrn Samuel Gotthold Lange etwas rechthaberisch zu Fragen der klassischen Philologie geäußert, so entfachte er nach der Publikation des ersten und einzigen Teils seiner von großer Gelehrsamkeit zeugenden Ästhetiktheorie Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766; vgl. Kap. IV.3) den sog. antiquarischen Streit (vgl. Kap. IV.1) mit dem Philologen Christian Adolf Klotz (1738 – 1771), gegen den sich seine Abhandlung Wie die Alten den Tod gebildet (1768) sowie die Briefe, antiquarischen Inhalts (1768 / 69) richteten.
Späte Schaffensphase: 1770 bis 1781
Neben der Übersiedlung nach Wolfenbüttel markiert auch der Anlauf zu einer weiteren Werkausgabe den Beginn von Lessings letztem produktiven Jahrzehnt, in dem die Beschäftigung mit der Religions- und Geschichtsphilosophie in den Vordergrund tritt. Der erste Band seiner Vermischten Schriften, in denen die Anmerkungen über das Epigramm (vgl. Kap. IV.3) sowie eigene Epigramme und Gedichte (vgl. Kap. V.1) enthalten sind, erschien 1771, während die noch fehlenden Bände Nr. 2 bis 14 erst postum durch Lessings Bruder Karl und den Braunschweiger Philologen Johann Joachim Eschenburg (1743 – 1820) in den Druck gegeben wurden. Zeitgleich erstellte Lessing die Endfassung seines bürgerlichen Trauerspiels Emilia Galotti (vgl. Kap. V.6), das im Folgejahr uraufgeführt wurde. Im Jahr 1776 veröffentlichte er die Philosophischen Aufsätze Karl Wilhelm Jerusalems (1747 – 1772), um eine kritische Relativierung von Goethes Briefroman Die Leiden des jungen Werthers (1774) vorzunehmen, dessen Titelheld Jerusalem zum Vorbild hatte.
Dogmatismus vs. Toleranz
Als herzoglicher Bibliothekar gab Lessing die Schriftenreihe Zur Geschichte und Literatur. Aus den Schätzen der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel (1773 – 81) heraus. Darin veröffentlichte er in den Jahren von 1774 bis 1778 unter dem Titel Fragmente eines Ungenannten eine Reihe von theologisch brisanten Abhandlungen aus dem Nachlass von Hermann Samuel Reimarus (1694 – 1768), was den sog. Fragmentenstreit mit Johann Melchior Goeze (1717 – 1786) auslöste (vgl. Kap. IV.1). Allein 1778 feuerte er eine Salve von 15 Streitschriften gegen den Hamburger Hauptpastor ab. Die Kontroverse nahm derart skandalöse Ausmaße an, dass Lessing ein herzogliches Verbot erhielt, sich weiter publizistisch zu theologischen Fragen zu äußern. Da Lessing an die Grenzen einer diskursiven Öffentlichkeit aufklärerischer Prägung stieß, verlegte er sein letztes Wort in dieser Angelegenheit auf die Bühne. Denn vor diesem Hintergrund geht es in dem 1779 erschienenen Nathan der Weise (vgl. Kap. V.7) nicht nur um religiöse Toleranz, sondern auch um hartleibigen Dogmatismus. In diesem thematischen Zusammenhang entstanden schließlich auch Ernst und Falk. Gespräche für Freimäurer (1778 / 80) sowie Die Erziehung des Menschengeschlechts (1780), die sich bei einem skeptischen Grundzug im Kern für ein vernunftgeleitetes Humanitätsideal starkmachen.
Lessing über sich selbst
Während seiner letzten Schaffensphase skizzierte Lessing seine Selbstbetrachtungen und Einfälle, eine Reihe von autobiographisch gefärbten Fragmenten, die zu Lebzeiten unveröffentlicht blieben. Mit kurzen, teilweise zu Aphorismen (d.h. zu sinnspruchartigen Einfällen mit philosophischem Anklang) verknappten Momentaufnahmen umreißt er darin sein Selbstverständnis sowie Einsichten, die er über sich und seine Zeit gewonnen hat. Bei allem anekdotischen Unterhaltungswert müssen derartige Äußerungen von Autoren aus literaturwissenschaftlicher Sicht müssen immer mit einer gewissen Vorsicht ausgewertet werden. Wenn nämlich Lessing über sich selbst Auskunft gibt, so kann man daraus nur sehr bedingt weiteres ersehen, welche Beweggründe und Absichten sein schriftstellerisches Handeln geleitet haben oder was für einen Charakter er gar als Mensch besaß. Gerade bei einem rhetorisch und textstrategisch so überaus geschickten Autor wie Lessing muss man davon ausgehen, dass es sich bei seinen Selbstzeugnissen in nicht zu unterschätzendem Maße um Stilisierungen handelt im Interesse der Rezeptionslenkung handelt. Was sich also jedenfalls daraus ablesen lässt, ist, wie Lessing sich selbst sah bzw. wie er von der Mit- und Nachwelt gesehen werden wollte.
Gleichwertigkeit der Religionen
Auch im Zusammenhang der Selbstbetrachtungen und Einfälle betont er seine religiöse Toleranz, wobei sich seine Bekundungen über sein Verhältnis zum Christentum wiederum recht konfliktträchtig ausnehmen, denn was Lessing zu diesem Punkt vorbringt, zeugt von derselben nüchternen Zurückweisung aller kirchlichen Überlegenheitsdogmen, durch die sich auch die Titelfigur seines dramatischen Spätwerks Nathan der Weise kennzeichnet. So schreibt er:
Ich habe gegen die christliche Religion nichts: ich bin vielmehr ihr Freund, und werde ihr Zeitlebens hold und zugetan bleiben. Sie entspricht der Absicht einer positiven Religion, so gut wie irgend eine andere. Ich glaube sie und halte sie für wahr, so gut und so sehr man nur irgend etwas historisches glauben und für wahr halten kann. Denn ich kann sie in ihren historischen Beweisen schlechterdings nicht widerlegen. Ich kann den Zeugnissen, die man für sie anführt, keine andere entgegen setzen: es sei nun, daß es keine andere gegeben, oder daß alle andere vertilgt oder geflissentlich entkräftet worden.“ (G V, 789)
Wie seine Nathan-Figur billigt Lessing die positiven Religionen – gemeint sind damit Christentum, Judentum und Islam als große monotheistische Offenbarungsreligionen im Gegensatz zu den Naturreligionen – und bleibt demjenigen Bekenntnis, in das er hineingeboren wurde aus Gewohnheit und Mangel an objektivierbaren Gegenargumenten treu. Dass es ihm mit der Absage an die dogmatische Engstirnigkeit überaus ernst war, belegt das beharrliche Eintreten für seine Überzeugungen im Fragmentenstreit, welches ihn persönlich in erhebliche Schwierigkeiten brachte (vgl. Kap. IV.1).
Hintergründige Bescheidenheitsgesten
Lessing gehörte nicht nur zu den brillantesten und dabei streitlustigsten Köpfen der deutschen Aufklärung, sondern wusste den hohen Rang seiner intellektuellen Leistungen auch durchaus einzuschätzen. Gleichwohl war er kein ,Gelehrter‘ im traditionellen Verständnis, also kein Universitätsprofessor, sondern ein akademisch Gebildeter, der sich allerdings die meisten seiner hauptsächlichen Arbeitsgebiete eigenständig und jenseits von universitären Strukturen erschlossen hat. In seinen Selbstbetrachtungen und Einfällen entwirft er sich als selbstgenügsamer Nutzer anderweitig betriebener Gelehrsamkeit, der zumindest augenscheinlich keine eigenen Ambitionen auf diesem Gebiet verfolgt: „Ich bin nicht gelehrt – ich habe nie die Absicht gehabt gelehrt zu werden – ich möchte nicht gelehrt sein, und wenn ich es im Traume werden könnte. Alles, wornach ich ein wenig gestrebt habe, ist, im Fall der Not ein gelehrtes Buch brauchen zu können.“ (G V, 788) Etwas anders stellt sich diese Äußerung freilich dar, wenn man den unmittelbar darauffolgenden Passus mit hinzuzieht, in dem er mitteilt: „Eben so möchte ich um vieles nicht reich sein, wenn ich allen meinen Reichtum in barem Gelde besitzen und alle meine Ausgaben und Einnahmen in klingender Münze vorzählen und nachzählen müßte.“ (ebd.) Da Lessing beinahe ständig in Geldnot lebte, überrascht die Zurückweisung von Reichtümern ein wenig. Es lohnt sich deshalb, genauer auf das konditionale Gefüge zu achten: Offenbar lehnt er Bargeld ab, aber keineswegs einen anderen Reichtum, der nicht in zählbarem Besitz liegt. Lässt sich diese Hierarchisierung von immateriellen Gütern vor den materiellen womöglich auf Lessings verschlungenen Karriereweg mit langen Phasen ohne festes Beschäftigungsverhältnis hin ausdeuten, so mag sich hinter dem vermeintlichen Demutsgeste vor dem Gelehrtentum eine massive Kritik an der überkommenen Buchgelehrsamkeit (vgl. auch Kap. V.2) verbergen, wie die nachstehende Engführung beider Sphären, Gelehrsamkeit und Reichtum, aus demselben Kontext nahelegt: „Der aus Büchern erworbne Ruhm fremder Erfahrung heißt Gelehrsamkeit. Eigne Erfahrung ist Weisheit. Das kleinste Kapitel von dieser, ist mehr wert, als Millionen von jener.“ (G V, 188)
Spiel statt Gedankentiefe
Bemerkenswert erscheinen Lessings abweisende Feststellungen über das Spielen, war er doch bekanntermaßen spielsüchtig: „Ich werde nicht eher spielen, als bis ich Niemanden finden kann, der mir umsonst Gesellschaft leistet.“ (ebd.) Als Begründung führt er an, das Spiel diene lediglich als Ersatz für eine gehaltvolle Konversation: „Das Spiel soll den Mangel der Unterredung ersetzen. Es kann daher nur denen erlaubt sein, die Karten beständig in Händen zu haben, die nichts als das Wetter in ihrem Munde haben.“ (ebd.) Seine eigene Neigung zum Kartenspiel, vorzugsweise zu dem im 18. Jahrhundert weit verbreiteten Kartenspiel Faro oder Pharao, müsste in diesem Licht als verzweifelt gepflegter Zeitvertreib eines chronisch unterforderten Genius erscheinen. Eine ganz ähnliche Abneigung gegenüber der allzu leichten Geselligkeit, die freilich traditionell eher mit höfischen als mit bürgerlichen Formen der sozialen Interaktion in Verbindung gebracht wird, kommt auch in der folgenden Bemerkung zum Ausdruck:
„Das Wort Zeitvertreib sollte der Name einer Arznei, irgendeines Opiats, eines Schlafmachenden Mittels sein, durch das uns auf dem Krankenbette die Zeit unmerklich verstreicht: aber nicht der Name eines Vergnügens. Doch kommen wir denn nicht auch öfters in Gesellschaften in welchen wir aushalten müssen, und in welchen uns die Zeit eben so unerträglich langweilig wird, als auf dem Krankenlager?“ (G V, 792)
Auf welche ,Gesellschaften‘ Lessing hier genau anspielt, lässt sich nachträglich kaum mehr erschließen, kann es doch dabei ebenso um seine Breslauer Zeit im Dienst des Generals Tauentzien gehen wie etwa um die als lästig empfundene Italienreise, um seinen Bekanntenkreis in Braunschweig sowie vielleicht auch um ganz andere Situationen der Berliner oder Hamburger Jahre.