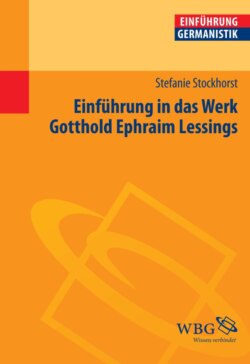Читать книгу Einführung in das Werk Gotthold Ephraim Lessings - Stefanie Stockhorst - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Lessings Präsenz und Aktualität
ОглавлениеEin Schriftsteller, Philosoph und beharrlicher Streiter für Toleranz, Menschlichkeit und für das Streiten selbst – Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) gehört zu den schillerndsten Lichtgestalten der deutschen Aufklärung. Doch sein Vermächtnis ist keineswegs nur ein historisches, das Philologen und andere spezialisierte Geisteswissenschaftler bewegt: In seinen Texten und Gedanken, aber auch als Person begegnet Lessing bis auf den heutigen Tag noch immer in zahlreichen, ganz unterschiedlichen Zusammenhängen.
Lessing im öffentlichen Raum
An vielen Orten ist er sogar im Stadtbild gegenwärtig, etwa durch Straßen und Plätze, die nach ihm benannt wurden, sowie durch einige Denkmäler. Die ersten Statuen wurden bereits im 19. Jahrhundert errichtet, so beispielsweise am Lessingplatz in Braunschweig (1853), auf dem Gänsemarkt in Hamburg (1881) und in der Lennéstraße in Berlin-Tiergarten (1890). Lessings ursprünglich schlichter Grabstein auf dem Braunschweiger Magni-Friedhof wurde 1874 im Zuge der wilhelminischen Dichterverehrung gegen ein wesentlich prächtigeres Denkmal ausgetauscht, das ein Relief mit dem Portrait des Aufklärers ziert. Einzelne seiner Texte tauchen ebenfalls im Kontext der öffentlichen Memorialkultur auf, so etwa im Berliner Stadtteil Moabit, wo sich an der 1903 eingeweihten Lessing-Brücke vier Bronzeplatten befinden, auf denen jeweils die Schlussszenen seiner bekanntesten Dramen, Miß Sara Sampson (1753), Minna von Barnhelm (1767), Emilia Galotti (1772) und Nathan der Weise (1779) abgebildet sind. Die originalen Darstellungen wurden 1939 von den Nationalsozialisten zerstört und 1983 durch Kopien ersetzt. Auch in Wien wurde 1939 ein erst vier Jahre zuvor auf dem Judenplatz aufgestelltes Lessing-Denkmal eingeschmolzen. Ein neues Bronzestandbild kam 1963 zunächst an den Ruprechtsplatz, wurde aber 1981 auf den Judenplatz verbracht. Diese Ereignisse dürfen als bezeichnend gelten für die Rezeptionsgeschichte Lessings (vgl. Kap. VI) im 20. Jahrhundert: Er wird in erster Linie als Dramatiker wahrgenommen, dessen weltbürgerlicher Widerspruchsgeist ihn erst zum Feindbild der NS-Ideologie und danach zur Integrationsgestalt der Nachkriegszeit werden ließ. So überrascht es kaum, wenn gerade seiner Nathan-Figur als Verkörperung des Toleranzgedankens 1961 in Wolfenbüttel als der Stätte ihrer Entstehung ein Denkmal gesetzt wurde.
Aktualität der Denkweisen
Während etliche seiner Zeitgenossen nur noch dem engen Kreis der Fachwissenschaft vertraut sind, gehört Lessing, dessen Werk gern an den Beginn der neueren deutschen Literaturgeschichte gestellt wird, nach wie vor unbestritten zum literaturgeschichtlichen Minimalstandard. Seine außergewöhnlich lange und intensiv anhaltende Wirkung hängt nicht nur mit den Gegenständen und Problemstellungen seiner Werke zusammen, von denen einige selbst über rund 250 Jahre hinweg wenig an Eindringlichkeit und Aktualität verloren haben, sondern auch mit seiner übergreifenden Zielsetzung, unter den Menschen einen Dialog zu stiften, bei dem es nicht auf das Ergebnis ankommt, sondern auf seine fortwährende Entfaltung. In diesem Sinne stellte die Philosophin Hannah Arendt (1906 – 1975) in ihrer Rede Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten (1959) anlässlich ihrer Auszeichnung mit dem Lessing-Preis der Stadt Hamburg zutreffend fest: „Nicht nur die Einsicht, daß es die eine Wahrheit innerhalb der Menschenwelt nicht geben kann, sondern die Freude, daß es sie nicht gibt und das unendliche Gespräch zwischen den Menschen nie aufhören werde, solange es Menschen überhaupt gibt, kennzeichnet die Größe Lessings.“ (in Steinmetz 1969, 491)
Schulkanon und Universität
Darüber hinaus besticht Lessings Sprache ebenso wie seine Gedankenführung immer noch durch Klarheit und Witz, so dass sich seine Werke besonders gut eignen, um die Leitthemen, die Gattungs- und Stilentwicklungen sowie die thematischen Kontroversen der Aufklärung exemplarisch nachzuvollziehen. Deshalb bildet eine Reihe seiner Texte einen unentbehrlichen Bestandteil der schulischen Lehrpläne für das Fach Deutsch. In den Curricula für die Sekundarstufe I werden neben ausgewählten Fabeln (vgl. Kap. V.4) mitunter auch amüsante und dabei sowohl in der Form als auch in der Aussage leicht verständliche Gedichte wie z.B. das satirische Lob der Faulheit (1747) aufgelistet. Die Leseempfehlungen für die Sekundarstufe II enthalten immer wieder die Palastparabel aus dem freimaurerisch grundierten Lehrgespräch Ernst und Falk (1778 – 80) über Selbstaufklärung und Emanzipation, die Ringparabel aus Nathan der Weise (vgl. Kap. V.7) sowie dieses Stück insgesamt, außerdem die Komödie Minna von Barnhelm (vgl. Kap. V.5) und das bürgerliche Trauerspiel Emilia Galotti (vgl. Kap. V.6). Zur theoretischen Einführung in Lessings Literaturverständnis werden neben dem 17. der Briefe, die neueste Litteratur betreffend (1759 – 65; vgl. Kap. IV.2) auch einzelne Stücke aus der Hamburgischen Dramaturgie (1767 – 69, vgl. Kap. IV.4) vorgeschlagen. Hinzu kommen in manchen Bundesländern der patriotismuskritische Einakter Philotas (1759; vgl. Kap. V.3), Auszüge aus der ästhetiktheoretischen Schrift Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766; vgl. Kap. IV.3)) sowie das religionsphilosophische Traktat Die Erziehung des Menschengeschlechts (1780). Nicht zuletzt aufgrund seiner Verankerung im Schulstoff ist Lessing auch im Germanistikstudium als Seminar- und Prüfungsthema überaus beliebt. Denn zum einen bringen die Studierenden meistens schon gewisse Vorkenntnisse mit an die Universität, was ihnen den Zugang zu Lessing und seinem Werk erleichtert, und zum anderen halten sie die akademische Beschäftigung mit einem kanonisierten Autor zu Recht für besonders praxisrelevant in Berufsfeldern mit Bildungs- oder Theaterbezug.
Präsenz auf dem Theater
Mindestens ebenso fest wie in der Schule ist Lessing nämlich im Repertoire der Schaubühne etabliert. Seine Dramen besitzen weitgehend unabhängig von Modeerscheinungen wie dem Regietheater eine „nur wenig schwankende Dauerpräsenz“ (Bayerdörfer 2008, 67) auf den Spielplänen der deutschen Bühnenlandschaft. In jeder Saison erfolgen durchschnittlich rund 20 Neuinszenierungen, was insofern bemerkenswert erscheint, als es dabei – von gelegentlichen Ausnahmen abgesehen – nur um fünf Stücke geht, die vier, die auch in der Schule dominieren, dazu Miß Sara Sampson. Was die Häufigkeitsverteilung angeht, stehen dabei Minna von Barnhelm und Emilia Galotti an erster Stelle, gefolgt von Nathan der Weise und Miß Sara Sampson, während Philotas zumindest bis vor kurzem etwas weniger oft gespielt wurde.
Für die jüngste Vergangenheit lässt sich gegenüber den ohnehin beachtlichen Erfolgen eine Zunahme von Lessing-Aufführungen feststellen, was sicherlich durch das Jubiläumsjahr 2004 mit begünstigt wurde, in dem sich Lessings Geburtstag zum 275. Mal jährte. Zu einem sprunghaften Anstieg kam es allerdings bereits seit dem Terroranschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001, in dessen Folge die für eine friedliches Zusammenleben von Islam und westlicher Welt richtungweisenden Fragen von Fanatismus, Interkulturalität und religiöser Toleranz eine historisch neuartige Tragweite erlangt haben. Auffällig erscheint dabei die geradezu programmatische Vorliebe für Nathan der Weise (vgl. ebd.). Offensichtlich unterbreitet dieses Stück mit seinem Entwurf einer universellen Menschheitsfamilie auf der Grundlage von Vernunft und Humanität (vgl. Kap. V.7) immer noch Sinnangebote, die sich in besonderem Maße als gegenwartstauglich erweisen, selbst wenn manche Inszenierungen die versöhnliche Schlussgeste mit desillusionierenden Schock-Effekten durchkreuzen (vgl. Bayerdörfer 2008, 74). Zwei weitere Dramen Lessings – Minna von Barnhelm und Philotas – wurden in letzter Zeit bevorzugt aufgeführt, die mit der Kriegsheimkehrerproblematik bzw. mit den Erwägungen über den Heldentod im Zeichen globaler Konflikte ebenfalls an Aktualität gewinnen.
Lessing-Museen
Nicht von ungefähr bildet das Theater einen Schwerpunkt der Dauerausstellung, die man im Lessing-Museum in Kamenz, also am Herkunftsort des Autors, besichtigen kann. Gezeigt werden dort neben Theatermodellen, Bühnenbildentwürfen und Kostümen auch weitere Gegenstände, die mit Lessings Leben und Werk zu tun haben, sowie Auszüge aus zeitgenössischen Quellen, darunter z.B. die Lebensbeschreibung, die Karl Gotthelf Lessing (1740 – 1812) über seinen Bruder anfertigte. Neben zahlreichen Theaterzeugnissen, Büchern und Kunstwerken umfasst der Sammlungsbestand auch Handschriften, Nachlässe und Materialien, welche die Geschichte der Familie Lessing in Kamenz dokumentieren. In Sonderausstellungen zu bestimmten Themenkomplexen werden immer wieder auch solche Exponate dargeboten, die den Besuchern nicht regulär zugänglich gemacht werden können. Das 1931 eröffnete Museum befindet sich in einem eigens dafür errichteten repräsentativen Zweckbau, da Lessings Geburtshaus 1842 abgebrannt ist. Ein weiteres Lessing-Museum mit 15 Schauräumen gibt es in dem barocken Wohnhaus in Wolfenbüttel, in dem Lessing seine letzten vier Lebensjahre zubrachte. Ausgehend von der Schaffensperiode zwischen 1770 und 1781, während derer Lessing als Bibliothekar des Herzogs von Braunschweig tätig war, widmet sich die Ausstellung seinem Werdegang als Schriftsteller im Zusammenhang mit der Literatur-, Sozial- und Ideengeschichte des 18. Jahrhunderts.
Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption
In Kamenz ist neben dem Museum auch die Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption angesiedelt, die in ihrer jetzigen Organisationsform seit 2006 besteht. Zu den Aufgaben dieser Forschungseinrichtung gehört zum einen die Erschließung und Dokumentation von Lessings Wirkungsgeschichte. Zum anderen besteht ihre Zielsetzung in der öffentlichkeitswirksamen Aufbereitung von Lessings Werk und seinen Deutungen im geschichtlichen Wandel für das kulturelle Leben der Gegenwart. Zu diesem Zweck wird Lessing sowohl in verschieden Veranstaltungstypen wie Vorträgen, Lesungen und Ausstellungen als auch in Publikationen greifbar gemacht, wobei historische (z.B. das Dritte Reich), institutionelle (z.B. die Schule) oder auch mediale (z.B. der Film) Wirkungskontexte gleichermaßen berücksichtigt werden. Auf der teilweise noch im Wachsen begriffenen Internet-Seite der Arbeitsstelle werden aktuelle Publikationen zu Lessing zusammengetragen, darunter neben Textausgaben und Forschungsliteratur auch populärwissenschaftliche Darstellungen. Zusätzlich bietet ein bundesweit angelegter Veranstaltungskalender eine Übersicht der Termine für laufende Inszenierungen von Lessings Bühnenstücken sowie für Vorträge, Tagungen, Ausstellungen und Lehrveranstaltungen, die sich mit Lessing befassen.
Lessing-Akademie Wolfenbüttel
Eine stärkere Forschungsorientierung kennzeichnet die satzungsmäßigen Ziele der 1971 gegründeten Lessing-Akademie mit Sitz in Wolfenbüttel, wenngleich sich ihr Veranstaltungsprogramm mit Ausstellungen, Vorträgen, Lesungen, szenischen Darbietungen und Filmvorführungen ausdrücklich auch an ein weiteres Publikum wendet. Des Weiteren verleiht eine Jury aus den Reihen der Mitglieder den Lessing-Preis für Kritik, mit dem alle zwei Jahre – ein Schriftsteller, Wissenschaftler oder Essayist für besonders gelungene publizistische Stellungnahmen zu gesellschaftlich relevanten Themen ausgezeichnet wird. Die wissenschaftlichen Aktivitäten der Lessing-Akademie finden nicht nur im Rahmen von Konferenzen und Fachvorträgen statt, sondern werden auch in eigenen Schriftenreihen und Katalogpublikationen dokumentiert. Zu den Angeboten auf der Internet-Seite der Lessing-Akademie gehören neben einem nützlichen Figuren-Lexikon zu Lessings Werken und einem Lessing-Quiz vor allem Digitalisierungsprojekte, so etwa eine Online-Ausgabe der als solcher unübertroffenen historisch-kritischen Lessing-Edition von Karl Lachmann und Franz Muncker, die im Druck erstmals 1886 bis 1924 erschien. Lessings Übersetzungen sowie ein sehr umfangreiches Konvolut von Quellenmaterialien zu seiner Wirkungsgeschichte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, das sich im Besitz der Lessing-Akademie befindet, werden derzeit ebenfalls digital erschlossen.
Lessing Society
Als wissenschaftliche Gesellschaft übernimmt schließlich auch die 1966 an der University of Cincinnati ins Leben gerufene Lessing Society wichtige Vernetzungs- und Forschungsaufgaben, die sich sachlich auf Lessing und seine Stellung im weiteren Epochenkontext richten. Unter dem Dach der Gesellschaft entstehen nicht nur Studien zu Lessings Leben und Werk sowie zur deutschsprachigen Aufklärung insgesamt, sondern auch Berichte über den aktuellen Stand der Forschung. Hinzu kommen Vortragsreihen sowie international besetzte Konferenzen, die bislang an verschiedenen Universitäten in Deutschland und Nordamerika stattfanden. Darüber hinaus versucht die Gesellschaft durch die fachliche Zusammenarbeit mit den Forschungseinrichtungen in Kamenz und Wolfenbüttel eine Plattform zu schaffen, auf der wissenschaftliche Ergebnisse ausgetauscht und diskutiert werden können. Seit 1969 gibt die Gesellschaft außerdem das Lessing Yearbook heraus, das sich zwar in erster Linie an eine wissenschaftliche Leserschaft richtet, jedoch auch für Studierende durchaus von Interesse sein kann. Denn dieses Jahrbuch enthält sowohl neueste Aufsätze, in denen eine große Bandbreite von unterschiedlichen Aspekten in Lessings Werk erkundet wird, als auch einen umfassenden Rezensionsteil, der kritisch über wissenschaftliche Neuerscheinungen zu dem Autor und seiner Zeit informiert.