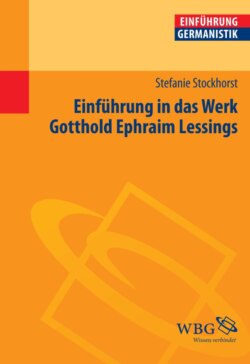Читать книгу Einführung in das Werk Gotthold Ephraim Lessings - Stefanie Stockhorst - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Forschungsbericht
ОглавлениеLessings zentrale Stellung in der Literaturwissenschaft
Am Beispiel Lessings ließe sich ohne Weiteres eine durchaus repräsentative Disziplinen- und Methodengeschichte der germanistischen Literaturwissenschaft schreiben, stellte dieser Autor doch seit ihrer Etablierung als wissenschaftlicher Disziplin zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen Forschungsgegenstand von herausragender Bedeutung dar. So bildete er bereits im 19. Jahrhundert einen zentralen Bezugspunkt für die nationalliterarische, um das Ausfindigmachen von Grundlagen und Gemeinsamkeiten einer deutschsprachigen Kulturtradition bemühte Germanistik. Im Laufe nachfolgender Entwicklungen der Fachwissenschaft dienten Lessings Werke als Projektionsfläche für so unterschiedliche Ideologien wie die des wilhelminischen Kaiserreiches, der Weimarer Republik, des Nationalsozialismus und der DDR (vgl. Kap. VI). Aber auch jenseits ideologischer Vereinnahmungen erweist sich die Lessing-Forschung als ein überaus weitläufiges Terrain. Denn zum einen bietet allein schon die Themen- und Formenvielfalt in Lessings Werk etliche Möglichkeiten für historische oder systematische Untersuchungen. Und zum anderen wurden nahezu alle literaturwissenschaftlich relevanten Schulen und Theorien, darunter etwa – um nur einige Beispiele zu nennen – die Werkimmanenz, die Sozialgeschichte bzw. die Literatursoziologie, die Psychoanalyse, die Semiotik, der Feminismus oder die literarische Anthropologie, erprobt, um den Strukturen und Funktionen seiner Texte auf die Spur zu kommen.
Spezialisierung und Methodenvielfalt seit den 1950er Jahren
Angesichts einer solchen Fülle von Forschungsansätzen, die sich mit Lessing beschäftigt haben, können die nachfolgenden Ausführungen lediglich den Anspruch erheben, eine schlaglichtartige Zusammenschau der wichtigsten Arbeitsgebiete und Tendenzen vorzunehmen. Das Augenmerk liegt dabei auf den letzten rund 60 Jahren, weil in früheren Zeiten noch eine weitgehende Verschränkung von akademischer und populärer Rezeption bestand (vgl. Kap. VI), die sich erst seit der Nachkriegszeit aufgrund von erhöhter fachwissenschaftlicher Spezialisierung und Methodenvielfalt auflöste. Aus diesem Grund werden zunächst die wesentlichen Entwicklungslinien seit den 1950er Jahren des vergangenen Jahrhunderts rekapituliert, um schließlich auf aktuelle Ergebnisse und Perspektiven der letzten zehn Jahre hinzuweisen. Die Zielsetzung einer solchen Überblicksdarstellung besteht darin, eine grundlegende Orientierung auf dem Gebiet der Lessing-Forschung zu geben, die es ermöglicht, einzelne Forschungsbeiträge im Rahmen einer weitergehenden Beschäftigung mit Lessing selbständig in den Forschungskontext einzuordnen.
Werkimmanenz
Nach den fatalen Erfahrungen mit der NS-Ideologie (vgl. Kap. VI) wandte sich die Germanistik der 1950er Jahre mehrheitlich von allen gesellschaftlich-historischen Einflüssen auf die Literatur ab. Die Texte sollten nun vorzugsweise werkimmanent, d.h. als reine, gleichsam frei schwebende Kunstwerke gelesen werden. Während es galt, ihren sprachkünstlerischen Gehalt durch Auslegung und Einfühlung allein aus sich selbst heraus zu erschließen, wurde die Person des Autors ebenso außer Acht gelassen wie der kulturelle, gesellschaftliche und politische Entstehungs- und Wirkungszusammenhang seiner Werke. Eine derart starke Betonung der künstlerischen Autonomie brachte es allerdings mit sich, dass Lessing in der Forschung etwas weniger Beachtung zu Teil wurde als beispielsweise Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832) oder Friedrich Schiller (1759 – 1805). Denn diese Autoren traten ausdrücklich für die Zweckfreiheit der Kunst ein und entsprachen somit in ihrer Ästhetik dem autonomen Kunstverständnis der Werkimmanenz eher als Lessing, der in seinen Texten gezielt menschliche und gesellschaftliche Schwächen vorführte, um sie zu entlarven.
Sozialhistorische Ansätze
Als Gegenreaktion auf diese im philologischen Detail zwar sehr genaue, aber letztlich einseitige Herangehensweise kamen – im Anschluss an richtungweisende Arbeiten aus dem Bereich der Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften – seit den 1960er Jahren und verstärkt in den 1970er Jahren sozialhistorische bzw. literatursoziologische Ansätze auf. Entscheidende Impulse für die literaturwissenschaftliche Aufklärungsforschung gingen dabei etwa von Jürgen Habermas und Reinhart Koselleck aus, die sowohl das gesellschaftliche Rahmengefüge als auch das Selbstverständnis der bürgerlichen Emanzipationsbestrebungen untersucht hatten. Ohne Fragen der Gattungs-, Stil- oder Motivgeschichte völlig aus dem Blick zu verlieren, widmete sich die Literaturwissenschaft nun zunehmend der Produktions- und Wirkungsästhetik. Die Rückbindung von Lessings Werken an ihre geschichtlichen Voraussetzungen wurde beispielhaft durch Wilfried Barner, Gunter E. Grimm und Helmuth Kiesel vorangetrieben (vgl. Barner u.a. 1998). Dabei ging es nicht nur darum, insbesondere Lessings Dramen auf ihren historischen Realitätsgehalt hin abzuklopfen, sondern auch um literarische Strategien, mit denen aufklärerische Problemlagen und Wertediskurse verhandelbar gemacht wurden. Außerdem verhalfen Rezeptionsstudien etwa anhand von Spielplänen sowie der Vergleich mit dem dramatischen Schaffen seiner Zeitgenossen zu der Einsicht, dass es sich bei Lessing um einen Ausnahmedramatiker handelte, dessen bürgerliche Trauerspiele einen ästhetischen Höhenkamm darstellten, während ansonsten erheblich schlichtere Stücke mit eindeutigen Belohnungs- und Vergeltungsstrukturen vorherrschten (vgl. Mönch 1993).
Feministische Ansätze
Feministische Forschungsansätze, die – wiederum ausgehend von den Sozialwissenschaften – in den Philologien seit den 1980er Jahren verstärkt an Bedeutung gewonnen haben, verfolgen das hauptsächliche Anliegen, unterschiedliche, oftmals vergessene oder verschwiegene Formen von Weiblichkeit in der Literaturgeschichte sichtbar zu machen. Sie untersuchen unter anderem die Darstellung von weiblichen und männlichen Figuren in den Texten auf die literarische Konstruktion von Geschlechterrollen (engl.: gender) hin. In geradezu mustergültiger Weise lassen sich die Geschlechterverhältnisse im bürgerlichen Trauerspiel nachvollziehen, das von Lessing als Gattung im deutschen Sprachraum maßgeblich geprägt wurde (vgl. Kap. V.6). Während Trauerspiele bis dahin üblicherweise von historisch-politischen Themen handelten, kommen im bürgerlichen Trauerspiel vorrangig Konflikte aus dem Bereich des Privatlebens zur Sprache, so dass die Konstellationen von Ehe und Familie hier eine zentrale Bedeutung erlangen. So analysieren einschlägige Forschungsarbeiten, darunter etwa diejenigen von Karin A. Wurst (vgl. Wurst 1988) und Brita Hempel (vgl. Hempel 2006) die Umsetzung geschlechtsspezifischer Machtpositionen sowie patriarchalisch kodierter Verhaltensmuster und Normen in Lessings Dramen. Auf dieser Grundlage tragen sie dazu bei, literarische Reflexe historischer gender-Konstruktionen und der aus ihnen erwachsenden gesellschaftlichen Handlungsspielräume aufzudecken.
Literarische Anthropologie und Literaturpsychologie
In den ausgehenden 1980er Jahren kamen ferner erstmals Arbeiten auf, die ihre Aufmerksamkeit im Zeichen einer anthropologischen Wende auf den ,ganzen Menschen‘ (Hans-Jürgen Schings) richteten. Diese diskursgeschichtlich orientierte Strömung, die in den 1990er Jahren außerordentlich einflussreich geworden ist, interessiert sich – vereinfacht gesagt – dafür, wie nach dem einseitigen Rationalismus der Frühaufklärung in der Folgezeit ein weiter dimensioniertes Menschenbild entstand. Berücksichtigt wurden dabei nun auch die Konsequenzen von Körperlichkeit und Sinnlichkeit für alle menschlichen Lebensbereiche, darunter nicht zuletzt die ästhetischen Ausdrucksformen der Künste (vgl. Alt 2007). Durch entsprechende Fragestellungen konnten in der Lessing-Forschung z.B. von Karl S. Guthke und anderen bereits seit Mitte der 1960er Jahre, wenngleich noch nicht eingebettet in ein umfassendes Forschungsprogramm (vgl. Košenina 1995), entscheidende Einsichten gewonnen werden. Gezeigt werden konnte dabei etwa, dass zum einen sowohl Lessings Mitleidsästhetik (vgl. Kap. IV.4) als auch seine vergleichende Theorie der Künste auf der Vorstellung einer anschauenden Erkenntnis gründet, die nicht in erster Linie über Begriffe, sondern über Sinneseindrücke vermittelt ist (vgl. Kap. IV.3). Zum anderen lässt sich auch die Figurenkonzeption in seinen großen Dramen, in der höchst vielschichtige und teils sogar widersprüchliche Haltungen erkennbar werden, vor dem Hintergrund einer komplexeren Auffassung menschlicher Gefühlswelten historisch genauer plausibilisieren. Durch literaturpsychologisch ausgerichtete Studien, die sich punktuell mit der literarischen Anthropologie berühren, erfolgten daher ebenfalls Hinweise auf Strukturen von unterdrückter Sinnlichkeit in Lessings Werken. Erste systematische Untersuchungen zum Verhältnis von Vernunft- und Triebnatur in Lessings Dramen stellte insbesondere Albert M. Reh an (vgl. Reh 1981).
Vom Kontext zum Text
Parallel zu den fortgesetzten sozial- und diskursgeschichtlichen Studien wächst bereits seit den 1980er Jahren das wissenschaftliche Interesse an der Literarizität von Lessings Texten, d.h. an ihren spezifisch ästhetischen Eigenheiten. Diese Akzentverschiebung vom Kontext zurück zum Text mag zum einen als Reaktion auf die mitunter recht textfern argumentierende Literatursoziologie verstanden werden, hat aber zum anderen möglicherweise auch zu tun mit der Wiederentdeckung der Rhetorik als Gestaltungs- und Wirkungsprinzip für die Literatur bis weit ins 18. Jahrhundert hinein. Jedenfalls wurde durch die genaue Untersuchung textueller Strategien das traditionelle Vorurteil von Lessing als ,unpoetischem Autor‘, eine Zuschreibung, die sich schon in den Einschätzungen der Romantiker abgezeichnet (vgl. Kap. VI) und seither hartnäckig gehalten hatte, erfolgreich hinterfragt. Infolge dieser Neubewertung beobachtet Monika Fick zutreffend, dass zu Lessing nunmehr „eine ausgesprochen lebendige Tradition philologischer Forschung, Erschließung neuer Quellen und Rekonstruktion historischer Kontexte“ bestehe (Fick 2010, 11). Über Lessings eigene Ästhetik konnte darüber hinaus ein Zugang über die Semiotik näheren Aufschluss geben. So wies namentlich David E. Wellbery in seiner Studie zu Laokoon (vgl. Wellbery 1984) darauf hin, dass Lessing zur Abgrenzung der Künste mit einem zeichentheoretischen Modell arbeitet, welches sowohl das Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit als auch das Verhältnis der Künste untereinander beschreibt.
Aktuelle Entwicklungen
Die Lessingforschung der 1990er Jahre bis in die Gegenwart kennzeichnet sich zum einen durch die Pluralisierung von Erkenntnisinteressen und Methoden sowie zum anderen durch eine Hinwendung zur „Detailforschung“ (Fauser 2006, 14). Besondere Aufmerksamkeit erfahren dabei grenzüberschreitende Aspekte in Lessings Werk, sei es in transdisziplinärer oder interkultureller Hinsicht. So wurden in jüngster Zeit vermehrt Texte wie beispielsweise die Rettungen oder die theologiekritischen Schriften (vgl. Vollhardt 2002; Bultmann/Vollhardt 2011), aber auch Lessings Verhältnis zur Haskala, d.h. zur jüdischen Aufklärung (vgl. Lauer 1998), untersucht. Gegenstände, die sich schon länger im Blickfeld der Forschung befinden, gewinnen durch neuere Arbeiten ebenfalls an Tiefenschärfe. So beleuchtete etwa Daniel Fulda den hohen Stellenwert des Ökonomischen in den Lustspielen Lessings und anderer Autoren im Bedingungsgefüge der neuzeitlichen Marktgesellschaft (vgl. Fulda 2005, 481 – 509), während Lessings Fabeln sowohl gattungsgeschichtlich als auch poetologisch immer genauer verortet wurden (vgl. von Treskow 2000; Ter-Nedden 2010). Darüber hinaus wird Lessings Übersetzertätigkeit seit einiger Zeit nicht nur analytisch (vgl. Glowski-Braungart 2005; von Bertold 2008), sondern auch editorisch bearbeitet. In einem umfangreichen, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekt mit dem Titel „Lessings sämtliche Übersetzungen und ihre Originale“ werden an der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel derzeit nach und nach Lessings Übersetzungen in absatzweiser synoptischer Gegenüberstellung mit den fremdsprachigen Vorlagen erschlossen und im Internet zugänglich gemacht.
,Grenzen‘ und ,Skandale‘
Als gemeinsame Tendenz zahlreicher Arbeiten der jüngsten Lessingforschung – Hugh B. Nisbets vielbeachtete Analyse der Verschränkung von Lessings Biographie mit seinem Œuvre (vgl. Nisbet 2008) eingeschlossen – lässt sich eine Abkehr von der stillschweigend vorausgesetzten, latent angestaubten Klassikerverehrung feststellen. Stattdessen wird die Aussagekraft der Imperfektionen und Risse in Lessings Leben und Werk erkundet. Stellvertretend kann einerseits der von Ulrike Zeuch herausgegebene Sammelband mit dem Titel Lessings Grenzen (2005) angeführt werden. Im Fokus stehen dort „zum einen die von ihm selbst markierten Grenzen, zum anderen die seiner Zeit als verbindlich geltenden Grenzen sowie schließlich die Grenzen seiner Position im Sinne begrenzter Gültigkeit“ (in Zeuch 2005, 7). Andererseits ist die von Jürgen Stenzel und Roman Lach herausgegebene Aufsatzsammlung Lessings Skandale (2005) zu nennen. Die darin gewählte Herangehensweise habe, wie im Vorwort versichert wird, „nichts mit Bilderstürmerei, Kammerdienerperspektive und Entmythologisierung zu tun“. Vielmehr gehe es darum, anhand besonders aussagekräftiger Einzelfälle, eben anhand seiner ,Skandale‘, die Dominanzverhältnisse, Konfliktpotentiale und Interessenlagen deutlich zu machen, die Lessings Schaffen prägten. Denn: „Was Anstoß erregt und als öffentliches Ärgernis wahrgenommen wird, verdeutlicht meistens die Frontlinien, welche die beteiligten Parteien trennen, und zeigt Rivalitäten und Machtkämpfe; die damit verbundenen Kontroversen, der Ruf nach der Zensur oder dem Staatsanwalt erregen Emotionen und stacheln die polemische Argumentation an.“ (Stenzel/Lach 2005, VIII). Bei den in diesem Sammelband untersuchten Gesichtspunkten handelt es sich um Lessings streitlustiges Eintreten für Außenseiter (Hugh Barr Nisbet), um seine Fluchten (Wilfried Barner; vgl. Kap. III.1), um den Fragmentenstreit (Burckhardt Dücker; vgl. Kap. IV.1) sowie um seine Spielsucht (Roman Lach, Nicola Kaminski; vgl. Kap. III.1).