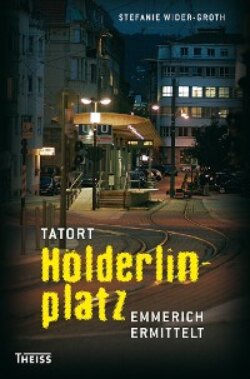Читать книгу Tatort Hölderlinplatz - Stefanie Wider-Groth - Страница 13
5
ОглавлениеSie war zufrieden mit sich selbst. Der Hauptkommissar gehörte zu den älteren Semestern, keiner, der sich unnötige Arbeit aufhalsen würde, indem er in den Privatangelegenheiten von Leuten herumschnüffelte, die mit seinem Fall nur am Rande zu tun hatten. Eleonore Schloms glaubte, ihn davon überzeugt zu haben, dass sie eine solche Person war. Sie hatte schlichte Kleidung gewählt, eine billige Glasperlenkette, die Haare im Nacken mit einem Gummiband zusammengefasst. Mit einer Mischung aus höflichem Interesse und gespielter Zurückhaltung hatte sie zu Protokoll gegeben, Frau Diebold kaum zu kennen, was nicht ganz den Tatsachen entsprach, und keine besonderen Beobachtungen gemacht zu haben. Nach ihren persönlichen Verhältnissen befragt, hatte sie erklärt, in ihrem angestammten Beruf als Versicherungskauffrau keine Arbeit mehr zu finden, weshalb sie sich notgedrungen als Lebensberaterin durchschlage. Dem Gesichtsausdruck des Kommissars konnte Eleonore entnehmen, dass er derartige Dienstleistungen für überflüssig hielt, was sie nicht überraschte, sondern erhofft hatte. Nach einer knappen Dreiviertelstunde durfte sie ihre Aussage, deren Niederschrift ihr von einer älteren Schreibkraft in einem schauderhaften, braunen Strickensemble vorgelegt worden war, unterschreiben und wieder gehen. Sie verließ das Polizeipräsidium zu Fuß, bestellte sich einige Meter hinter der Schranke ein Taxi und ließ sich zum Hölderlinplatz bringen. Der Fahrer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit die Stresemannstraße entlang, die sich durch den begonnenen Abriss des alten Messegeländes am Killesberg auf wundersame Weise von einem neuralgischen Engpass in einen breiten Boulevard verwandelt hatte. Es ist schon komisch, dachte Eleonore beim Betrachten der ausgedienten Hallen, wie die hier frei werdenden Grundstücke so vergeben werden – ein Prozess, von dem jeder durchschnittliche Leser einer Tageszeitung wusste, dass er gegenwärtig noch in vollem Gange war. Sozusagen im Handstreich war der Gemeinderat vor die Tatsache gestellt worden, dass sich das Augustinum eines der Filetstücke zwecks Neubau eines Altenheimes für betuchte Senioren in bester Lage gesichert hatte. Auf dem ehemaligen Parkplatz sollte eine Modemeile entstehen, mit der die Nachbarstadt Sindelfingen wenig einverstanden war, befürchtete sie doch unnötige Konkurrenz für die eigenen Hallen und das, obwohl doch angeblich in der Wirtschaftsregion Stuttgart alle an einem Strang zum Wohle sämtlicher Beteiligten zogen. Lange Zeit war von Wohnbebauung, Familienfreundlichkeit und Mehrgenerationenprojekten die Rede gewesen, die Kulturmenschen der Stadt waren nach ihren Bedürfnissen gefragt worden, das Congresszentrum B, das für Konzerte genutzt wurde, sollte erhalten werden. Alles Schnee von gestern, befand Eleonore, seit wann bringen Familien oder Künstler Geld ein und außerdem geht’s ja auch ums Prestige, dies hier ist schließlich eine der besten Lagen in der Stadt. Und sie wusste auch schon, was als Nächstes kam. Nicht, weil sie es sich ohnehin hätte denken können, sondern weil der Einladung auf cremeweißem Büttenpapier, die sie von Frau Winkler erhalten hatte, ein Faltblatt beigefügt war, betitelt mit der wenig originellen Floskel „Abenteuer Wachstum – Killesberg and more.“ Es zeigte eine futuristisch anmutende Computerlandschaft mit zahlreichen Gebäuden und einem verglasten Hochhaus in der Mitte. Auch das fand Eleonore nicht besonders originell. Glasfassaden waren die Mode der Zeit, jeder Neubau bekam eine, wollte man einen Unterschied zwischen all diesen gläsernen Uniformitäten entdecken, musste man schon hinter die Fenster schauen. Dem Faltblatt war weiterhin zu entnehmen, dass der Killesberg die besten Voraussetzungen für die Errichtung eines Eventcenters bot. Eleonore erinnerte sich, von einem Silver-Ager-Adventure-Park, einer Wellness-Mall, einem Shoppingzentrum und anderen denglischen Wohltaten gelesen zu haben. Am Mittwoch sollte dieses Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt werden, begleitet von einem sogenannten „Come together“ mehr oder weniger bekannter Persönlichkeiten in eben jenem, nun doch todgeweihten Congresszentrum B. Und das Schicksal wollte es, dass sie auf dieser Party anwesend zu sein hatte. Eleonore hasste derartige Veranstaltungen vermeintlich wichtiger Wichte, doch sie wollte Frau Winklers Ansinnen nicht ablehnen. Christine Winkler war nicht nur ihre Vermieterin, sondern besaß auch das, was Eleonore einen miesen Charakter nannte. Obwohl nach außen stets freundlich und verbindlich, kannte sie die anderen Seiten ihrer Kundin, die launisch, rachsüchtig und in geschäftlichen Dingen knallhart auf den eigenen Vorteil bedacht war. Frau Winkler gegen sich zu haben, hätte aller Voraussicht nach einen Umzug ihrer diskreten Beratungsstelle erforderlich gemacht und womöglich noch weit unangenehmere Folgen gezeitigt. Eleonore würde also zu dieser Party gehen, sich die Reden anhören und dabei den Mann beobachten, von dem Frau Winkler wünschte, dass sie sich ein Bild von ihm machen solle.
Das Taxi bremste jäh ab, um der Radarfalle am Kräherwald zu entgehen und riss Eleonore aus ihren Gedanken. Den Rest der verbliebenen, nunmehr nur noch kurzen Fahrt verbrachte sie mit Überlegungen hinsichtlich der für das Ereignis zu wählenden Garderobe. Beim Verlassen des Wagens bemerkte sie Hauptkommissar Emmerich, der einem anderen Taxi entstieg und in der Bankfiliale verschwand. Dies kam Eleonore nun mehr als ungelegen. Sie eilte ins Haus und in den zweiten Stock hinauf, schloss die Tür und dachte nach. Des Kommissars wegen hatte sie bereits ihren ersten Vormittagstermin verschieben müssen, der zweite stand unmittelbar bevor und war mit einer Kundin von halbseidener Prominenz vereinbart. Das Gesicht der Inhaberin eines in den einschlägigen Kreisen sehr geschätzten Nachtklubs war der Polizei sicherlich wohlbekannt und passte auch nicht ins Bild einer nur gezwungenermaßen als Lebensberaterin tätigen Versicherungskauffrau. Schweren Herzens griff Eleonore zum Telefon und vertröstete auch diese, im Allgemeinen höchst lukrative Dame auf einen späteren Zeitpunkt. Als sie dem Kommissar zum zweiten Mal an diesem Tag begegnete, war sie auf hausfrauliche Art damit beschäftigt, den Papiermüll die Treppe hinunterzutragen. Vor der grünen Tonne im Hinterhof stand der junge Mann, mit dessen Beobachtung Christine Winkler sie beauftragt hatte. Es war nichts Außergewöhnliches an ihm, Eleonore fragte sich, weshalb er das Winkler śche Interesse erweckt hatte und grüßte. Der junge Mann betrachtete sie flüchtig von oben herab, murmelte etwas Unverständliches und verschwand wieder im Haus.
***
Emmerich wartete, bis Mirko Frenzel das polizeiliche Siegel von der Wohnungstür entfernt und diese geöffnet hatte. Er ließ den Kollegen den Vortritt, sog prüfend die Luft ein und öffnete trotz der Kälte einige Fenster.
„Igitt“, sagte Gitti Kerner. „Man hat mir gesagt, dass es stinkt, aber so übel hab ich mir ś nicht vorgestellt.“
„Da müssen Sie durch.“ Frenzel kehrte zu Emmerichs Belustigung den erfahrenen Beamten heraus, obwohl er seiner Schätzung nach mindestens fünf oder sechs Jahre jünger als die Hauptkommissarin sein musste. Kerner schlich auf Zehenspitzen durch die Wohnung und betrachtete die zahlreich vorhandenen Zeitungsausschnitte.
„Sie können sich ganz normal bewegen“, sagte Emmerich. „Die Spurensicherung ist fertig. Finden Sie mal raus, ob sich die alte Dame für irgendwas im Speziellen interessiert hat.“
Die Leidenschaft, die alte Menschen für das Sammeln im Allgemeinen und von Zeitungen im Besonderen entwickeln konnten, war für Emmerich nichts Neues. Auch die Tücken dieser Leidenschaft waren ihm bekannt, weshalb er hinzusetzte:
„Aber seien Sie vorsichtig. Zwischen dem Papier kann überall Geld versteckt sein.“
Er selbst schlenderte gemächlich durch die Wohnung und versuchte, sich ein Bild von der lebenden Gertrud Diebold zu machen. Sie war keine vermögende Frau gewesen, so viel hatte er in der benachbarten Bankfiliale erfahren. Ordentlich, aber nicht pedantisch, schloss er aus der Art, wie sie die Dinge des täglichen Bedarfs aufbewahrte. Kein benutztes Geschirr in der Küche, alles war säuberlich auf ein Abtropfgitter gestapelt. Emmerich zählte einen flachen und einen tiefen Teller, einen Topf, eine Pfanne, zwei Gläser, drei Tassen, drei Untertassen und etwas Besteck. Hinter dem Abtropfgitter stand eine angebrochene Flasche Eierlikör. Im dritten Zimmer, das Emmerich am Vortag unberücksichtigt gelassen hatte, fand er ein unbenutztes Stockbett und nahm an, dass hier Ralph und der verreiste Herbert aufgewachsen waren. Nach dem Auszug ihrer Kinder musste Frau Diebold den Raum als Rumpelkammer genutzt haben, Emmerich sah alte Schränke und Koffer, ein Bügelbrett, einen Staubsauger, Blumentöpfe, vertrocknete Kakteen, ein leeres Aquarium und eine Schneiderpuppe. Er ging zurück ins Wohnzimmer. Kerner sortierte Zeitungsausschnitte, Frenzel blätterte in einem alten Leitz-Ordner. Auf dem Tisch lagen drei Fünfzig-Euro-Scheine.
„Sie hat tatsächlich Geld versteckt“, sagte Kerner.
„Oder vergessen. Protokollieren Sie, was Sie finden, ich will keinen Ärger mit Ralph und seinem Bruder. Da können recht nette Summen zusammenkommen.“
Frenzel klappte den Mund auf und schloss ihn wieder. „Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Was glaubst du, wie lange sie das schon so gemacht hat? Wir haben Wichtigeres zu tun, als alte Zeitungen nach Spargroschen zu durchsuchen.“
„Völlig deiner Meinung.“ Emmerich nickte zustimmend. „Wir konzentrieren uns auf das, was aktuell aussieht. Über den Rest spreche ich mit dem Chef. Habt ihr beim Zahnarzt und der Fußpflegerin was herausbekommen?“
Frenzel hob den Blick von seinem Ordner. „Bei Dr. Riesling war sie Patientin. Ein bemerkenswert intaktes Gebiss, Zitat Ende. Ansonsten wurde übers Wetter gesprochen.“
„Die Fußpflegerin hat sie gar nicht gekannt.“ Kerner legte mehrere Ausschnitte auf ein Häufchen. „Sie ist aber auch erst seit einem halben Jahr im Haus.“
Emmerich öffnete nebenbei die Türen der Schrankwand, sah hinein und schloss sie wieder. Dahinter verbarg sich, was Schränke eben so enthielten. Gläser, ein Kaffeeservice, von dem er annahm, dass es sich dabei um „das Gute“ handelte, Kerzenständer, Vasen und – dies entlockte ihm ein Grinsen – die Hausbar mit allerlei Likörchen und einer Flasche Klosterfrau Melissengeist.
„Dann mache ich jetzt oben weiter“, sagte er in den Raum hinein. „Wer will mit?“
Das zweistimmige „Ich“ hatte er erwartet.
„Frau Kerner... eh... Gitti braucht etwas Praxis“, entschied er. „Mirko bleibt hier. Falls jemand kommt, der Frau Diebolds Putzhilfe sein könnte, rufst du mich bitte.“
Frenzel nickte gelangweilt und blätterte weiter. Im vierten Stock klingelte Emmerich an der Tür von Panagiotis und Sophia Georgiadis. Eine kleine, weißhaarige Frau öffnete. Sie lächelte überaus freundlich, beantwortete jede Frage mit „Ne“ und bedeutete ihnen, ins Wohnzimmer zu gehen, wo sie auf einen alten Mann wies, „Panagiotis“ sagte und sich auf ein Sofa setzte.
„Bitte entschuldigen Sie, dass ich nicht aufstehe“, sagte der alte Mann mit einem allenfalls schwachen Akzent. „Ich hatte einen Schlaganfall und habe einen künstlichen Darmausgang.“
„Viele Ouzo“, warf die Frau ein. Ihr Mann beachtete sie nicht.
„Meine Frau spricht nur wenig Deutsch. Was möchten Sie wissen?“
Emmerich erklärte die Umstände und stellte die üblichen Fragen. Das Ehepaar Georgiadis wohnte seit über zwanzig Jahren im Haus, selbstverständlich, in dieser langen Zeit, da kannte man sich schon, wenn auch nicht besonders gut. Früher, erklärte Herr Georgiadis, ohne näher zu erläutern, was genau darunter zu verstehen war, früher hatte es gelegentlich Meinungsverschiedenheiten mit Frau Diebold gegeben, insbesondere dann, wenn Familienfeiern zu laut abliefen.
„Wir Griechen feiern gerne“, fügte er verschmitzt hinzu und bekam einen Hustenanfall.
„Viele Karelia“, ergänzte seine Gattin trocken.
In letzter Zeit, genauer gesagt seit ungefähr fünf Jahren, war nichts mehr vorgefallen. Herr Georgiadis verließ das Haus nur noch, um Besuche beim Arzt zu machen, er trinke aber dennoch täglich immerhin ein Glas Wein.
„Viele Demestika“, kicherte es vom Sofa. Herr Georgiadis sagte streng etwas Griechisches und das Kichern verstummte.
„Möchten Sie Kaffee?“, bot er höflich an. „Meine Frau kann welchen machen.“
Emmerich schüttelte den Kopf. „Nicht nötig, vielen Dank. Nur noch eine Frage, hören Sie es, wenn in Frau Diebolds Wohnung der Fernseher läuft?“
„Meine Ohren sind nicht mehr, was Sie einmal waren.“
„Und Ihre Frau?“
„Meine Frau versteht Ihre Frage nicht.“
„Würden Sie dann freundlicherweise...“
„Ich hören“, erklärte Frau Georgidias und schickte ihrem Einwurf einen Schwall griechischer Worte hinterher.
„Sophia sagt, der Fernseher ist mehrere Tage gelaufen. Bis gestern.“
„Weiß sie, seit wann?“ Emmerich sah die kleine Frau, die unter seinem Blick noch kleiner zu werden schien, gespannt an.
„Sophia sagt“, übersetzte Herr Georgiadis, „sie hat am Donnerstagnachmittag gebügelt. Erst war nichts zu hören, dann leise, dann lauter. Die Nachrichten um fünf. So ist es geblieben.“
„Und das hat Ihre Frau nicht gestört?“, fragte Gitti Kerner erstaunt.
„Man hört nur in Küche“, antwortete Frau Georgiadis selbst. „Nix so schlimm.“
Emmerich bedankte sich und reichte dem alten Mann eine Karte.
„Wenn Ihnen noch was einfällt, rufen Sie mich bitte an.“
Die kleine Frau begleitete sie hinaus.
„Was für ein Macho“, empörte sich Gitti Kerner, kaum dass sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte. „Ruiniert sich die Gesundheit, lässt sich von der Frau versorgen und hält sie auch noch unter der Knute.“
„Es sind Griechen“, sagte Emmerich nachsichtig. „Außerdem sind sie alt. Die werden Sie nicht mehr ändern. Seien Sie froh, dass sie überhaupt etwas gesagt haben, viele ausländische Mitbürger sind uns gegenüber sehr zugeknöpft. Wer ist der Nächste?“
„Zumbach“, las Kerner vom Schild neben der gegenüberliegenden Wohnung ab und drückte auf die Klingel. Eine Männerstimme hinter der Tür sagte „Ja, bitte“ und nach einer kurzen Pause „Arschlöcher“.
„Der denkt, wir machen Klingelputz“, zwinkerte Emmerich, seiner eigenen Jugend gedenkend und klopfte.
„Herrgott noch mal.“ Die Tür wurde aufgerissen. „Ich kaufe nichts und ich abonniere auch keine Zeitung.“ Der das sagte, war ein junger Mann von etwas über dreißig Jahren. Emmerich nahm an, dass er sich für gut aussehend hielt.
„Wir sind von der Kriminalpolizei, Herr Zumbach“, sagte er sachlich. „Ja, und?“ Der junge Mann schien, zumindest was seinen Tonfall anging, keine Unterschiede zwischen den Angehörigen einer Drückerkolonne und einem Staatsbediensteten zu machen. Emmerich blieb dennoch höflich.
„Wir würden uns gerne mit Ihnen unterhalten.“
„Warum?“
„Kennen Sie Frau Diebold?“
„Nein.“
„Sie wohnt ein Stockwerk tiefer.“
„Ich kenne niemand in diesem Haus, ich wohne erst seit vier Wochen hier.“
„Und wo haben Sie vorher gewohnt?“
„Hören Sie mal.“ Der junge Mann sah von Emmerich zu Kerner, die er abschätzig musterte und dann wieder zu Emmerich. „Was sollen diese Fragen?“
„Wir sind von der Polizei, Herr Zumbach“, sagte Emmerich stoisch.
„Wir machen das beruflich. Und Sie beantworten diese Fragen jetzt bitte.“
„Was passiert, wenn ich ś nicht tue?“
„Dann, Herr Zumbach, wären wir wohl gezwungen, Sie mitzunehmen.“
Der störrische Ausdruck im Gesicht des jungen Mannes, das nach Emmerichs Ansicht für die Jahreszeit unnatürlich stark gebräunt war, änderte sich nicht. Dennoch schienen seine Worte nicht gänzlich ohne Wirkung geblieben zu sein, denn er verkniff sich eine weitere patzige Bemerkung.
„Also noch mal“, startete Emmerich einen weiteren Versuch. „Wo haben Sie vorher gewohnt?“
„In Berlin.“
„In Berlin, soso.“ Emmerich verfiel in ein bedeutungsschwangeres Schweigen, von dem er hoffte, dass es sein Gegenüber nervös machen würde. Der junge Mann schwieg jedoch eisern zurück, und es war Gitti Kerner, die sich, Emmerichs Taktik unwissentlich durchkreuzend, einmischte.
„Haben Sie in den letzten Tagen etwas Ungewöhnliches im Haus bemerkt?“
Erneut traf sie ein geringschätziger Blick, die Antwort hatte einen spöttischen Unterton.
„Nicht, dass ich wüsste, junge Frau. Was hätte ich denn bemerken sollen?“
„Die Fragen stellen wir, Herr Zumbach“, riss Emmerich das Wort wieder an sich, bevor Kerner ein weiterer Fauxpas unterlaufen konnte. „Wo waren Sie letzten Donnerstag?“
„Was soll das? Brauche ich ein Alibi? Wofür?“
„Beantworten Sie einfach meine Frage.“
„Nicht, solange ich nicht weiß, worum es geht.“
„Ihre Nachbarin wurde tot aufgefunden. Wir fragen alle Hausbewohner dasselbe.“
Zumbach schob die Hände in die Taschen seiner grauen Jogginghose.
„Donnerstag, sagten Sie?“
„Donnerstag“, nickte Emmerich bestätigend.
„Da müsste ich nachdenken.“
„Tun Sie das“, entgegnete Emmerich und fügte in Gedanken hinzu: Falls das Hirn dafür ausreicht.
„Donnerstag“, wiederholte Zumbach versonnen und ließ sich Zeit. „Da war ich vormittags in einer Sitzung, anschließend geschäftlich unterwegs und abends bei meiner Großmutter zu Besuch.“
„Was machen Sie beruflich?“
„Ich bin selbstständig. Medienberatung und Eventmanagement.“
„Interessant“, sagte Emmerich und überlegte, ob es sich bei Ersterem um eine zeitgemäße Bezeichnung für jemanden handelte, der Fernseher verkaufte.
„Hochinteressant“, bestätigte Zumbach. „Sie glauben gar nicht, wen man da alles so kennenlernt.“
Emmerich spürte die versteckte Drohung mehr, als er sie hörte. „Wie schön für Sie“, sagte er bedächtig. „Falls wir konkretere Angaben brauchen, melden wir uns wieder.“
Zumbachs akkurater, blonder Kurzhaarschnitt geriet etwas aus der Form, als sein Besitzer den Kopf zurückwarf.
„Das wird kaum nötig sein, nehme ich an. Guten Tag.“
Emmerich hielt einen kurzen, dezidierten Vortrag über die Bedeutung des Schweigens und seine Wirkungen, während er mit Kerner eine Treppe höher stieg. Vor der nächsten Wohnungstür fiel ihm trotz der langen Haare auf, dass die Kollegin rote Ohren hatte. Bei Niklas Munz klingelten sie vergeblich. Emmerich zückte eine Visitenkarte, notierte „Bitte rufen Sie mich an“ darauf und klemmte die Karte hinter einen Aufkleber an der Tür, der ein durchgestrichenes Hakenkreuz zeigte.
„Was halten Sie von unserem Fernseherverkäufer?“, fragte er, als sie den Weg nach unten antraten.
„Fernseherverkäufer?“ Kerner sah ihn erstaunt an.
„Medienberater“, korrigierte sich Emmerich und vernahm ein unterdrücktes Kichern. „Was ist so komisch?“
„Ein Medienberater verkauft keine Fernseher.“
„Was dann? Computer?“
Kerner schüttelte den Kopf und grinste. „Sendezeiten. Zum Beispiel.“
„Sendezeiten?“
„Wenn Sie nicht wissen, ob Sie für ein neues Handy besser im Nachmittagsprogramm oder nach den Spätnachrichten werben sollen, dann fragen Sie Ihren Medienberater.“
„Na“, sagte Emmerich, hoffend, das seine Ohren nicht verrieten, wie blamiert er sich fühlte, „dann bin ich aber froh, dass ich keine Handys loswerden muss. Weil ich dann nämlich so einen wie den nicht brauche.“
„Er ist ein Schönling“, meinte Kerner. „Zweimal die Woche Solarium und bestimmt auch in der Muckibude.“ Sie gewahrte Emmerichs Blick und fügte „Fitness-Studio“ hinzu. Für den Bruchteil einer Sekunde fühlte Emmerich sich alt. Er kannte dieses Gefühl, es war schleichend zu ihm gekommen, irgendwann in der Mitte seines vierten Lebensjahrzehntes, hatte sich eingenistet und war zu einem ständigen Begleiter geworden, dessen Anwesenheit noch nicht unangenehm, aber dennoch lästig war. Er beschloss, seine Frage nach den genauen Aktivitäten eines Eventmanagers zu verschieben und sagte stattdessen:
„Jetzt ist nur noch die Psychologin übrig.“
„Frau Sorrentin hat erst am späten Nachmittag für uns Zeit.“
„Dann schlage ich vor, dass wir Mittag machen und den armen Mirko erlösen.“