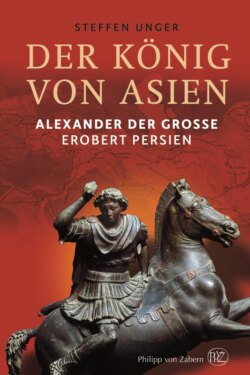Читать книгу Der König von Asien - Steffen Unger - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Austausch auf gigantischer Ebene
ОглавлениеNeben den „globalen“ geistig-ideologischen Nachwirkungen Alexanders hatte dessen rund elfjähriger Feldzug ins Zweistromland, nach „Indien“ und zurück nach Babylon selbst erhebliche politische, wirtschaftliche und ethnische Auswirkungen auf Morgen- und Abendland. Wenngleich nicht aus wahrem Respekt, sondern eher aus Zweckmäßigkeit überging Alexander die bei den Griechen – und später generell im Westen – weit verbreitete Abneigung gegenüber den orientalischen Völkern und setzte recht erfolgreich, teilweise aber auch vergeblich auf Kooperation mit den dortigen Eliten.
Mit der Wertschätzung der „Barbaren“ („Nichtgriechen“) setzte er das Vertrauen seiner Landsleute ihm gegenüber aufs Spiel. Der überwiegende Teil von ihnen, darunter viele seiner Offiziere, lehnte die administrative Einbeziehung der Perser und die von ihm praktizierten orientalischen Sitten ab.
Die Eroberung des riesigen Reichs und die Erschließung von dessen Südküste ermöglichte und bewirkte in den folgenden Jahrhunderten einen immensen Personen-, Güter-, Kultur- und Wissensaustausch zwischen Europa, Asien und Nordafrika, wovon Orient und Okzident profitierten. Das gilt vor allem für die Zeit nach Alexanders frühem Tod, denn das riesige Vielvölkerreich war alles andere als konsolidiert. Seine eigenen Städte- und Militärpostengründungen, die er zumeist im heutigen Afghanistan und Pakistan errichten ließ, scheinen eher von geringer Lebensdauer gewesen zu sein: Viele dort angesiedelte Veteranen und Söldner gaben ihr neues Zuhause bald wieder auf. Welthistorische Bedeutung aber gewann die einzige Stadt, die Alexander ohne militärischen Hintergrund errichtete: Alexandreia/Alexandria in Ägypten, das zu einer der wichtigsten Metropolen des antiken Mittelmeerraums erblühte.
Alexander der Große hatte allerdings auch ohne sein direktes Zutun und Wissen Langzeitwirkung: Sein unerwarteter Tod und die fehlende Nachfolgeregelung führten zu Kriegen unter seinen Generälen, zur Aufteilung seines Reichs und zur Herausbildung und Festigung verschiedener Teilkönigreiche, vor allem des Ptolemäerreichs in Ägypten und des Seleukidenreichs, das zunächst den Löwenanteil des vormaligen Alexanderreichs umfasste und daher am stärksten für die Ausbreitung griechischer Kultur sorgte. Es müssen zigtausende Griechen, Makedonier oder zum Beispiel Phönizier gewesen sein, die nach Osten strömten, um sich in den zahlreichen neu gegründeten Städten niederzulassen. Das dortige Leben unter Beibehaltung griechisch-makedonischer Sitten, aber auch in der Vermischung mit einheimischer Kultur erschien vielen Europäern lukrativer, als in der zerrütteten Heimat zu bleiben, wo sich die griechischen Stadtstaaten nicht mehr in der Lage sahen, eigenmächtig zu handeln, und ihr Heil im Anschluss an große Bünde suchten. Die alte griechische Poliswelt war schon längst nicht mehr zeitgemäß gewesen; sie hatte in Wahrheit schon seit den Hegemonialbestrebungen Athens, Spartas oder Thebens nicht mehr bestanden. Die griechische Kultur und auch die Polis gingen als solche nicht gänzlich unter, gerieten aber in einen Dauerkonflikt mit den entstehenden Reichen. Fortan prägte das Königtum, das bei den Griechen – abgesehen von Spartas Doppelmonarchie – seit Jahrhunderten eine geringe Rolle gespielt hatte, die europäische Geschichte zwei Jahrtausende lang.
Die Vermischung von Makedoniern und Griechen mit Persern, die Alexander zumindest in den Eliten angestrebt hatte, fand geringfügig weiterhin statt, wenn auch entsprechende Ehen teilweise offiziell verboten waren. Aufgrund seiner anhaltenden Popularität sollen sich noch heute verschiedene asiatische Adelsgeschlechter auf Alexander zurückführen.
Griechisch wurde zu einer Weltsprache, und welcher orientalische Freie sie sprach, hatte in Alexanders Nachfolgereichen die besten Chancen auf – begrenzten – sozialen Aufstieg. Der Begriff „Hellenismus“, mit dem nach Johann Gustav Droysen (1808–1884) die Epoche von 323 bis 30 v. Chr. bezeichnet wird, meint im Kern die Ausbreitung griechischer Kultur und ihre Vermischung mit orientalischen Bräuchen. Er hatte sich bereits in klassischer Zeit angebahnt, aber durch den Alexanderzug den entscheidenden Schub erhalten, wenn er auch nicht mehr als eine eher unbeabsichtigte Folge war. Dieses Ereignis scheint sogar die Ausbreitung des Christentums beflügelt zu haben.
An all dem hatten ohne Frage die Römer maßgeblichen Anteil: Anhaltende Feindseligkeiten zwischen den hellenistischen Dynasten und besonders der allmähliche, aber unaufhaltsame Zerfall des Seleukidenreichs ermöglichten es ihnen, die Reiche nach und nach zu erobern. Den Abschluss dieser Entwicklung und zugleich das offizielle politische Ende des Hellenismus markiert die letzte Ptolemäerin Kleopatra VII., die mit ihrem Selbstmord in Alexandria verhinderte, unter Octavian – dem späteren Augustus – als Gefangene in Rom zu enden. Mit der pax Romana schuf der Begründer des Kaisertums zumindest offiziell einen lange währenden Landfrieden, den sich die Griechen lange Zeit ersehnt hatten, an dem sie aber mit ihren endlosen Kriegen gescheitert waren. Alexander hatte hier wichtige Vorarbeit geleistet.