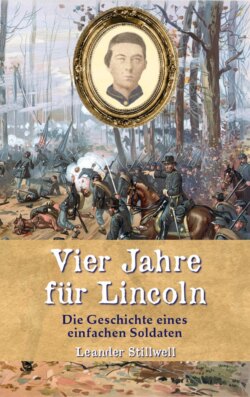Читать книгу Vier Jahre für Lincoln - Stillwell Leander - Страница 7
Kapitel II
Оглавление-
Die Benton-Kaserne – St. Louis (März 1862).
Irgendwann gegen Ende des Monats Februar erreichte uns vom Regimentshauptquartier die willkommene Nachricht, dass wir Camp Carrollton in Bälde verlassen sollten. Unser vorläufiges Ziel lautete St. Louis, Missouri, aber wie es von dort aus weitergehen sollte, vermochte noch niemand zu sagen. Später erging dann der offizielle Marschbefehl und da wurde uns bewusst, dass unsere Befürchtungen bezüglich unserer Teilnahme an den Kampfhandlungen wohl ein wenig verfrüht gewesen waren.
Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass als Datum unseres Aufbruchs von Carrollton in der kurzen Regimentshistorie, welche in den Berichten des Generaladjutanten des Staates Illinois veröffentlicht wurde, der 21. Februar genannt wird, was nicht der Wahrheit entspricht. Es ist dies entweder ein Irrtum jener Person, die diesen Teil der Historie niederschrieb oder ein Schreibfehler. In meinem Besitz befindet sich ein Brief (er liegt gerade vor mir), den ich am 2. März 1862 in der Benton-Kaserne an meinen Vater schrieb. Hierin nenne ich den 28. Februar als den Tag unserer Ankunft in St. Louis und ich weiß genau, dass unsere Verlegung nur zwei Tage in Anspruch nahm. Abgesehen von dem genannten Datum in meinem Brief erinnere ich mich genau an einige weitere ungeschriebene Tatsachen und Begebenheiten, welche mich zu der über jeden Zweifel erhabenen Gewissheit gelangen lassen, dass wir Carrollton am 27. Februar 1862 verließen. Früh am Morgen dieses Tages marschierte das Regiment durch das große Tor und auf einem Feldweg in Richtung Süden. Lebewohl, gutes altes Camp Carrollton! Etliche der Jungs sollten es nie mehr wiedersehen und auch ich bin nur einmal dorthin zurückgekehrt, im Sommer des Jahres 1894. Damals befand ich mich auf Besuch in Jersey County und es überkam mich das Bedürfnis, nach Carrollton zu gehen und mir das alte Lager anzusehen. Zwischenzeitlich war in dieser Gegend (in den letzten Kriegsjahren oder zumindest irgendwann um diesen Zeitraum) eine Bahnstrecke verlegt worden, die von dem Städtchen aus nach Süden verlief und weniger als eine Stunde von Jerseyville, wo ich mich aufhielt, entfernt war. Ich bestieg also den Frühzug und gleich Jona auf seinem Wege nach Tarschisch "bezahlte ich das Fahrgeld und ging an Bord". Ich erfuhr, dass das Areal des alten Lagers noch immer als Jahrmarktgelände diente und dass die alten, großen Bäume, oder zumindest die meisten von ihnen, noch standen und genauso aussahen wie 32 Jahre zuvor. Unsere alten Baracken waren inzwischen natürlich restlos verschwunden. Ich stand dort eine Weile herum und ließ, in Gedanken versunken, meinen Blick schweifen. Dann ging ich wieder und seitdem bin ich nicht mehr dort gewesen.
Bei Sonnenuntergang erreichte das Regiment Jerseyville. Im ganzen Umland hatte sich die Kunde verbreitet, dass Frys Regiment auf dem Wege an die Front war und aus einem Umkreis von mehreren Kilometern war die Landbevölkerung auf ihren Heuwagen in dem Städtchen zusammengeströmt, um einen letzten Blick auf uns zu werfen und uns herzlich zu verabschieden. Das Regiment marschierte in Kompaniekolonne, mit einem Abstand von jeweils einer Kompanie, die nach Süden verlaufende Hauptstraße hinauf. Als wir das Zentrum des kleinen Ortes erreichten, schwenkten wir in Linienformation, richteten uns an der Regimentsfahne aus und standen in Habachtstellung. Auf den Bürgersteigen drängten sich die Leute aus dem Umland und musterten mit angespannten Mienen unsere Reihen, wobei jede Familie aufmerksam nach ihrem Jungen, Bruder, Gatten oder Vater suchte. (An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass die Mehrheit der Soldaten des Regiments, ebenso wie die meisten seiner Offiziere, Junggesellen waren.) Ich war mir gewiss, dass sich meine Eltern irgendwo in dieser Menge befanden, da ich ihnen eigens geschrieben hatte, wann genau wir durch Jerseyville marschieren würden. Ich stand in der vordersten Reihe und hielt meinen Kopf starr nach vorne gerichtet, aber meine Augen schweiften suchend so weit den Bürgersteig entlang, wie es mir in dieser Haltung möglich war. Plötzlich entdeckte ich sie, wie sie sich etwa drei Meter von mir entfernt mühsam ihren Weg zum Straßenrand bahnten. Ich fürchtete mich ein wenig vor unserem Treffen und dem bevorstehenden Abschied. Ich erinnerte mich noch an den Gefühlsausbruch meiner Mutter, als sie mich erstmals in meiner Uniform gesehen hatte und nun befürchtete ich, sie könne vollends zusammenbrechen. Doch da stand sie, ihren Blick unablässig auf mich geheftet und ein stolzes Lächeln zeigend! Wir waren ein prächtig aussehender Haufen von 800 bis 900 Burschen. Unsere Uniformen waren sauber und noch recht neu und unsere Gesichter waren rotbackig und strahlten förmlich vor Energie. Neben der Regimentsfahne trug jede Kompanie damals noch eine eigene, kleine Flagge und all diese flatterten nun im Wind, während unsere Regimentskapelle nach Kräften patriotische Melodien schmetterte. Ich schätze, für all diese Leute muss es ein beeindruckender Anblick gewesen sein, da sie, von wenigen Ausnahmen abgesehen, derartiges wohl noch niemals zuvor gesehen hatten. Wie dem auch sei, meine Mutter war offensichtlich froh, mich im Schatten der wehenden Fahne stehen zu sehen, bereit, für unsere alte Union zu kämpfen, anstatt mich zuhause herumzudrücken wie einige der kräftigen Jungs aus unserer Nachbarschaft, die Familien von Copperheads angehörten und entsprechende Sympathien hegten.
Man hatte Vorkehrungen getroffen, das Regiment für diese Nacht in mehreren öffentlichen Gebäuden des Städtchens einzuquartieren und so wurden die einzelnen Kompanien zu ihren jeweiligen Unterkünften gebracht. Kompanie D hatte man die Baptistenkirche zugewiesen und dort traf ich mich mit meinen Eltern zu einer letzten Unterhaltung. Sie waren auf dem alten Heuwagen 15 Kilometer von Zuhause bis hierher gefahren. Die Straßen verliefen zumeist durch dichte Wälder, über Anhöhen und durch Senken und zudem näherte sich der kurze Wintertag seinem Ende und die Nacht würde bald anbrechen, weswegen sich unser Gespräch notwendigerweise kurz gestaltete. Der Abschied war einfach und ungekünstelt, ohne Zurschaustellung unserer Emotionen, aber Mutters Augen hatten einen ungewöhnlichen Glanz und nachdem sie "Lebewohl, Leander" gesagt hatte, wandte sie sich sogleich ab. Was meinen Vater betrifft, so war er ein alter Sohn North Carolinas, geboren und aufgewachsen in einer von Cherokee-Indianern besiedelten Gegend am Fuße der Great Smoky Mountains. Folglich galt ihm, wie allen Männern seines Schlages, das Zeigen "weibischer" Gefühle als beinahe schändlich. Seine Abschiedsworte waren knapp und wohlbedacht. Er sprach sie in seiner gewöhnlichen Art und Weise, machte auf dem Absatze kehrt und schritt davon.
Mutter hatte mir ein Brathühnchen mitgebracht, eine große, fette Henne mit reichlicher Füllung und viel Salbei und Zwiebeln, zudem eine Früchtepastete, einige Krapfen nach altem Rezept und eingelegte Essiggurken. Ich teilte all dies mit Bill Banfield (meinem guten Freund) und es reichte für ein reichhaltiges Abendessen und ein üppiges Frühstück am nächsten Morgen, wonach noch immer die Hähnchenschlegel und einige weitere Fetzen Fleisch zum Mittagessen übrigblieben.
Am nächsten Morgen brachen wir in aller Frühe in Richtung Alton am Mississippi River auf, allerdings mussten wir an diesem Tage kaum marschieren. Ein Großteil der Bevölkerung aus der Gegend um Jerseyville hatte sich mit seinen Wagen eingefunden und die Leute bestanden darauf, uns nach Alton zu fahren, was wir gerne akzeptierten. Einige Kilometer nördlich von Alton passierten wir eine damals (und womöglich noch heute) dort gelegene, bekannte und vielgerühmte Mädchenschule, das sogenannte "Monticello Seminar für Damen". Die Mädchen hatten bereits von unserer Ankunft gehört und standen alle am Wegesrand. Es waren wohl hundert oder mehr und sie trugen rote, weiße und blaue Schleifen in ihren Haaren oder an ihrer Kleidung. Sie winkten uns mit weißen Taschentüchern und kleinen Fahnen zu und sahen einfach hinreißend aus. Wir ließen uns nicht lange bitten, ihnen herzlich zuzujubeln, das kann ich dir versichern! Wir standen in den Wagen auf, schwenkten unsere Mützen und stießen ein Jubelgeheul aus, bis das letzte der Mädchen außer Sichtweite war. Dieses Ereignis bewahrten wir alle stets in liebevoller Erinnerung, denn es waren dies die letzten Bekundungen von Unterstützung und Patriotismus durch das weibliche Geschlecht, die dem Regiment zuteilwurden, bis wir schließlich einige Monate nach Kriegsende auf unserem Wege heimwärts den Boden des Staates Indiana betraten.
Gegen Sonnenuntergang erreichten wir Alton, wo wir uns unverzüglich an Bord des Seitenraddampfers "City of Alton" begaben, der am Kai auf uns wartete. Sogleich wurden Wachen aufgestellt, um die Männer am Verlassen des Schiffes zu hindern. Doch "'s ward irgendwo geblundert" und man hatte uns keine Verpflegung für unser Abendessen zugeteilt. [Anm. d. Übers.: Stillwell spielt hier auf eine Zeile aus Alfred Tennysons Gedicht "The Charge of the Light Brigade" an. Um den Zitatcharakter zu wahren, wurde an dieser Stelle die bekannteste (wenn auch aus Gründen des Reims sehr unbeholfene) Übersetzung von Theodor Fontane gewählt.] Wir waren ausgehungert, denn unser Mittagessen (zumindest das von Kompanie D) hatte nur aus den Überbleibseln unseres Frühstücks bestanden. Die Offiziere nahmen sich der Sache an, suchten das Städtchen auf und kauften mit ihrem eigenen Geld Nahrungsmittel für uns. Meine Kompanie erhielt ein Fass Austernkekse, die damals "Butterkekse" genannt wurden, und dazu tranken wir Flusswasser.
Die Neuartigkeit und Aufregung der vorigen beiden Tage hatten mich emotional wie körperlich erschöpft und, um die Wahrheit zu sagen, ich fühlte bereits einen ersten Anflug von Heimweh. Nach dem Abendessen begab ich mich auf das Oberdeck, breitete dort meine Decke aus, legte mich nieder, wobei mir mein Tornister als Kopfkissen diente und war bald eingeschlafen. Der Dampfer verließ Alton erst nach Einbruch der Dunkelheit und als er ablegte, rissen mich das Schrillen der Dampfpfeife, das Rauschen der Schaufelräder und das Stampfen und Hämmern der Dampfmaschinen aus dem Schlaf. Ich setzte mich auf, schaute mich um und beobachtete die Lichter von Alton, wie sie in der Schwärze der Nacht schimmerten und funkelten, bis ich sie in einer Flussbiegung aus den Augen verlor. Ich legte mich wieder nieder, schlief ein und erwachte erst am nächsten Morgen nach Tagesanbruch, als unser Schiff bereits am Anlegeplatz von St. Louis ankerte. Bald darauf gingen wir von Bord und marschierten zur Benton-Kaserne, welche außerhalb der Stadt und der Vororte lag. Soweit ich mich erinnere, entsprach die Form des Kasernengeländes einem großen, länglichen Viereck. Die Baracken selbst bestanden aus einer langen Reihe miteinander verbundener Holzrahmenbauten, in denen die Quartiere einer jeden Kompanie durch Bretterwände getrennt und entlang der Wände mit zwei Reihen von Stockbetten eingerichtet waren. Am Ende jeder Kompanieunterkunft befand sich die Kompanieküche. Diese war jeweils ein abgetrennter, separater Rahmenbau, der über allerlei Vorrichtungen zur Nahrungszubereitung verfügte, darunter einen Backsteinofen mit Öffnungen für Pfannen, Töpfe, Kessel und dergleichen. Sowohl die Baracken als auch die Küchen waren bequem und angenehm eingerichtet und unseren zusammengezimmerten Hütten in Carrollton in jeder Hinsicht vorzuziehen. Das Kasernengelände umfasste ein beträchtliches Areal, jedoch kann ich mich nicht an die genaue Größe erinnern. Das Gelände war nahezu völlig frei von Bäumen und wurde für Drillübungen und Paraden genutzt. Der Kommandeur vor Ort war zu dieser Zeit Colonel Benjamin L. E. Bonneville, ein alter Offizier der regulären Armee, der in seinen jüngeren Jahren ein bekannter Entdeckungsreisender in den ungezähmten westlichen Gebieten gewesen war. Ich sah ihn häufig auf dem Gelände umherreiten. Er war ein kleiner, runzeliger, alter Franzose und eine vollkommen unmilitärische Erscheinung. Trotzdem hatte dieser Mann seiner Wahlheimat lange und treu als Soldat gedient. Solltest du jemals mehr über diesen Mann erfahren wollen, so lies (falls du dies nicht schon getan hast) die "Abentheuer des Capitäns Bonneville oder Scenen jenseits der Felsgebirge des fernen Westens" von Washington Irving. Es wird dir eine ausgesprochen interessante Lektüre sein.
Wir verbrachten etwa vier Wochen in der Benton-Kaserne. Das Leben dort war eintönig und bar jeglicher Ablenkung. Ich erinnere mich, dass wir nur selten Drillübungen abhielten, da es die meiste Zeit über regnete und der Boden des Exerzierplatzes ein einziger See aus Matsch war. Die Drainage war eine Katastrophe und so blieb der Regen an der Oberfläche, bis die Erde ihn aufsog. Und eines kann ich dir sagen: Im März des Jahres 1862 regnete es über der Benton-Kaserne wie aus Eimern! Während wir dort untergebracht waren, fand ich in einer kürzlich geräumten Baracke eine alte, zerfledderte Taschenbuchausgabe von Dickens' "Bleakhaus" und an jenen regnerischen Tagen kroch ich in mein Bett (ich belegte eines der oberen Stockbetten), machte es mir bequem und las dieses Buch. Einige der darin vorkommenden aristokratischen Charaktere besaßen einen Landsitz namens "Chesney Wold", wo es unablässig zu regnen schien. Um (sinngemäß) aus dem Buch zu zitieren: "Der Regen fiel ohne Unterlass, tropf, tropf, am Tage wie in der Nacht in jenem Orte in Lincolnshire." Ebenso verhielt es sich in der Benton-Kaserne. Wenn ich des Lesens überdrüssig war, wandte ich meinen Kopf zur Seite und schaute eine Weile aus dem kleinen Fenster an der Seite meines Bettes, das mir einen Ausblick über den Großteil des Platzes gewährte, um den herum die Baracken standen. Der Boden war ein regelrechter Sumpf aus Schlamm und Wasser und keine Seele rührte sich dort draußen, mit Ausnahme einer berittenen Ordonnanz, die gelegentlich im Galopp über das Kasernengelände jagte. Seit damals habe ich "Bleakhaus" mehrere Male gelesen und sobald ich das Kapitel erreiche, in dem vom regnerischen Wetter auf dem Landsitz der Dedlock-Familie die Rede ist, kann ich jene düsteren und trostlosen Verhältnisse, unter denen ich vor mehr als einem halben Jahrhundert meine Zeit in der Benton-Kaserne verbrachte, stets deutlich und mit allen Sinnen nachempfinden. Irgendwo in General Shermans Memoiren habe ich eine Stelle gelesen, in der er sich dahingehend äußert, dass sich Regen im Feldlager negativ auf das Gemüt der Soldaten auswirke, auf dem Marsch jedoch durchaus anregend sei. Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass diese Beobachtung der Wahrheit entspricht. Auf dem Marsch wurden wir häufig von schwerem Regen überrascht, welcher die Straßen rasch in einen Sumpf aus klebrigem, gelbem Schlamm verwandelte. In diesen Fällen zogen wir unsere Schuhe und Strümpfe aus, banden sie etwas unterhalb der Mündung und knapp oberhalb des Schaftendes an unserem Musketenlauf fest, balancierten die Muskete auf ihrem Hahn über der Schulter, sodass der Schaft nach oben zeigte und rollten unsere Hosenbeine bis zu den Knien hoch. Dann taten wir es wie Tam O'Shanter und ließen "Lehm und Moder um uns spritzen, die Winde heulen, Blitze blitzen", wobei wir "John Brown's Body" sangen oder irgendein anderes Lied, nach dem uns gerade zumute war. [Anm. d. Übers.: Stillwell zitiert hier aus "Tam O'Shanter", einem Gedicht des schottischen Nationaldichters Robert Burns aus dem Jahre 1790.] Regnerische Tage im Lager hingegen, besonders derart heftige wie jene während unserer Zeit in der Benton-Kaserne, beschwören Gefühle von Trostlosigkeit und Niedergeschlagenheit herauf, die man nur nachvollziehen kann, wenn man sie selbst erlebt hat. Das Elend, das sie verursachen, lässt sich nicht beschreiben.
Während ich eines Tages müßig über das Kasernengelände schlenderte, traf ich einen Soldaten, der mir erzählte, er gehöre zur 14th Wisconsin Infantry. Er war einige Jahre älter als ich, recht mitteilsam und schien mir ein vernünftiger, aufgeweckter Bursche zu sein. Er redete ohne Unterlass über sein Regiment, es bestünde fast ausschließlich aus jungen Männern, großgewachsenen, kräftigen Holzfällern aus den Kiefernwäldern Wisconsins. Ich wurde nachdrücklich eingeladen, das Regiment bei Gelegenheit am Abend zu besuchen und ihm bei der Parade zuzusehen. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt bereits die Erfahrung gemacht, dass Soldaten dazu neigten, mit ihrem Regiment zu prahlen, weswegen ich seinen Schilderungen mit einiger Vorsicht begegnete, allerdings hatte er trotzdem meine Neugierde auf diese Kerle aus Wisconsin geweckt. Als ich eines Abends keine Verpflichtungen hatte, ging ich mir also ihre Parade ansehen und es stellte sich heraus, dass der Soldat tatsächlich nicht übertrieben hatte. Es waren allesamt prächtige, große Burschen mit breiten Schultern, enormen Brustkörben und kräftigen Gliedmaßen. Was die körperliche Verfassung betrifft, so waren dies zweifelsohne die prächtigsten Soldaten, die ich während meiner gesamten Militärzeit sah. Ich erwähne dieses Ereignis und diese Burschen an dieser Stelle, da ich später möglicherweise noch mehr über das 14th Wisconsin zu sagen haben werde.
In der Benton-Kaserne erhielten wir unsere Regimentsnummer – die 61 – und fortan waren wir die 61st Illinois Infantry. Auch unsere Waffen wurden uns zugeteilt. Wir wurden mit österreichischen Musketen mit gezogenem Lauf ausgerüstet. Sie waren von mittlerer Länge, hatten einen Schaft aus hellbraunem Walnussholz und gaben alles in allem tadellose Schießeisen ab. Zu jener Zeit waren die meisten Truppen des westlichen Kriegsschauplatzes mit aus Europa importierten Musketen ausgerüstet. Viele Regimenter hatten alte, belgische Musketen, schwere und unhandliche Ungetüme, die in jeder Hinsicht ungenügend und minderwertig waren. Wir waren froh, unsere "Österreicher" erhalten zu haben und waren stolz auf sie. Wir benutzten sie, bis wir sie im Juni 1863 gegen die Springfield-Muskete Modell 1863 mit gezogenem Lauf eintauschten. Diese war nicht so schwer wie das österreichische Modell, bot einen gefälligeren Anblick und war eine sehr effektive Waffe. Es war dies die letzte Änderung in dieser Hinsicht und wir trugen die Springfield-Muskete bis zu unserer Ausmusterung. [Anm. d. Übers.: In den frühen Kriegsjahren kaufte die Unionsregierung ungeachtet der Qualität möglichst viele der zum Export bestimmten Waffenbestände der europäischen Staaten auf, teils um den enormen Bedarf zu decken, teils um sie den ebenfalls sehr aktiven Einkäufern der Südstaaten vorzuenthalten. Das österreichische Lorenz-Gewehr war eines der besseren und begehrteren europäischen Modelle.]
In der Benton-Kaserne war es auch, wo die Indienststellung des Regiments in die Streitkräfte der Vereinigten Staaten vollzogen wurde. Zu jener Zeit bestand ein Infanterieregiment aus zehn Kompanien, aber unseres verfügte nur über neun. Wir hatten keine Kompanie K und sollten eine solche erst im März 1864 erhalten. Da wir kein vollständiges Regiment darstellten, diente Colonel Fry (wie wir ihn nannten) lediglich als Lieutenant-Colonel und diesen Rang bekleidete er während seiner gesamten Zeit beim Regiment. Captain Simon P. Ohr aus Kompanie A wurde zum Major befördert. Aufgrund unseres Mangels an einer zehnten Kompanie und der Tatsache, dass wir diese erst erhielten, als die übrigen Kompanien bereits beträchtlich geschwächt waren, verfügte das Regiment bis zum Sommer des Jahres 1865 über keinen Offizier im Range eines Colonels. Von den Umständen, unter denen wir endlich einen Colonel bekamen, wird noch die Rede sein.