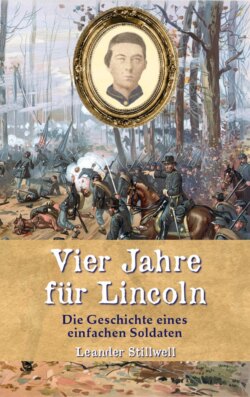Читать книгу Vier Jahre für Lincoln - Stillwell Leander - Страница 8
Kapitel III
Оглавление-
Aufbruch an die Front – Die Schlacht von Shiloh (März und April 1862).
Am 25. März verließen wir die Benton-Kaserne und machten uns auf den Weg an die Front. An jenem Tag marschierten wir durch St. Louis und gingen an Bord eines Dampfers, aber aus irgendeinem mir unbekannten Grunde legte das Schiff erst spät am Abend des folgenden Tages ab. Meine Kompanie war auf dem Oberdeck untergebracht. Der Dampfer war noch nicht lange auf dem Fluss unterwegs, als sich ein Vorfall ereignete, der heute einigermaßen belustigend erscheinen mag, damals jedoch ein durchaus ernstzunehmendes Unglück für mich darstellte und zudem mein Gewissen beträchtlich belastete. Ich hatte meinen Tornister, an dem ich meine Decke festgeschnallt hatte, zusammen mit meiner sonstigen Ausrüstung bei einigen pyramidenförmig zusammengestellten Musketen (darunter auch die meine) abgelegt. Plötzlich bemerkte ich zu meinem Entsetzen, dass meine Decke verschwunden war! In der Tat, meine verehrte Leserschaft, hatte sich irgendein Tunichtgut vorsätzlich und arglistig diesen für eine erholsame Nachtruhe unverzichtbaren Gegenstand angeeignet. Eine lange, raue Märznacht stand bevor und aus dem kalten Fluss stieg nebelgleich eine feuchte und frostige Luft empor. Alle Anzeichen deuteten zudem auf nächtlichen Regen hin. Donner grollte dumpf vom Südwesten her, gelegentliche Blitze erhellten den Himmel und vereinzelte Regentropfen prasselten bereits auf das Oberdeck und kräuselten die Wasseroberfläche des Flusses. Was sollte ich nur tun? Ich musste eine Decke haben, das stand fest. Mein ganzes Leben lang hatte man mich gelehrt, dass Diebstahl so ziemlich das schändlichste aller Verbrechen und Diebe erbärmliche und verachtenswerte Schurken seien. Zudem sagt eines der Zehn Gebote unmissverständlich: "Du sollst nicht stehlen." Und doch musste ich es tun und zwar unverzüglich. Ich überdachte die Angelegenheit und gelangte zu der Erkenntnis, dass ich ja ein Soldat und somit vorübergehend ein Werkzeug von Onkel Sam war. Folglich war ich Regierungseigentum und es war meine Pflicht, dieses Eigentum unbedingt zu schützen. Somit war die Sache entschieden und ich verscheuchte mein schlechtes Gewissen (und meine Integrität). Ich möchte an dieser Stelle nicht in die schändlichen Details gehen und so soll es genügen, wenn ich gestehe, dass ich irgendeinem armen Kerl aus einer anderen Kompanie die Decke stahl und somit die Gesundheit und militärische Verwendbarkeit eines willigen Dieners der Nation bewahrte. Wie der andere Bursche durch die Nacht kam, vermag ich nicht zu sagen. Ich stellte diesbezüglich keine Nachforschungen an und war in der Folgezeit sorgsam darauf bedacht, diese Decke am Tage im Inneren meines Tornisters vor eventuellen neugierigen Blicken zu verbergen. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass dies der einzige Akt von unverhohlenem Diebstahl war, den ich während meiner gesamten Dienstzeit beging (mit Ausnahme einiger Zwiebeln, von denen möglicherweise an späterer Stelle noch die Rede sein wird). Selbstverständlich versorgte ich mich auf dem Marsch oder Postendienst unzählige Male mit Maiskolben, Süßkartoffeln, Äpfeln und dergleichen, aber es waren dies legitime Fälle von Requirierung, die von der militärischen Führung ausdrücklich gestattet waren.
In jener Nacht, als wir St. Louis verließen, erhielt ich meine erste anschauliche Lektion über die unterschiedlichen Lebensbedingungen der Offiziere und der einfachen Soldaten. Ich hatte meine Decke entlang der Wand des sogenannten "Texas" ausgebreitet, einer kleinen Konstruktion, die an die Kabine des Steuermanns anschließt. Am Boden des "Texas" war eine Reihe kleiner Fenster eingelassen, durch die man in das Kabineninnere hinabsehen konnte. Ich musste nur meinen Kopf zur Seite drehen, um zu beobachten, was sich dort drinnen ereignete. Die Offiziere saßen in gepolsterten Sesseln oder schlenderten auf Teppichen in dem hell erleuchteten Raum umher, während ihr Abendessen zubereitet wurde. Farbige Diener in weißen Uniformen trugen das Essen herein und als die Tafel gedeckt war, ertönte ein Gong und die Offiziere begaben sich zu Tische. Was dort alles auf sie wartete! Gebratener Schinken und Beefsteak, frischgebackene Brötchen, Butter, Melasse, dampfend heiße große Pellkartoffeln, duftender Kaffee mit Sahne in feinen Tassen und Untertassen sowie weitere kleine Leckereien in Form von eingemachtem Obst und dergleichen. Wie köstlich diese Dinge dufteten! An meiner Position konnte mir der Geruch nicht entgehen. Dort saßen die Offiziere in der warmen, lichtdurchfluteten Kabine zu Tische, ließen sich von Niggerkellnern bedienen und labten sich an all diesen erlesenen Speisen! Es war dies ein Anblick vollkommenen Komforts und Wohlbehagens! Wenn die Offiziere sich schließlich für die Nacht zurückzogen, warteten warme, gemütliche Kojen auf sie, wo sie auf Matratzen und Daunendecken ihre müden Glieder ausstrecken konnten, ohne auch nur einen Gedanken an die Kälte und Nässe dort draußen zu verschwenden. Ich wandte meinen Kopf zurück und besah mir meinen eigenen Schlafplatz. In der kalten, pechschwarzen Nacht rieselten Asche und Ruß von den Schloten auf uns hernieder und der Nieselregen trommelte auf das Deck. Mein Abendessen hatte aus Hartkeksen und rohem Schweinebauch bestanden, dazu wurde als Getränk Flusswasser von dem exzellenten Jahrgang 1541 gereicht. [Anm. d. Übers.: Der Mississippi River wurde 1541 von Hernando de Soto entdeckt.] Um mein Elend zu vervollständigen, lag ich zudem noch unter einer Decke, die ich aus einer militärischen Notlage heraus hatte stehlen müssen. Ich besann mich jedoch, dass wir nicht alle Offiziere sein konnten; irgendjemand musste schließlich die Musketen abfeuern. Ich tröstete mich weiter mit dem Gedanken, dass die Offiziere zwar etliche Privilegien gegenüber den einfachen Soldaten hatten, im Gegenzug aber auch eine größere Verantwortung schultern mussten und sich über viele Dinge den Kopf zerbrachen, die uns nicht im Geringsten zu kümmern brauchten. So unterdrückte ich nach Kräften meinen Neid, wickelte mich in meine Decke, schloss die Augen und schlief die ganze Nacht hindurch den tiefen, traumlosen Schlaf der kerngesunden Jugend.
In der Nacht klarte das Wetter auf und der folgende Tag war angenehm, was unsere Laune beträchtlich verbesserte. Unsere Umgebung war neu und ungewohnt und wir blickten voller Aufregung und Hoffnung in die Zukunft. Wir waren beinahe alle einfache Jungs vom Lande, die ihr bisheriges Leben in der entlegenen Provinz zugebracht hatten. Ich selbst war vor meiner Soldatenzeit noch nie weiter als 80 Kilometer von meinem Zuhause entfernt gewesen, war niemals auf einem Dampfschiff gefahren und hatte auf meinen gelegentlichen Eisenbahnfahrten kaum mehr als 120 Kilometer zurückgelegt (Hin- und Rückfahrten zusammengezählt). Doch nun hatte sich der beengte Horizont meiner Heimat plötzlich geöffnet und vor meinen Augen entfaltete sich eine große, weite Welt. Hierzu gesellten sich die Gedanken an das kühne, heroische Leben, das uns nun bevorstand. Keiner von uns Jungs rechnete ernsthaft damit, getötet zu werden oder ein anderes ungünstiges Schicksal zu erleiden. Den anderen mochte es übel ergehen, einige von ihnen würden wohl sterben müssen, aber man selbst würde am Ende eines siegreichen Krieges unversehrt nach Hause zurückkehren und den Rest seines Lebens als bewunderter und respektierter Kriegsheld verbringen. Dies waren zumindest meine Gedanken und ich hege keinerlei Zweifel daran, dass 99 von 100 der anderen Burschen ebenso dachten.
Am Nachmittag dieses Tages (dem 27. März) erreichten wir Cairo, wo wir am Kai vor Anker gingen und eine kurze Zeit verbrachten. Das Städtchen lag am Ohio River, der zu dieser Zeit, ebenso wie der Mississippi River, viel Wasser führte. Cairo bot einen erbärmlichen Anblick. Man hatte Dämme gegen das Hochwasser errichtet, aber die Straßen und der Boden allgemein waren trotzdem ein einziger abgestandener, fauliger Morast. Dampfmaschinen pumpten das Wasser nach Kräften durch in den Damm eingelassene Rohre zurück in den Fluss und ohne sie wären die Einwohner wohl ertrunken. Im Frühling des Jahres 1842 besuchte Charles Dickens diesen Ort während seiner Amerikareise und er diente ihm als Inspiration für die Stadt "Eden" in seinem Buch "Leben und Abenteuer des Martin Chuzzlewit". Ich las dieses Buch erst nach dem Ende des Krieges, habe es seitdem jedoch bereits mehrmals durchgelesen und muss sagen, wenn das "Eden" von 1842 dem Cairo, das ich 20 Jahre später sah, auch nur annähernd glich, so hätte Dickens' düstere Beschreibung nicht treffender sein können.
Unser Dampfer hatte kaum angelegt, als sich an Bord bereits herumsprach, dass sich auf dem Transportschiff zu unserer Rechten konföderierte Kriegsgefangene befänden. Wir stürmten also zur Steuerbordreling, um unseren ersten Blick von den "Secesh" (wie wir die Rebellen nannten) zu erhaschen. Es war nur ein kleines Häuflein, wohl etwa um die 100 von ihnen. Sie waren unter Bewachung und standen achtern auf dem Unterdeck, entlang der Seite und des Hecks des Schiffes. Es stellte sich heraus, dass dies so ziemlich die letzte Fuhre der bei Fort Donelson gemachten Gefangenen war, die sich auf dem Weg zu einem Gefangenenlager im Norden befanden. Selbstverständlich beäugten wir sie mit großer Neugierde und bald begannen die Jungs, Witze zu reißen und die Rebellen gutmütig zu necken. Diese ließen es stillschweigend und mit einem gelegentlichen trockenen Grinsen über sich ergehen. Schließlich fixierte uns jedoch ein gutaussehender, junger Bursche mit einem eindringlichen Blick und rief mit sanfter Stimme in der gedehnten Sprechweise des Südens: "Noch vor dem nächsten Sommer werdet ihr alle ein anderes Liedchen singen!" Unsere Jungs antworteten hierauf mit schallendem Gelächter und spöttischem Geheul, es sollte sich aber herausstellen, dass dieser junge konföderierte Soldat ein wahrer Prophet war.
Unser Aufenthalt in Cairo war nur von kurzer Dauer; bald legte das Schiff wieder ab und dampfte den Ohio River hinauf zur Mündung des Tennessee River, von wo ab es diesem Fluss folgte. Am folgenden Tag passierten wir Fort Henry. Wir alle hatten von seiner Eroberung im vergangenen Monat durch die vereinten Kräfte unserer Armee und Marine gelesen und waren natürlich neugierig, dieses Bollwerk zu sehen, in dem eine Handvoll Männer solch tapferen Widerstand geleistet hatten. Meine Vorstellung von Befestigungsanlagen basierte zu jener Zeit auf Illustrationen aus Büchern über alte europäische Festungen und auf Schilderungen in Sir Walter Scotts "Marmion", die die Burg Tantallon beschreiben. Als wir uns Fort Henry näherten, rechnete ich also fest damit, ein riesiges, beeindruckendes Bauwerk mit Wehrerkern, einem Bergfried, einem Fallgatter, einer Zugbrücke und dergleichen mehr zu sehen, auf dessen Mauern womöglich noch ein hoher Offizier mit gezogenem Schwerte umherstolzieren mochte, der aus vollem Halse Dinge wie: "Heiho, ihr Krieger, frischauf!" oder ähnliche Worte ausrief. Entsprechend groß waren mein Erstaunen und meine Enttäuschung, als wir am Fort vorbeidampften und ich lediglich ein elendes, kleines Etwas aus festgestampfter Erde entdeckte, dem so rein gar nichts von "Pracht, Pomp und Rüstung des glorreichen Kriegs" anzusehen war. [Anm. d. Übers.: Hier zitiert Stillwell William Shakespeares "Othello".] Das Fort war an einer niedrigen Stelle nahe dem Ufer des Tennessee River errichtet worden und da der Strom gerade Hochwasser führte, war das umliegende Land nahezu völlig von Wasser bedeckt. Zudem glich das Innere des Forts eher einem Schweinepferch. Es war mir einfach unbegreiflich, wie sich dieses erbärmliche Konstrukt unseren Kanonenbooten so lange zu widersetzen vermocht hatte. Damals wusste ich noch nicht, dass eben diese Art von Befestigung mit Wällen aus festgestampfter Erde den bestmöglichen Schutz gegen moderne Artillerie bietet. Tatsächlich war zu diesem Zeitpunkt meine Unwissenheit über militärische Belange breit gefächert und nahezu allumfassend.
Während wir weiter den Tennessee River hinauffuhren, bemerkten wir in den Bäumen seltsame, uns unbekannte, grüne Knäuel. Da die Bäume noch kein Laub trugen, wussten wir, dass dies keine Blätter sein konnten, aber wir vermochten nicht zu sagen, um was es sich stattdessen handeln könnte. Schließlich erfuhren wir von einem Besatzungsmitglied des Dampfers, dass es Misteln waren. Wenn ich mich recht entsinne, hatte noch kein einziger von uns Soldaten diese seltsame immergrüne Pflanze jemals zuvor gesehen und so stellte sie ein faszinierendes Kuriosum für uns dar. In der Folgezeit wurde sie uns ein alltäglicher Anblick.
Am Abend des 31. März erreichten wir bei Sonnenuntergang Pittsburg Landing. Hier schlugen wir an unserer Stellung in der Linie unser Lager auf und schliefen erstmals in unserem Soldatenleben in Zelten. Wir verfügten über sogenannte Sibley-Zelte, recht geräumige Behausungen von konischer Form, in denen zwölf Männer mitsamt ihrer Ausrüstung Platz finden konnten. Um zu verdeutlichen, wie wenig wir vom ordnungsgemäßen Aufbau eines Zeltes verstanden, gestehe ich an dieser Stelle, dass wir nicht einmal einen Graben um unser Zelt herum zogen. Prompt brach in der ersten Nacht ein schwerer Regen über uns herein und am nächsten Morgen schwammen wir förmlich auf dem Wasser und unsere Decken und Ausrüstung waren natürlich völlig durchnässt. Fortan bestand eine unserer ersten Maßnahmen nach dem Aufbau des Zeltes stets im Ausheben eines Grabens mit seitlichem Abfluss.
Ich erinnere mich noch lebhaft an die Soldatenkochkünste, die wir während unserer ersten Monate in Tennessee zu erdulden hatten. In Camp Carrollton und der Benton-Kaserne hatten wir Kompanieköche, die jeweils das Essen für eine gesamte Kompanie zubereiteten. Es waren dies einfache Soldaten, die man zu diesem Zweck eingeteilt hatte und ihre kulinarischen Fähigkeiten waren beileibe nicht der Rede wert, aber verglichen mit unserem jetzigen Essen hatten sie wahre Genüsse gezaubert. Wir bildeten Messen von jeweils vier, acht oder zwölf Mann und jeder kam nach und nach an die Reihe, als Koch für seine Messe zu fungieren. Nur sehr wenige von uns hatten auch nur die geringste Ahnung von der Nahrungszubereitung und über die Resultate unserer diesbezüglichen Experimente hätte man lachen können, hätten sie kein so erbärmliches Leid angerichtet. Nach unserer Ankunft in Pittsburg Landing wurde Mehl an uns ausgegeben, aber wir hatten nicht die notwendigen Utensilien, um Brötchen oder Brotlaibe zu backen. Wir rührten also einen Teig aus Mehl, Wasser, Schmalz und Salz an und brieten ihn in einer Pfanne. Das Ergebnis waren die Armeepfannkuchen, die sogenannten "Flapjacks". Diese waren ausnahmslos zäh wie ein Maultierohr, hatten in etwa die Dichte von Blei und waren nahezu unverdaulich. Später lernten wir, mit Lehm verputzte Holzöfen und Steinöfen zu bauen, mit denen wir schließlich in der Lage waren, gutes Brot zu backen. Trotzdem blieb bei den Soldaten auf dem westlichen Kriegsschauplatz stets der Hartkeks das Hauptnahrungsmittel und nichts, was wir mit unserem Mehl herstellen konnten, kam ihm geschmacklich auch nur nahe.
Unsere Zubereitung der "Yankee-Bohnen" (wie wir sie nannten) war lange Zeit einfach nur grauenhaft. Wie du weißt, muss man Bohnen kochen, bis sie vollkommen gar sind, da sie ansonsten giftig sind. Nun, unsere Bohnen waren in der Regel bestenfalls halbgar und das Ergebnis war eine widerliche, schleimige Pampe, deren Aussehen schon ausreichen konnte, einem den Appetit zu verderben. Und was den Reis betrifft … was davon nach unserer Zubereitung auf dem Teller landete, spottete jeder Beschreibung. Ich entwickelte einen dermaßen großen Ekel vor Reis, dass ich es noch als Zivilist, Jahre nach dem Ende des Krieges, einfach nicht über mich bringen konnte, ihn zu essen, gleich wie köstlich er auch zubereitet sein mochte.
Das mangelhaft zubereitete Essen, der Klimawechsel, das ungewohnte Wasser und die Vernachlässigung hygienefördernder Maßnahmen führten in Pittsburg Landing zu einer wahren Durchfall-Epidemie, welche besonders den "grünen" Regimentern (darunter auch unseres) arg zusetzte. Für einen Zeitraum von etwa sechs Wochen litt praktisch jeder Soldat darunter und der einzige Unterschied bestand in der Schwere der jeweiligen Erkrankung. Tatsächlich war der Zustand der Truppen in dieser Zeit so erbärmlich und widerwärtig, dass ich eine eingehendere Schilderung vermeiden möchte. Dergleichen habe ich weder vorher noch nachher jemals wieder miterlebt. Ich bin der Überzeugung, dass dieses Problem von den Unmengen an Zucker, welche die Soldaten begierig aßen, noch verstärkt wurde. Nicht nur schütteten sie ihn überreichlich in ihren Kaffee und Reis, sie verschlangen auch regelmäßig Händevoll davon in purer Form. Ich kann aus dem Stegreif einen Vorfall schildern, der den übersteigerten Heißhunger der Jungs auf Zucker veranschaulicht. Das Ganze ereignete sich in unserem Lager an einem regnerischen Tag während der Belagerung von Corinth. Jake Hill aus meiner Kompanie hatte einen kleinen Zuckerberg auf einem Hartkeks aufgehäuft, so viel, wie nur irgendwie darauf passte, bevor die Körner an den Seiten herabzurieseln begannen. Er setzte sich auf seinen Tornister und begann, an seinem Festmahl herumzunagen, wobei er sich systematisch an allen Seiten zu schaffen machte. Er litt zu jenem Zeitpunkt an der oben genannten Epidemie und war dermaßen geschwächt, dass er kaum laufen konnte. Jemand sagte zu ihm: "Jake, in deinem Zustand ist der Zucker nicht gut für dich!", woraufhin er mit betroffener Miene aufblickte und im Tonfalle zutiefst gekränkter Unschuld entgegnete: "Habe ich etwa nicht das Recht, meinen eigenen Proviant zu verzehren?" Wider Erwarten gesundete Jake wieder und diente für den gesamten Rest des Krieges, wobei er sich als guter Soldat erwies.
Ich persönlich entschloss mich bereits zu Beginn meiner Soldatenzeit, überhaupt keinen Zucker mehr zu mir zu nehmen (mit Ausnahme einer gelegentlichen winzigen Menge auf eingemachtem Obst oder Beeren) und ich gewöhnte mir seinen regelmäßigen Gebrauch erst Jahre nach meiner Entlassung aus der Armee wieder an.
Aufgrund der bereits angedeuteten Bedingungen in Pittsburg Landing starben die Männer dort wie die Fliegen. Viele weitere mussten wegen Untauglichkeit aus dem Militärdienst entlassen werden und folglich stand auch ihre Kampfkraft nicht mehr zur Verfügung. Es ist wahr, dass sich einige dieser Entlassenen, besonders die jüngeren Burschen, in der Folgezeit wieder zum Heer meldeten und gute Soldaten abgaben, aber die krankheitsbedingten Verluste der Unionsarmeen in Tennessee überstiegen im Frühjahr '62 zweifellos die Verluste einer großen Schlacht. Im Gegensatz zu Verlusten im Kampf trugen sie aber rein gar nichts zu einer Beendigung des Krieges bei.
Die Schlacht von Shiloh wurde am 6. und 7. April ausgefochten. Im Jahre 1890 schrieb ich einen Bericht über diese Schlacht, welcher in der "New York Tribune" und später noch in weiteren Zeitungen erschien. Ferner wurde er zusammen mit Artikeln anderer Personen (einige handelten vom Kriege, andere widmeten sich verschiedensten Themen) in Buchform veröffentlicht. Dieser Text, den ich vor 25 Jahren abfasste, ist wohl so gut wie, wenn nicht gar besser als alles, was ich jetzt über die Schlacht schreiben könnte, weswegen ich ihn an dieser Stelle einfügen möchte.
Als Soldat in Shiloh.
von Leander Stillwell,
ehemals First Lieutenant, 61st Illinois Volunteer Infantry.
Viel ist bereits über die Schlacht von Shiloh gesagt und geschrieben worden, sowohl von Offizieren der Rebellen und der Union als auch von Schriftstellern. Was erstere betrifft, so wird wohl auf ewig erbitterte Uneinigkeit über das Verhalten von General Beauregard herrschen, der den Angriff seiner Truppen am Sonntagabend einstellen ließ, als ihm noch eine volle Stunde wertvollen Tageslichts zur Verfügung stand. Diese Zeit, so behaupten einige, hätte er nutzen können, um den Rest von Grants Armee zu zerschlagen, bevor Buell hätte über den Tennessee River setzen können. Unter den unionstreuen Schreibern wird hingegen am häufigsten diskutiert, ob unsere Truppen nun überrumpelt wurden oder nicht, inwieweit Grants Armee am Abend des ersten Tages noch kampffähig war, wie die Schlacht ohne die Unterstützung der Kanonenboote ausgegangen wäre und wie ein Nichterscheinen von Buells Verstärkungen den weiteren Verlauf der Kämpfe beeinflusst hätte. Es ist nicht meine Absicht, mit der Schilderung meiner Erlebnisse in der Schlacht von Shiloh etwas zur Lösung dieser bereits lebhaft erörterten Themen beizutragen. Ich war damals gerade einmal 18 Jahre alt und stand in den Reihen der einfachen Soldaten. Es wäre mithin töricht von mir, mich als Schlachtenkritiker zu gebaren. Es liegt in der Natur der Sache, dass es den Generälen, welche von der verhältnismäßigen Sicherheit ihrer Feldherrenhügel herab das Schlachtfeld mit ihren Ferngläsern überblicken und die Truppenbewegungen überwachen und lenken, vorbehalten bleibt, die Fakten zur Geschichtsschreibung beizutragen. Der einfache Soldat sieht das Schlachtfeld lediglich durch das Visier seiner erhobenen Muskete und das Wenige, was er wahrnimmt, ist nur "durch einen Spiegel ein dunkles Bild". [Anm. d. Übers.: Hier zitiert Stillwell die Bibel, den ersten Brief des Paulus an die Korinther.] Die dichten Pulverschwaden verwehren ihm die Sicht, er erspäht durch den vorbeiziehenden Rauch nur ebenso unvermittelt auftauchende wie verschwindende Schemen seiner Feinde.
Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass der einfache Soldat während der Erfüllung seiner Pflicht in der Schlacht all seine körperlichen und geistigen Kapazitäten ausschließlich auf seinen eigenen, kleinen Part im großen Werk der Vernichtung konzentriert und er folglich kaum Gelegenheit dazu findet, im Geiste seine Erlebnisse zu ordnen, um auf deren Basis ein Vierteljahrhundert später historische Artikel verfassen zu können. Man holt eine Patrone aus der Patronentasche, beißt sie auf, schüttet das Pulver in den Lauf, rammt die Kugel hinterher (im Bürgerkriege benutzten wir Vorderlader), setzt das Zündhütchen auf, zielt und feuert – all dies mit getriebener Hast und verzweifelter Geschwindigkeit, denn jeder Schuss könnte der letzte sein. Diese Dinge verlangen nach der ganzen Aufmerksamkeit des Soldaten und machen ihn blind und taub für alles, was außerhalb seiner unmittelbaren Umgebung geschieht. Zudem wird sein Gehörsinn überwältigt von all dem donnernden Lärm um ihn herum. Das unablässige und fürchterliche Rasseln der Musketen, das Dröhnen der Kanonen und das ständige Zischen der an einem vorbeisausenden Kugeln vermischen sich mit den erbärmlichen Schreien der Verwundeten und den hörbaren Todesqualen der sterbenden Kameraden, die sich direkt vor den Augen der Lebenden krampfartig auf der Erde winden. All dies trägt nicht gerade zu jener ruhigen und kühl abwägenden Gemütsverfassung bei, die der Historiker in seinem stillen Kämmerlein empfinden mag.
Deswegen sollen die Generäle und Geschichtsschreiber über die Bewegungen von Corps, Divisionen und Brigaden berichten. Ich habe nichts anzubieten, außer der simplen Geschichte über die Eindrücke eines einfachen Soldaten von einer der blutigsten Schlachten des Krieges.
Das Regiment, dem ich angehörte, war die 61st Illinois Infantry. Es verließ sein erstes Ausbildungslager (nahe einem kleinen Provinzstädtchen im südlichen Illinois) gegen Ende des Monats Februar im Jahre 1862. Wir wurden in die Benton-Kaserne bei St. Louis verlegt, wo wir bis zum 25. März gedrillt wurden (sooft das Wetter es gestattete). An diesem Tag wurden wir an die Front geschickt. Das Wetter war bewölkt, regnerisch und düster und wir marschierten durch die Straßen von St. Louis zum Kai, wo wir an Bord des Transportschiffes gingen, das uns an unseren Bestimmungsort bringen sollte. Die Stadt lag unter jener Dunstglocke aus Kohlestaub, für die St. Louis bekannt ist. Sie hing niedrig und schwer über uns und reizte uns alle zum husten. Ich glaube, der Colonel führte uns durch eine Seitenstraße. Sie war schmal und schmutzig und beiderseits von hohen Gebäuden gesäumt. Die Offiziere nahmen den Bürgersteig in Beschlag, während das Regiment neben ihnen her schweigend auf der Straße marschierte und sich dabei durch den widerlichen, zähen Schlamm mühte. Ein Umstand unseres Marsches durch St. Louis, der uns in besonderem Maße auffiel, war der völlige Mangel an Interesse seitens der Einwohner. Durch die Illustrationen in den Büchern, die ich zuhause gelesen hatte, war ich zu der Überzeugung gelangt, dass Soldaten auf ihrem Wege an die Front stets von hübschen Damen, die von den Balkons mit blütenweißen Taschentüchern winkten und Herren, die auf den Bürgersteigen jubelnd ihre Hüte schwenkten, verabschiedet wurden.
Möglicherweise gab es Regimenter, denen dieses Glück zuteilwurde, aber unseres war keines von ihnen. Gelegentlich steckte ein fetter, bullig aussehender Bursche von augenscheinlich deutscher Abstammung seinen Pfeife rauchenden Kopf aus einem Fenster oder einer Tür, betrachtete uns für einige Sekunden und verschwand wieder. Es wurden weder Taschentücher noch Hüte geschwenkt und wir hörten auch keine Jubelrufe. Ich war damals überzeugt, dass die Unionsanhänger wohl alle bereits an der Front seien oder der Colonel uns durch ein Rebellenviertel der Stadt führte.
Wir marschierten zum Kai und bestiegen dort den großen Seitenraddampfer "Empress". Am folgenden Abend legte das Schiff ab, drehte seinen Bug in die Strömung und dampfte ab in Richtung "Kriegsschauplatz". Am 31. März erreichten wir Pittsburg Landing, das, wie der Name bereits andeutet, lediglich eine Anlegestelle für Flussdampfer war. Es liegt etwa 30 Kilometer nordöstlich von Corinth am Westufer des Tennessee River in einem dicht bewaldeten Landstrich. Zu jener Zeit befand sich dort keine Siedlung, sondern lediglich jenes Blockhaus auf dem Hügel, das wohl kein Überlebender der Schlacht von Shiloh je vergessen wird. Jene Uferseite des Tennessee River, auf der sich Pittsburg Landing befindet, ist steil, felsig und ragt bis zu 30 Meter über den Wasserspiegel des Flusses auf. Die Shiloh-Kirche, die der Schlacht ihren Namen verlieh, war ein methodistisches Gotteshaus. Es war eine kleine, aus behauenen Holzstämmen errichtete Hütte mit einem Schindeldach, die etwa drei Kilometer von der Anlegestelle entfernt an der Hauptstraße nach Corinth lag. Unmittelbar nach unserer Ankunft wurden wir in die Division von General B. M. Prentiss eingegliedert und marschierten sogleich zu unserem Lagerplatz. Etwa einen dreiviertel Kilometer von der Anlegestelle entfernt gabelte sich die Straße: Nach rechts verlief an der Shiloh-Kirche vorbei die Hauptstraße nach Corinth, während der andere Weg nach links weiterführte. Nach einigen Kilometern vereinigten sich die beiden Straßen wieder. General Prentiss' Division lagerte im rechten Winkel zur linken der beiden und unser Regiment schlug seine Zelte beinahe an der äußersten Linken von Prentiss' Linien auf. Wenn ich mich recht entsinne, lagerte eine Brigade aus Shermans Division unter General Stuart etwa anderthalb Kilometer zu unserer Linken am Lick Creek, wo die Hamburg & Purdy Straße den Bach überquert. [Anm. d. Übers.: David Stuart hatte, wie zu diesem Zeitpunkt die Mehrheit der Brigadekommandeure in General Grants Army of the Tennessee, den Rang eines Colonels inne. Er erlitt am ersten Tag der Schlacht eine schwere Verwundung an der Schulter.] In der Lücke zwischen der linken Flanke von Prentiss und dem Lager von Stuart befanden sich keine Truppen. Dies weiß ich gewiss, da ich in den wenigen Tagen zwischen unserer Ankunft und der Schlacht in den Wäldern zu unserer Linken (zwischen uns und Stuart) umherstreifte und nach Indianer-Knoblauch und Sanikel suchte.
Das Lager unseres Regiments lag etwa drei Kilometer von der Anlegestelle entfernt. Unsere Zelte standen inmitten des Waldes und vor dem Lager befand sich ein kleines Feld von etwa acht Hektar. Wir waren in westliche Richtung, oder möglicherweise auch nach Südwesten, ausgerichtet.
Niemals werde ich vergessen, wie froh ich war, endlich von diesem alten Dampfer herunterzukommen, mit beiden Füßen wieder auf festem Boden zu stehen und mein Zelt unter den Bäumen aufzuschlagen. Meine Kompanie hatte die Reise von St. Louis nach Pittsburg Landing auf dem Oberdeck des Dampfschiffes verbracht und unsere Wegzehrung hatte aus Hartkeksen und rohem, fettigem Fleisch bestanden, das wir mit Flusswasser hinunterspülten. Wir verfügten über keine Kochstelle und kannten den Trick noch nicht, das überschüssige heiße Wasser aus den Heizkesseln aufzufangen und damit Kaffee zuzubereiten. Nun da wir uns jedoch an Land befanden und Feuerholz in Hülle und Fülle verfügbar war, besserte sich unser Speiseplan wieder. Ich werde wohl niemals wieder Fleisch essen, das so gut schmeckt wie der damalige gebratene Schweinebauch mit "Flapjacks" und reichlich gutem, starkem Kaffee. Wir hatten den regulären Drillbetrieb noch nicht aufgenommen, der Wachtdienst war nicht anstrengend und generell wurde alles nicht so genau genommen. Dazu kam noch das angenehme Klima. Wir hatten gerade den wolkenverhangenen, frostigen Norden hinter uns gelassen, wo es kalt und trostlos war, während die Luft hier so mild und warm war wie der späte Mai in Illinois. Das grüne Gras schoss aus der Erde, die Veilchen blühten, die Bäume schlugen aus und die Wälder wimmelten von gefiederten Sangeskünstlern. Es gab da einen Rotkardinal, der sich jeden Morgen bei Sonnenaufgang auf der großen Schwarzeiche bei unserer Kompaniestraße niederließ und etwa eine Stunde lang sein lebhaftes, lärmendes Liedchen übte, welches, so deutlich wie nur irgendein menschliches Kommando, auszurufen schien: "Heda, Jungs! Aufstehen, Jungs! Aufstehen!" Unter uns ging das Gerücht um, er sei ein unionstreuer Rotkardinal, der sich dem Regiment angeschlossen habe, um uns den morgendlichen Weckruf zu trällern.
Auf diese Weise verlebten wir eine angenehme Zeit bis zu jenem ereignisreichen Sonntagmorgen am 6. April 1862. Gemäß dem Almanach der "New York Tribune" für jenes Jahr ging die Sonne an diesem Morgen in Tennessee um 05.38 Uhr auf. Ich besaß keine Taschenuhr, bin mir jedoch sicher, dass die Sonne bereits anderthalb Stunden am Himmel stand, als die Kämpfe an unserem Abschnitt der Linie losbrachen. Wir waren bei Sonnenaufgang aufgestanden, hatten den Morgenappell abgehalten und unser Frühstück zubereitet und verzehrt. Anschließend bereiteten wir uns auf die allsonntagmorgendliche Inspektion vor, die um 09.00 Uhr stattfinden sollte. Die Jungs trieben sich auf den Kompaniestraßen und vor dem Appellplatz herum, polierten ihre Musketen oder reinigten ihre Schuhe, Jacken, Hosen und sonstige Kleidung. Es war ein wunderbarer Morgen. Die Sonne schien hell durch die Bäume und es fand sich kein Wölkchen am Himmel. Es war wie ein Sonntag auf dem Lande zuhause. An den Wochentagen herrschte an der Anlegestelle ein unablässiges Kommen und Gehen von Armeewagen und das Knirschen ihrer Räder, die Rufe und Flüche der Fuhrleute, das Knallen der Peitschen, das Brüllen der Maultiere, das Wiehern der Pferde, die Kommandorufe der Offiziere bei den Drillübungen, das lärmende Treiben in den Lagern, das Schmettern der Signalhörner und die rollenden Wirbel der Trommeln – all dies vermengte sich zu einer ständigen Geräuschkulisse, die von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang andauerte. Jener Morgen jedoch war seltsam still. Die Wagen gaben keinen Laut von sich, die Maultiere kauten in aller Ruhe ihr Heu und die Fuhrleute verschonten uns mit ihrem Lärm. Ich lauschte interessiert den klagenden Lauten einer Trauertaube in einem nahen Gehölz, während auf dem toten Ast eines im Lager stehenden großen Baumes ein Specht seinen "Trommelwirbel" veranstaltete. Er klang exakt wie seine nördlicheren Brüder, die ich schon tausendmal zuhause in Otter Creek in den Bäumen gehört hatte.
Plötzlich ertönte in einiger Entfernung zu unserer Rechten, aus Richtung der Shiloh-Kirche, ein dumpfes, kräftiges "Bumm!", dann ein weiteres und noch eines. Wir alle sprangen auf, als hätten wir einen elektrischen Schlag erhalten und starrten einander verblüfft an. "Was ist das?" fragte ein jeder, aber niemand vermochte eine Antwort zu geben. Das Donnern wurde heftiger und erfolgte in kürzeren Abständen und schon wenige Sekunden nach jenem dumpfen, unheilvollen Grollen aus dem Südwesten wurde ein leiseres, gedämpftes, andauerndes Brausen hörbar. Dieses Geräusch war unverkennbar. Das war kein Trupp von Wachtposten, die nach ihrer Ablösung ihre Waffen leerfeuerten; das war das stetige Prasseln tausender Musketen. Nun wurde uns bewusst, dass eine Schlacht losgebrochen war.
Was ich gerade geschildert habe, ereignete sich innerhalb weniger Sekunden und nahezu zeitgleich mit dem Prasseln der Musketen ertönte in unserem Lager der Trommelwirbel. Es folgte eine Szene verzweifelter Hast, wie ich sie zuvor niemals gesehen hatte und auch danach nie wieder sehen sollte. Inmitten all dieser Hektik und Verwirrung, während die Jungs sich ihre Patronentaschen umschnallten und noch bevor wir in Kompanien angetreten waren, kam ein berittener Staboffizier von rechts her die Linie entlang herangaloppiert. Er stoppte direkt in unserer Kompaniestraße, indem er scharf die Zügel seines Pferdes herumriss, wobei dessen beschlagene Hufe den kleinen Haufen blechernen Kochgeschirrs zertrampelten, von dem meine Messe am Morgen ihr Frühstück gegessen hatte. Dem Pferd lief der Schaum von den Flanken und seine Augen und Nüstern waren rot wie Blut. Der Offizier blickte sich gehetzt um und rief aus: "Herr im Himmel! Das Regiment ist noch nicht gefechtsbereit! An der Rechten wird schon seit über einer Stunde gekämpft!" Er riss sein Pferd herum und verschwand in jene Richtung, wo das Zelt des Colonels stand.
Ich weiß, dass die Schlacht an jenem Morgen gemäß der Geschichtsschreibung gegen 04.30 Uhr begann, dass sie von einem Erkundungstrupp eröffnet wurde, den General Prentiss am frühen Morgen ausgesandt hatte und dass General Shermans Division an der rechten Flanke frühzeitig vor dem Nahen der Rebellen gewarnt wurde und sich in aller Ruhe darauf vorbereiten konnte. Ich habe diese Dinge in Büchern gelesen und bestreite sie nicht. Ich erzähle lediglich, wie die Situation sich einem einfachen Soldaten an der Linken von Prentiss' Linie gegen 07.00 Uhr an jenem Morgen darstellte.
Die Kompanien traten an und wir marschierten auf den Appellplatz, wo sich das Regiment in Gefechtslinie formierte. Es ertönte der Befehl: "Ohne Kommando laden!", doch dies hatten wir bereits vorhergesehen und die meisten von uns hatten ihre Musketen instinktiv schon vor dem Antreten in Kompanien geladen. Während all dessen kam der Lärm zu unserer Rechten näher und wurde lauter. Unser alter Colonel kam herangeritten, bezog vor dem Zentrum der Regimentslinie Aufstellung und rief: "Bataillon, Achtung!" Unser aller Augen waren auf ihn gerichtet und wir waren gespannt, was jetzt wohl kommen mochte. Es folgte die leidenschaftliche Ansprache des alten Herrn, die uns auf die Schlacht einstimmen sollte.
"Gentlemen," sagte er mit einer Stimme, die jedermann im Regiment hören konnte, "denken Sie an Ihren Heimatstaat und tun Sie am heutigen Tage Ihre Pflicht wie tapfere Männer!"
Das war alles. Ein Kriegsjahr später hätte uns der alte Herr zweifelsohne als "Soldaten" angesprochen und nicht als "Gentlemen" und zudem hätte er wohl die Nennung des "Heimatstaates" unterlassen, da diese unangenehm an die Beweggründe der Rebellen erinnerte. Er war jedoch ein überzeugter Demokrat im Sinne von Stephen Douglas und seine Gedanken kreisten wohl noch um die Schlacht von Buena Vista im Mexikokriege, wo sich angeblich ein Regiment aus einem westlichen Staate schändlich betragen und das Ansehen jenes Staates so schmählich besudelt hatte, dass es nur im Wüten des jetzigen Bürgerkrieges wiederhergestellt werden konnte. [Anm. d. Übers.: Stephen Arnold Douglas war ein erfolgloser Kandidat der gespaltenen Demokratischen Partei bei den Präsidentschaftswahlen des Jahres 1860. Er setzte sich für die Rechte der Einzelstaaten ein und verurteilte sowohl die Abolitionistenbewegung in den Nordstaaten als auch die Sezessionsbestrebungen in den Südstaaten. Nach Ausbruch des Bürgerkriegs hielt er zur Union, starb jedoch bereits im Juni 1861.] Nach der kurzen Anstachelung durch unseren Colonel marschierte das Regiment unverzüglich über das bereits erwähnte kleine Feld und nahm seinen Platz in der Kampflinie ein. Vor uns befand sich der Wald und hinter uns das freie Feld. Wir richteten uns an unserer Fahne aus und warteten, Gewehr bei Fuß, auf den Angriff. Der Lärm zu unserer Rechten war inzwischen ohrenbetäubend. Die Rebellenarmee verbreiterte ihre Front und die Schlacht rollte unaufhaltsam auf unsere Position zu. Zwischen den Bäumen an unserer rechten Flanke konnten wir bereits bläuliche Rauchringe aufsteigen sehen und der beißende Geruch verbrannten Schwarzpulvers hing in der Luft. Während das Prasseln von rechts her die Linie entlang auf uns zu brauste, erinnerte es mich an ein heftiges Sommergewitter, dessen Regen über dem ausgedörrten Boden eines Stoppelackers niederging, nur war es etwa eine Million Mal lauter.
Hier standen wir also stillschweigend am Rande des Waldes und warteten darauf, dass der Sturm über uns hereinbrechen möge. Ich weiß noch exakt, an was ich in jenem Moment dachte. Vor meinem inneren Auge sah ich das kleine Blockhaus, weit entfernt, im Hinterlande des westlichen Illinois. Ich konnte meinen Vater sehen, wie er auf der Veranda saß und in der dünnen Lokalzeitung las, welche am Abend zuvor mit der Post gekommen war. Meine Mutter war auch da und machte meine kleinen Brüder ausgehfein für die Sonntagsschule. Unser alter Hund döste in der Sonne. Die Hühner stolzieren gackernd in der Scheune umher. All diese Dinge und noch hundert weitere teure Erinnerungen durchfluteten meinen Geist und ich schäme mich nicht, einzugestehen, dass ich alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen militärischen Ehren bereitwilligst hergegeben hätte, wäre ich dafür durch irgendeine Zauberei plötzlich auf den Hof jenes kleinen Heims in tausend Kilometern Entfernung von allen Schrecken menschlicher Kriegsführung versetzt worden.
Die Zeitspanne, während der wir dort herumstanden und auf die Attacke warteten, kann nicht mehr als fünf Minuten betragen haben. Plötzlich flackerte schräg zu unserer Rechten eine lange, gewellte Reihe von kleinen Blitzen auf, dann eine weitere und noch eine! Es war dies das Sonnenlicht, das von Musketenläufen und Bajonetten reflektiert wurde. Und dann … da waren sie schließlich! Eine langgezogene, braune Linie, die Musketen an der rechten Schulter, in makelloser Formation – so kamen sie direkt durch den Wald auf uns zu.
Wir eröffneten sofort das Feuer. Eine Welle roter Flammen rollte vom einen Ende des Regiments zum anderen und der Lärm, den wir am Rande unseres Feldes veranstalteten, klärte General Prentiss zweifellos darüber auf, dass die Rebellen die äußerste Linke seiner Linie erreicht hatten. Wir hatten erst zwei oder drei Salven abgefeuert, als wir aus irgendeinem Grunde (ich habe niemals erfahren, weshalb) den Befehl erhielten, uns über das Feld zurückzuziehen, was wir auch prompt taten. Unsere gesamte Linie, soweit ich nach rechts sehen konnte, wich zurück. Am Waldrand auf der gegenüberliegenden Seite des Feldes, in der Nähe unserer Zelte, nahmen wir wieder Aufstellung und eröffneten erneut das Feuer. Die Rebellen waren uns natürlich gefolgt und nahmen nun jene Stellung ein, die wir gerade verlassen hatten. Hier fochten wir unseren ersten harten Kampf des Tages aus. Nach dem Ende der Schlacht sagten unsere Offiziere, wir hätten diese Position eine Stunde und zehn Minuten lang gehalten. Ich selbst vermag darüber nichts zu sagen. Ich konnte die Zeit nicht schätzen, da ich anderweitig beschäftigt war.
Von unserer zweiten Stellung zogen wir uns zurück, da (wie unsere Offiziere später sagten) die Truppen zu unserer Rechten nicht mehr standhalten konnten und unsere Flanke bedroht war. Wahrscheinlich bedienten sich diese Burschen zu unserer Rechten der gleichen Entschuldigung und womöglich stimmte sie sogar. Wie dem auch sei, wir zogen uns keine Minute zu früh zurück. Als ich mich hinter dem gestürzten Baumstamm aufrichtete, von dem aus ein Grüppchen von uns gefeuert hatte, sah ich bereits Männer in grauer und brauner Kleidung mit ihren Musketen durch das Lager zu unserer Rechten rennen. Ich sah noch etwas anderes, das mir ein Schauern über den Rücken jagte: eine Flagge, wie ich sie noch niemals zuvor gesehen hatte. Sie war ein farbenfrohes Ding mit roten Streifen und sofort durchblitzte mich die Erkenntnis, dass dies eine Rebellenflagge sein müsse. Sie flatterte nicht weiter als 50 Meter von mir entfernt. Der Rauch um sie herum hing niedrig und dicht und so konnte ich den Mann, der sie trug, nicht sehen, aber die Fahne selbst war deutlich zu erkennen. Sie bewegte sich in abrupten Sprüngen vorwärts, woran ich erkannte, dass ihr Träger im Laufschritt vorstürmte. Ziemlich genau zu diesem Zeitpunkt setzten wir uns nach hinten ab. Wir hielten dabei keinerlei Formation ein und waren nur bestrebt, schnellstmöglich das Weite zu suchen. Ich rannte unsere Kompaniestraße entlang und als ich das große Sibley-Zelt meiner Messe erreichte, kam mir der Gedanke, meinen Tornister mit all meinen Habseligkeiten, darunter mein unersetzlicher, kleiner Packen von Briefen meiner Eltern, zu bergen. Ich sagte mir: "Ich rette meinen Tornister, komme, was da wolle!" aber nach einem raschen Blick über meine linke Schulter besann ich mich eines Besseren und eilte weiter. Weder meinen Tornister noch seinen Inhalt habe ich jemals wieder gesehen.
Unsere arg zerzausten Truppen formierten sich schließlich einen knappen Kilometer hinter unserem Lager auf dem Kamm eines sanften Hügels, der mit dichtem Gehölz bewachsen war. Ich erkannte mein Regiment an dem kleinen, grauen Pony, das unser alter Colonel ritt und rannte an meinen Platz in der Linie. Während wir dort standen und einmal mehr dem Feinde entgegensahen, bemerkte ich eine scheinbar endlose Kolonne von Soldaten in blauen Uniformen, die an unserer Flanke vorbeimarschierten und nach rechts in den Wald verschwanden. Ich hörte, wie unser alter, deutscher Adjutant namens Cramer in seinem unverkennbaren Zungenschlag zum Colonel sagte: "Das sin' die Truppe vom Gen'ral Hurlbut. Er bild' 'ne neue Linie dort im G'hölz." Als ich dies hörte, jubelte ich innerlich: "Ein Hoch auf General Hurlbut und seine Jungs im Gehölz! Vielleicht reißen wir die ganze Sache ja doch noch herum!" Dieses Gefühl der Hoffnung werde ich niemals vergessen. Unser erster Rückzug am Morgen über das Feld an den Rand unseres Lagers hatte mich verwirrt, aber dann dachte ich, dass all dies wohl nur irgendeine "höhere Strategie" gewesen sein mochte und planmäßig so geschehen sei. Als wir dann allerdings unser Lager aufgeben und einen knappen Kilometer weit davonrennen mussten, war ich überzeugt, wir seien auf ewig entehrt und in meinem Kopf kreiste die eine Frage: "Was werden die Leute zuhause nur hierzu sagen?"
Ich litt elendigen Durst und da wir gerade untätig waren, schlüpfte ich aus der Formation und rannte auf der Suche nach Wasser zu einer kleinen Senke hinter unserer Linie. Ich fand eine Pfütze, warf mich vor ihr auf die Erde und trank mit gierigen Schlucken. Als ich mich wieder erhob, sah ich in etwa fünf Metern Entfernung einen Offizier, der ebenfalls seinen Durst stillte, wobei er sein Pferd am Zügel festhielt. Er stand auf und ich erkannte in ihm unseren alten Adjutanten. Normalerweise hätte ich es niemals gewagt, ihn ohne einen dienstlichen Anlass zu belästigen, aber die gegenwärtige Lage der Dinge hatte mich mit der nötigen Tapferkeit erfüllt. "Herr Adjutant" sagte ich, "Was bedeutet das alles? Warum rennen wir davon? Sind wir etwa geschlagen?" Er blies einige Wassertropfen aus seinem Schnauzbart und antwortete rasch in unbekümmertem Tonfalle: "Oh nein, das hat scho' alles seine Ordnung. Wir sin' nur zurück, um hier die Reserve zu bilden. Gen'ral Buell is' mit 50.000 Mann auf dem Weg über'n Fluss und wird bald hier sein. Und Gen'ral Lew Wallace kommt von Crump's Landing mit weit'ren 15.000. Wir wer'n sie dreschen, wir wer'n sie dreschen. Geh zurück zu deiner Kompanie." Ich eilte frohen Herzens und im Laufschritt zurück. Als ich meinen Platz neben meinem guten Freund Jack Medford wieder einnahm, erzählte ich ihm: "Jack, ich habe mich gerade mit dem alten Adjutanten unterhalten, während ich mir unten am Rinnsal einen Schluck Wasser gegönnt habe. Er sagt, Buell käme mit 75.000 Mann und jeder Menge Kanonen über den Fluss und irgendein anderer General sei mit weiteren 25.000 Männern von Crump's Landing auf dem Weg hierher. Er hat mir erklärt, dass wir uns absichtlich hierher zurückgezogen haben und dass wir die Rebellen ordentlich verdreschen werden, gar keine Frage. Ist das nicht großartig?" Ich hatte die Zahlen des Adjutanten ein wenig nach oben korrigiert, da mir diese Neuigkeit so fantastisch erschien, dass ich dachte, 25.000 bis 30.000 Mann mehr oder weniger würden kaum ins Gewicht fallen. Als sich die weiteren Stunden des Tages dann jedoch in die Länge zu ziehen begannen, ohne dass Buell oder Wallace erschienen wären, begann mein Vertrauen in die Aufrichtigkeit des Adjutanten beträchtlich zu bröckeln.
Zu diesem Zeitpunkt wurde mein Regiment aus Prentiss' Division ausgegliedert und sollte für den Rest des Tages nicht mehr bei ihr kämpfen. Man schickte uns nach rechts, um dort eine Geschützbatterie zu unterstützen, deren Namen ich bis heute nicht erfahren konnte. (Einige Jahre nach der Niederschrift dieses Textes erfuhr ich, dass es sich um Richardson's Battery, Co. D, 1st Missouri Light Artillery gehandelt hatte.) Die Kanonen waren auf der Kuppe einer Anhöhe aufgestellt und als wir sie erreichten, waren sie schon lebhaft bei der Arbeit. Unsere neue Stellung befand sich etwa 100 Meter hinter der Batterie, wo wir uns flach auf die Erde legen sollten. Von der Stellung der Geschütze zu unserer Position hin fiel das Gelände sanft ab und da wir uns so flach wie möglich an die Erde pressten, sausten die Kugeln und Granaten der Rebellen über uns hinweg.
Hier war es auch, dass ich gegen 10.00 Uhr morgens erstmals Grant sah. Er saß natürlich zu Pferde, war von seinem persönlichen Stabe umgeben und war offensichtlich unterwegs, um sich mit eigenen Augen einen Überblick über seine Linien zu verschaffen. Er stürmte an der Spitze seines Stabes im Galopp zwischen uns und den Geschützen an uns vorbei. Die Batterie lieferte sich noch immer ein hitziges Gefecht mit der feindlichen Artillerie und so zischten Kugeln und Granaten über uns hinweg und rissen Äste aus den Bäumen, aber Grant ritt vollkommen gleichmütig durch diesen Sturm. Er schien die Geschosse so wenig zu beachten, als seien sie Papierkügelchen.
Unsere Bewachung dieser Batterie dauerte bis 14.00 Uhr an. Dann wurden wir nach rechts geschickt, schwenkten nach links um, überquerten die zu unserer Linken gelegene Corinth Straße und formierten uns in Gefechtslinie. So kletterten wir durch einen kleinen Graben und eine Anhöhe hinauf, wo wir ein Regiment an der linken Flanke von Hurlbuts Linie ablösten. Die Truppen hier waren in erbitterte Kämpfe verwickelt und das bereits, wie wir später erfuhren, seit über vier Stunden. Ich erinnere mich noch, wie wir die Anhöhe hinauf vorrückten und zu schießen begannen. Ich schaute mich um und der erste Anblick, der mir ins Auge sprang, war eine "Schwade" (wie wir im Westen sagen) von toten Männern in blauen Uniformen. [Anm. d. Übers.: "Schwade" bezeichnet in der Landwirtschaft eine Reihe abgemähten, zusammengerechten Grases oder Getreides.] Einige lagen zusammengekrümmt mit den Gesichtern im Schmutz, andere mit ihren fahlen Gesichtern dem Himmel zugewandt. Diese tapferen Jungs waren totgeschossen worden, während sie versucht hatten, die Linie zu halten. Wir verteidigten diese Stellung, bis wir unsere Munition verschossen hatten und von einem anderen Regiment abgelöst wurden. Nachdem wir unsere Patronentaschen wieder aufgefüllt hatten, wurden wir erneut mit der Unterstützung unserer Geschützbatterie beauftragt. Die Jungs legten sich wieder auf die Erde und begannen, sich leise miteinander zu unterhalten. Viele unserer Kameraden, die noch eine Stunde zuvor lebendig und wohlauf gewesen waren, hatten wir tot auf dieser blutgetränkten Anhöhe zurücklassen müssen. Und die Schlacht tobte noch immer, zur Linken wie zur Rechten, allüberall … es war ein stetes, fürchterliches Lärmen, das nie wieder enden zu wollen schien.
Es war wohl irgendwann zwischen 16.00 und 17.00 Uhr, als eine seltsame Stille eintrat. Unsere Batterie stellte das Feuer ein und die Kanoniere stützten sich auf ihre Geschütze und begannen zu lachen und sich zu unterhalten. Plötzlich kam ein Stabsoffizier angeritten und wechselte einige vertrauliche Worte mit dem Kommandeur der Batterie, bevor er an unseren Colonel herantrat und auch ihm etwas zuflüsterte. Sogleich wurden von einer Senke im Hinterland die Artilleriepferde herangeführt, die Kanonen wurden angespannt und die Batterie setzte sich quer durch das Gehölz nach hinten ab. Auch wir wurden in Bewegung gesetzt und folgten ihr. Es war dermaßen still, dass die einzigen Geräusche, die ich hören konnte, aus dem Knirschen der Räder der Geschützlafetten und Protzen bestanden, die durch das Gesträuch rollten. Wir erreichten den Waldrand und überquerten ein freies Feld. Hier sah ich vor uns und zu unserer Rechten Reihen von Männern in Blau, die alle in die gleiche Richtung marschierten wie wir und es war offensichtlich, dass wir uns erneut zurückzogen. Plötzlich brach von links, von rechts und von unserer gerade aufgegebenen Stellung hinter uns ein fürchterlicher Donner los und die Kugeln flogen wie Hagel um uns herum. Unsere Reihen eilten im Laufschritt weiter. Eine Zeit lang wurde noch versucht, einen organisierten Rückzug durchzuführen, aber bald brach jegliche Ordnung völlig auseinander. Ich war zutiefst verzweifelt und dachte, die Schlacht sei unrettbar verloren. Eine wirre Masse von Männern, Kanonen, Protzen, Fuhrwerken und Ambulanzwagen, allesamt Trümmer einer zerschlagenen Armee, strömte über einen schmalen Trampelpfad auf die Anlegestelle zu, während von unserem Rücken her ein erbarmungsloser Bleiregen auf uns einprasselte. Bei dieser katastrophalen Lage der Dinge konnte kein Zweifel daran bestehen, dass die Division von General Prentiss in Gefangenschaft geraten war.
An dieser Stelle möchte ich kurz abschweifen, um von einer kleinen Begebenheit zu berichten, die sich während jenes kritischen Stadiums der Schlacht zutrug und mir als rührendes Beispiel des Patriotismus und der selbstlosen Opferbereitschaft für unsere Sache (Eigenschaften, die vielen der einfachen Unionssoldaten zu eigen waren) im Gedächtnis geblieben ist.
Es gab in meiner Kompanie einen Deutschen mittleren Alters namens Charles Oberdieck. Laut der Stammrolle der Kompanie war er im damaligen Königreich Hannover (einer heutigen Provinz von Preußen) gebürtig. Er war ein typischer Deutscher: hellblondes Haar, blauäugig, ruhig und wortkarg, von einfacher und dürftiger Bildung, jedoch ein Mustersoldat, der ohne Widerrede oder Murren die Anweisungen seiner Befehlshaber befolgte. Vor dem Kriege hatte er sich seinen Lebensunterhalt verdient, indem er in den bewaldeten Hügeln bei der Mündung des Illinois River Feuerholz hackte oder für 14 Dollars Monatslohn als Arbeitskraft bei den Farmen auf dem Lande aushalf. Er war Junggeselle, seine Eltern waren bereits verstorben und er hatte keine lebenden Verwandten, weder in seinem Vaterlande noch in seiner neuen Heimat. Zur Zeit unserer Einschreibung waren wir weitläufige Nachbarn gewesen. Ich hatte ihn bereits im Zivilleben gekannt und so war er mir gegenüber ein wenig redseliger als bei den übrigen Jungs der Kompanie. Ein oder zwei Tage nach der Schlacht saßen wir zusammen in unserem Lager im Schatten eines Baumes und sprachen über unsere Erlebnisse im Kampf. "Charley" fragte ich ihn, "Was hast du am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr empfunden, als sie unsere Linie zerschlagen hatten, wir uns ungeordnet zurückzogen und es so aussah, als sei die ganze unselige Angelegenheit entschieden?" Er klopfte die Asche aus seiner Pfeife, warf mir einen raschen Blick zu und entgegnete: "Ich will dir mal sagen, was ich empfunden hab'. Ich sorg' mich nicht mehr um Charley. Ich hab' kein Weib und keine Kinder, kein' Vater und keine Mutter. Wenn Charley getötet wird, dann int'ressiert das keinen, keiner wird um ihn weinen. Also denk' ich nicht an mich, aber eins kann ich dir sagen: um uns're Sache tät's mir leid!"
Der noble, einfache Charley! Zu jener Stunde, als alles verloren schien, lag ihm nur die Gefahr für die Sache auf der Seele. Als wir das feindselige, triumphierende Donnern der Rebellengeschütze in unserem Rücken hörten, das uns wie die Totenglocke für dieses letzte, große Experiment des zivilisierten Menschen, unter den Nationen dieser Erde eine vereinigte Republik frei von dem Fluche allmächtiger Könige und selbstsüchtiger Adeliger zu errichten, in den Ohren dröhnte – in diesem Moment dachte er, wie er es in seinen einfachen Worten auszudrücken versuchte, einzig und alleine an den drohenden Untergang der Sache.
Wir waren auf unserer bereits erwähnten Flucht wohl nur noch weniger als einen Kilometer von der Anlegestelle entfernt, als wir auf eine lange Gefechtslinie von Soldaten in Blau stießen, die sich in tadelloser Formation und Gewehr bei Fuß quer über die Straße erstreckte, bis sie beiderseits der Wald vor unseren Blicken verbarg. Was hatte das zu bedeuten? Wo kamen diese Burschen her? Ich lief neben Enoch Wallace, dem Ordonnanzsergeant meiner Kompanie, her. Er war ein nervenstarker und mutiger Mann und mit seinen Worten und Taten hatte er an jenem Tage mehr dazu beigetragen, uns unerfahrene Jungs zum Halten unserer Stellungen und zur Erfüllung unserer Pflicht zu animieren als jeder andere Mann in der Kompanie. Doch angesichts der scheinbar verzweifelten Lage der Dinge hatte selbst er offenbar jegliche Hoffnung aufgegeben. Ich fragte ihn: "Enoch, was tun diese Männer hier?" Er antwortete mit leiser Stimme: "Ich glaube, man hat sie hier postiert, um die Rebellen in Schach zu halten, bis die Armee über den Fluss gesetzt hat." Dies war zweifellos die Vermutung eines jeden halbwegs intelligenten Soldaten in unserer geschlagenen Kolonne und genau hier zeigt sich, wie wenig der einfache Soldat von den tatsächlichen Entwicklungen im größeren Maßstabe wusste. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt nicht, dass diese Gefechtslinie die letzte Stellung der "Fighting 4th Division" unter General Hurlbut darstellte, dass zu ihrer Rechten die Division von McClernand (die Jungs von Fort Donelson) stand und dass zu deren Rechten die rechtwinkelig zurückgebogenen Truppen des guten, alten Sherman die rechte Flanke der Armee bildeten und sich verbissen an der Straße von Crump's Landing über den Snake Creek festkrallten, über die Lew Wallace mit seinen 5.000 Mann heranmarschierte. Kurz gesagt: Wir hatten dem Feinde noch immer eine ungebrochene Frontlinie entgegenzusetzen, die aus Männern bestand, welche noch keineswegs von unserer Niederlage überzeugt waren. Auch wussten wir nicht, dass unser flüchtender Haufen lediglich aus einigen Regimentern von Hurlbuts Division und wenigen weiteren isolierten Einheiten bestand, welche man nicht rechtzeitig von Hurlbuts planmäßigem Rückzug zwecks Formierung einer neuen Verteidigungslinie in Kenntnis gesetzt hatte und welche deswegen beinahe das Schicksal von Prentiss' Männern geteilt hätten und den Rebellen als Gefangene in die Hände gefallen wären. Ich selbst fand diese Dinge erst 20 Jahre nach der Schlacht heraus und doch sind sie so unzweifelhaft wahr wie die Tatsache, dass gestern Morgen die Sonne aufging. Wir marschierten also durch Hurlbuts Linie hindurch, hielten an, formierten uns neu und wandten uns wieder dem Feind entgegen. Man postierte uns ein wenig hinter Hurlbut, wo wir einige schwere Geschütze bewachten. Es muss dies so etwa um 17.00 Uhr gewesen sein. Plötzlich ertönte von unserer äußersten Linken, ein wenig oberhalb der Anlegestelle, her eine ohrenbetäubende Explosion, die förmlich die Erde unter unseren Füßen erzittern ließ und der in kurzen und regelmäßigen Abständen weitere Explosionen folgten. Der Ausdruck von Verwunderung und Neugierde auf den Gesichtern der Soldaten wich bald offenkundiger Freude und Begeisterung, als wir begriffen, dass sich die Kanonenboote endlich den Festivitäten angeschlossen hatten und 25-Pfund Parrott-Granaten in den Hohlweg vor Hurlbuts Stellung feuerten (sehr zum Schrecken und Unbehagen unserer Widersacher).
Die letzte Position, die mein Regiment besetzt hielt, lag nahe der Straße zur Anlegestelle. Plötzlich hörte ich die Klänge von Militärmusik und sah eine Kolonne die Straße heraufmarschieren. Ich schlüpfte aus der Formation und lief an den Straßenrand, um zu schauen, welche Truppen das wohl sein mochten. Ihre Kapelle spielte "Dixie's Land" und sie war gut. Die Männer marschierten im Eilschritt und trugen ihre Waffen, Patronentaschen, Brotbeutel, Feldflaschen und aufgerollten Decken bei sich. Ich sah, dass sie offensichtlich noch nicht gekämpft hatten, da ihre Gesichter nicht von Pulverrauch geschwärzt waren. "Welches Regiment ist das?" fragte ich einen jungen Sergeant, der die Marschkolonne flankierte. Er antwortete vergnügt: "Wir sind das 36th Indiana, die Vorhut von Buells Armee."
Als ich dies hörte, hütete ich mich, meine Mütze in die Luft zu schleudern und zu jubeln, denn somit hätte ich diesen Burschen aus Indiana nur einen Anlass geliefert, mich zu necken und mit Spötteleien zu überziehen, was ich natürlich tunlichst vermeiden wollte. Also verschluckte ich einen tiefen Seufzer der Erleichterung und blieb scheinbar seelenruhig an Ort und Stelle stehen, während mir innerlich ob dieser sagenhaften Neuigkeit das Blut in der Halsschlagader hämmerte und mein Herz vor Freude schier durch meine enge Uniformjacke bersten wollte. Einem Soldaten muss ich die unbeschreibliche Freude beim Anblick nahender Waffenbrüder in der finstersten Stunde einer Schlacht wohl nicht erst zu erklären versuchen. Was mich persönlich betrifft, so kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, dass mir während meiner gesamten bescheidenen Soldatenlaufbahn der Anblick von Verstärkungen niemals wieder so ersehnt und willkommen war wie an jenem Sonntagabend, als die Strahlen der sinkenden Sonne an den Bajonetten von Buells Vorhut blitzten, während die Männer an den Abhängen von Pittsburg Landing Aufstellung nahmen.
Hiermit ist mein Bericht über die Schlacht so gut wie beendet. Meines Wissens wurde an jenem Abend nach Buells Überquerung des Flusses kaum noch gekämpft. Wir hatten wohl noch etwa eine volle Stunde Tageslicht, als alles, was man als organisierte und stetige Schusswechsel bezeichnen könnte, gänzlich erstarb. Was hätte passieren können, wenn Beauregard seine Truppen an unserer Linken konzentriert und versucht hätte, noch am späten Sonntagabend eine Entscheidung zu erzwingen, muss notwendigerweise reine Spekulation bleiben und hierbei hätte die Meinung eines einfachen Soldaten wohl kein sonderliches Gewicht.
Am folgenden Tage wurde mein Regiment in Reserve gehalten und griff nicht mehr in die Kämpfe ein, weswegen ich über diesen Tag keine persönlichen Erlebnisse mitzuteilen habe. Nach der Schlacht von Shiloh wollte es das Schicksal, dass ich noch zu weiteren hitzigen Waffengängen meinen bescheidenen Beitrag leisten sollte, aber Shiloh war meine Feuertaufe. Hier sah ich erstmals, wie eine Muskete in tödlicher Absicht abgefeuert wurde, hier hörte ich erstmals das Pfeifen einer fliegenden Kugel und hier sah ich erstmals einen Menschen eines grausigen Todes sterben. All meine Erfahrungen, Gedanken, Eindrücke und Gefühle während jenes blutigen Sonntages werden mich zeit meines Lebens nicht mehr verlassen.