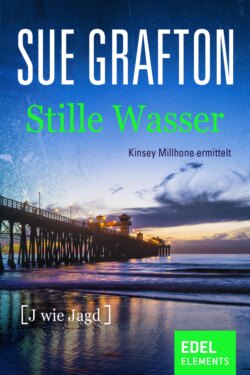Читать книгу Stille Wasser - Sue Grafton - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеMittags, ich fühlte mich ziemlich elend, ging ich zu Fuß zum Minimarkt an der Ecke und kaufte mir ein Thunfischbrot, einen Beutel Chips und eine Pepsi. In diesem Zustand hatte ich keine Lust, mir wegen gesunder Ernährung Kopfzerbrechen zu machen. Ich kehrte in mein Büro zurück und aß an meinem Schreibtisch. Zum Nachtisch lutschte ich ein paar Hustenbonbons mit Kirschgeschmack.
Lieutenant Whiteside meldete sich schließlich um halb drei mit Entschuldigungen wegen der Verspätung. »Lieutenant Robb sagte mir, Sie haben eine Spur zu unserem alten Freund Wendell Jaffe. Erzählen Sie doch mal.«
Zum zweitenmal an diesem Tag gab ich einen zensierten Bericht meines Zusammentreffens mit Wendell Jaffe. Am anderen Ende der Leitung blieb es still, und daraus konnte ich nur schließen, daß sich Lieutenant Whiteside eifrig Notizen machte.
Er sagte endlich: »Haben Sie eine Ahnung, ob er einen falschen Namen benutzt?«
»Wenn Sie nicht auf Einzelheiten bestehen, bin ich bereit zuzugeben, daß ich einen ganz, ganz flüchtigen Blick auf seinen Paß werfen konnte. Er ist auf den Namen Dean DeWitt Huff ausgestellt. Er reist in Begleitung einer Frau namens Renata Huff, anscheinend seine Lebensgefährtin.«
»Wieso nicht Ehefrau?«
»Soviel ich weiß, ist er von seiner ersten Frau nicht geschieden, und sie hat ihn erst vor zwei Monaten für tot erklären lassen. Oh, Moment mal, kann ein Toter sich wiederverheiraten? Das hatte ich mir gar nicht überlegt. Vielleicht ist er ja gar kein richtiger Bigamist. Na jedenfalls waren die Pässe nach dem, was ich gesehen habe, in Los Angeles ausgestellt. Es kann gut sein, daß er inzwischen schon hier im Land ist. Gibt es eine Möglichkeit, den Leuten über die Paßbehörde da unten auf die Spur zu kommen?«
»Gute Idee«, meinte Lieutenant Whiteside. »Buchstabieren Sie mir doch mal den Nachnamen, bitte.«
»H-u-f-f.«
»Ich mache mir eine Aktennotiz«, sagte er. »Ich werde mal in Los Angeles anfragen und sehen, was die dort wissen. Wir können auch den Zoll am Flughafen von Los Angeles und San Diego informieren. Dann können die die Augen offenhalten, falls der Bursche auf diesem Weg hereinkommt. Ich kann auch noch San Francisco mobil machen, dann gehen wir ganz sicher.«
»Möchten Sie die Paßnummern haben?«
»Warum nicht, wenn ich auch den Verdacht habe, daß die Pässe gefälscht sind. Wenn er getürmt ist – und jetzt sieht es ja ganz danach aus –, hat Jaffe vielleicht ein halbes Dutzend Ausweise auf verschiedene Namen. Er war lang weg und hat sich vielleicht mehr als einen Satz Papiere beschafft, für den Fall, daß es mal eng werden sollte. So würde ich das jedenfalls an seiner Stelle machen.«
»Klingt vernünftig«, sagte ich. »Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, daß sich Jaffe, wenn er überhaupt mit jemandem Verbindung aufnimmt, an seinen früheren Geschäftspartner, Carl Eckert, wendet.«
»Tja, das ist sicher möglich, aber ich weiß nicht, wie er da aufgenommen werden würde. Die beiden waren mal gute Freunde, aber als Jaffe sich aus dem Staub machte, stand Eckert als der Sündenbock da.«
»Ich hörte, er war im Gefängnis.«
»Ja, das stimmt. Er wurde in einem halben Dutzend Fällen von Betrug und Unterschlagung verurteilt. Und dann strengten die Anleger eine Zivilklage wegen Betrugs, Vertragsbruchs und aller möglicher anderer Geschichten gegen ihn an. Hat ihnen nur leider nichts genützt. Er hatte zu der Zeit bereits Konkurs angemeldet, es gab also nicht viel zu holen.«
»Wie lange hat er gesessen?«
»Achtzehn Monate, aber so einen aalglatten Kerl wie den kann das natürlich nicht stoppen. Irgend jemand hat mir erzählt, er hätte ihn erst vor kurzem gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo es war, aber er ist auf jeden Fall noch am Ort.«
»Mal sehen, ob ich ihn nicht ein bißchen aufschrecken kann.«
»Allzu schwierig dürfte das nicht sein«, meinte er. »Aber vielleicht können Sie vorher mal bei uns vorbeikommen und sich mit unserem Zeichner zusammensetzen? Wir haben gerade einen jungen Kerl namens Rupert Valbusa angeheuert. Ein richtiges kleines Genie.«
»Klar, das läßt sich machen«, sagte ich, obwohl ich die Möglichkeit, daß Jaffes Konterfei plötzlich den Leuten von allen Wänden entgegenstarrte, sehr beunruhigend und lästig fand. »Die California Fidelity möchte allerdings vermeiden, daß er Lunte riecht und wieder türmt.«
»Das verstehe ich. Wir wollen das auch nicht, glauben Sie mir. Ich kenne eine Menge Leute, die großes Interesse daran haben, daß der Bursche geschnappt wird«, sagte Whiteside. »Haben Sie neuere Bilder von ihm?«
»Nur einige Schwarzweißfotos, die Mac Voorhies mir besorgt hat. Aber die sind schon sechs oder sieben Jahre alt. Und Sie? Es gibt nicht zufällig ein Bild aus der Kartei?«
»Nein, aber wir hatten eine Fotografie, die gleich nach Jaffes Verschwinden veröffentlicht wurde. Die können wir wahrscheinlich altersentsprechend korrigieren. Welcher Art sind denn die kosmetischen Korrekturen, die er hat machen lassen, können Sie uns das sagen?«
»Ich würde vermuten Kinn- und Wangenimplantationen, und vielleicht hat er auch seine Nase veredeln lassen. Auf den Bildern, die ich habe, sieht es aus, als sei seine Nase früher breiter gewesen. Außerdem ist sein Haar jetzt völlig weiß, und er ist etwas korpulenter. Abgesehen davon wirkte er recht fit. Ich würde mich jedenfalls nicht mit ihm anlegen wollen.«
»Passen Sie auf, ich gebe Ihnen Ruperts Nummer, dann können Sie beide Ihre eigenen Arrangements treffen. Er kommt nicht regelmäßig in die Dienststelle, sondern nur wenn wir ihn hier brauchen. Sobald er fertig ist, können wir das Bild mit der Weisung herausgeben, nach diesem Mann Ausschau zu halten. Ich kann mich mit dem Sheriff’s Department von Perdido County in Verbindung setzen, und inzwischen rufe ich auch gleich beim hiesigen FBI an. Die wollen vielleicht selbst ein Fahndungsblatt herausgeben.«
»Liegt immer noch ein Haftbefehl gegen ihn vor?«
»Richtig. Das habe ich nachgeprüft, bevor ich Sie angerufen habe. Kann sein, daß er auch vom FBI gesucht wird. Wir müssen einfach abwarten. Vielleicht haben wir Glück.« Er gab mir Rupert Valbusas Telefonnummer und fügte dann hinzu: »Je eher wir das Bild herausgeben können, desto besser.«
»Natürlich. Vielen Dank.«
Ich rief unter Valbusas Nummer an, erreichte aber nur den Anrufbeantworter. Ich hinterließ Namen und private Telefonnummer und eine kurze Erklärung. Ich bat um einen Termin am frühen Morgen, wenn er es einrichten könne, und um seinen Rückruf. Danach holte ich das Telefonbuch hervor und schlug unter dem Namen Eckert nach. Es gab insgesamt elf Eckerts, außerdem zwei Variationen: einen Eckhardt und einen Eckhart. Ich rief bei allen dreizehn Nummern an, aber nirgends war ein »Carl« aufzutreiben.
Daraufhin rief ich die Auskunft für Perdido/Olvidado an. Da gab es nur einen Eintrag unter dem Namen Eckert. Er gehörte einer gewissen Frances Eckert, die in einem Ton zurückhaltender Höflichkeit antwortete, als ich ihr erklärte, ich sei auf der Suche nach Carl.
»Hier gibt es niemanden dieses Namens«, sagte sie.
Ich horchte auf wie ein Hund, der bei einem Signal, das jenseits des menschlichen Hörvermögens liegt, die Ohren spitzt. Sie hatte nicht gesagt, sie kenne ihn nicht. »Sind Sie vielleicht zufällig mit Carl Eckert verwandt?«
Einen Moment blieb es still. »Ich war mit ihm verheiratet. Darf ich fragen, worum es sich handelt?«
»Aber sicher. Mein Name ist Kinsey Millhone. Ich bin Privatdetektivin und habe mein Büro hier oben in Santa Teresa. Ich versuche, einige von Wendell Jaffes alten Freunden ausfindig zu machen.«
»Wendell?« sagte sie erstaunt. »Ich dachte, der sei tot.«
»Tja, das scheint nun doch nicht so zu sein. Eben deshalb suche ich ja nach alten Freunden und Bekannten – weil ich mir denken könnte, daß er mit ihnen Kontakt aufnehmen wird. Lebt Carl noch hier in der Gegend?«
»Er wohnt in Santa Teresa. Auf einem Boot.«
»Ach was?« sagte ich. »Und Sie sind geschieden?«
»Worauf Sie sich verlassen können. Ich habe mich vor vier Jahren scheiden lassen, als Carl ins Gefängnis mußte. Ich hatte überhaupt keine Lust, die Ehefrau eines Knastbruders zu sein.«
»Das kann ich verstehen.«
»Ich hätte mich auch scheiden lassen, wenn kein Mensch mich verstanden hätte, das können Sie mir glauben. So wie dieser Kerl sich entpuppt hat. Sie können ihm das ruhig sagen, wenn Sie ihn aufstöbern sollten. Zwischen uns ist nichts mehr.«
»Haben Sie vielleicht eine Telefonnummer, unter der ich ihn tagsüber erreichen kann?«
»Natürlich. Ich gebe seine Nummer jedem, besonders seinen Gläubigern. Das macht mir das größte Vergnügen. Sie können ihn aber nur während des Tages erreichen«, warnte sie mich. »Auf dem Boot hat er kein Telefon. Da ist er jeden Tag spätestens um sechs. Meistens ißt er im Jachtclub zu Abend und hängt dann dort bis Mitternacht herum.«
»Wie sieht er aus?«
»Oh, er ist allgemein bekannt. Jeder kann ihn Ihnen zeigen. Fahren Sie einfach hin und fragen Sie nach ihm. Sie können ihn gar nicht verfehlen.«
»Und können Sie mir auch noch den Namen des Boots und die Liegeplatznummer geben, für den Fall, daß er nicht im Club ist?«
Sie nannte mir die Nummer. »Das Boot heißt Captain Stanley Lord. Es hat Wendell gehört«, fügte sie hinzu.
»Ach wirklich? Und wie ist Carl zu dem Boot gekommen?«
»Das sollten Sie sich von ihm selbst erzählen lassen«, erwiderte sie und legte auf.
Ich erledigte noch dies und das und beschloß dann, es für diesen Tag gut sein zu lassen. Ich hatte mich schon beim Aufstehen ziemlich mies gefühlt, und das Antihistamin, das ich am Morgen genommen hatte, gab mir jetzt vollends den Rest. Da nicht viel los war, meinte ich, guten Gewissens nach Hause fahren zu können. Ich marschierte das Stück bis zu meinem Wagen, fuhr zur State Street und bog dort links ab.
Meine Wohnung liegt versteckt in einer schattigen kleinen Seitenstraße, nur einen Straßenzug vom Strand entfernt. Ich fand einen Parkplatz ganz in der Nähe, schloß den VW ab und ging durch die Gartenpforte aufs Grundstück. Ich wohne in einer ehemaligen Garage, die man in eine kleine Maisonettewohnung umgewandelt hat. Unten habe ich eine Kochnische, ein Wohnzimmer, das gelegentlich auch als Gästezimmer dient, und ein Bad, und im oberen Stockwerk, das über eine Wendeltreppe zu erreichen ist, sind das Schlafzimmer und noch ein kleines Bad. Die Wohnung ist unglaublich praktisch. Mein Hauswirt hatte die Garage nach einer Explosion vor zwei Jahren zu Weihnachten umbauen lassen und dem Dekor einen nautischen Akzent verliehen. In den Zimmern gab es viel Messing und Teakholz, die Fenster hatten die Form von Bullaugen, die Küche erinnerte an eine Kombüse, überall gab es Einbauschränke. Die Wohnung hat etwas von einem Spielzeughaus für Erwachsene; mir ist das nur recht, ich bin im Herzen ein Kind geblieben.
Als ich auf dem Weg zum rückwärtigen Garten um die Ecke bog, sah ich, daß Henrys Hintertür offenstand. Ich überquerte die Terrasse, die meine kleine Wohnung mit dem Haupthaus des Anwesens verband, klopfte an das Fliegengitter und spähte in die Küche, die leer zu sein schien.
»Henry? Bist du da?«
Er war anscheinend in Kochstimmung. Ich roch die geschmorten Zwiebeln und den angebratenen Knoblauch, die Henry als Basis für jedes Gericht nimmt, das er zubereitet. Es war ein gutes Zeichen, daß er wieder Freude am Kochen hatte. In den Monaten seit dem Einzug seines Bruders William hatte er ganz zu kochen aufgehört, zum Teil weil William so entsetzlich heikel war. So bescheiden und zaghaft, wie man es sich nur vorstellen kann, pflegte William zu erklären, daß dieses Gericht für seinen Hochdruck leider ein klein wenig zu stark gesalzen sei, daß jenes eine Spur zu fett sei für seine Galle. Und wegen seines empfindlichen Darms und seines Reizmagens vertrug er leider auch nichts, was zuviel Säure enthielt oder zu stark gewürzt war. Hinzu kamen noch seine Allergien, seine Laktose-Unverträglichkeit und sein Herz, sein Leistenbruch, seine gelegentliche Inkontinenz und seine Neigung zur Bildung von Nierensteinen. Schließlich hatte Henry für sich nur noch belegte Brote gemacht und William sich selbst überlassen.
William begann daraufhin, seine Mahlzeiten in der Kneipe an der Ecke einzunehmen, die seit Jahren seiner geliebten Rosie gehörte. Rosie ging zwar scheinbar auf Williams diverse Leiden ein, bestand aber darauf, daß er aß, was sie ihm vorsetzte. Sie ist überzeugt, daß man mit einem Glas Sherry jedem Leiden beikommen kann. Nur Gott allein weiß, was ihre gepfefferte ungarische Küche Williams empfindlichem Darm und Reizmagen angetan hat.
»Henry?«
»Jaha«, rief Henry aus dem Schlafzimmer. Gleich darauf hörte ich Schritte, dann kam er um die Ecke und strahlte, als er mich sah. »Kinsey! Du bist wieder da! Komm rein. Ich bin sofort da.«
Er verschwand. Ich trat in die Küche. Er hatte seinen großen Suppentopf vom Schrank heruntergeholt. Auf dem Küchentisch lag ein Bund Sellerie, daneben standen zwei große Dosen Tomaten, eine Packung gefrorener Mais und eine zweite Packung mit Erbsen.
»Ich mache gerade Gemüsesuppe«, rief er. »Komm doch zum Abendessen.«
Ich sprach laut, so daß er mich drüben im anderen Zimmer hören konnte. »Vielen Dank, die Einladung nehme ich gern an. Aber ich warne dich, du riskierst vielleicht eine Erkältung. Ich habe ein echtes Prachtstück aus Mexiko mitgebracht. Was treibst du eigentlich da hinten?«
Mit einem Stapel frischer Handtücher im Arm kam Henry wieder in die Küche. »Ich hab’ nur schnell die Wäsche zusammengelegt«, erklärte er, während er die Handtücher in einer Schublade verstaute und eines zum Gebrauch draußen ließ. Er hielt einen Moment inne und sah mich aus zusammengekniffenen Augen an. »Was hast du da am Ellbogen?«
Ich hob den Arm und schaute mir meinen Ellbogen an. Die Selbstbräunungscreme hatte wahre Wunder gewirkt. Mein Ellbogen sah aus, als hätte man ihn in Vorbereitung auf eine Operation mit Jod eingerieben. »Das ist meine Sonnenbräune aus der Dose. Du weißt doch, wie ich es hasse, mich in die Sonne zu legen. In ein paar Tagen wäscht sich das wieder raus. Das hoffe ich jedenfalls. Und was gibt’s hier Neues? Du bist ja so gutgelaunt, wie ich dich seit Monaten nicht mehr erlebt habe.«
»Setz dich, setz dich. Möchtest du eine Tasse Tee?«
Ich setzte mich in seinen Schaukelstuhl. »Danke, nicht nötig«, antwortete ich. »Ich bleibe nur einen Moment. Ich habe heute morgen was gegen den Schnupfen genommen und kann mich kaum noch auf den Beinen halten. Ich glaube, ich krieche für den Rest des Tages ins Bett.«
Henry nahm einen Dosenöffner zur Hand und kurbelte die beiden Dosen mit den Tomaten auf, die er in den Suppentopf schüttete. »Du errätst nie, was hier passiert ist. William ist mit Rosie zusammengezogen.«
»Echt? Für immer?«
»Ich hoffe es. Ich habe endlich begriffen, daß es mich einen Dreck angeht, was er mit seinem Leben anstellt. Erst habe ich mir eingebildet, ich müßte ihn retten. Die ganze Geschichte war doch so absurd. Die beiden passen nicht zusammen – na und? Das wird er irgendwann schon selber merken. Ich lasse mich jedenfalls nicht mehr von ihm verrückt machen. Dieses ewige Gewäsch von Krankheit und Tod, Depressionen und Herzrhythmusstörungen. Mein Gott! Soll er das doch mit ihr ›teilen‹. Sollen sie sich doch gegenseitig zu Tode langweilen.«
»Bravo! Wann ist er ausgezogen?«
»Am Wochenende. Ich hab’ ihm beim Packen geholfen und sogar ein paar von seinen Kartons rübergebracht. Seitdem lebe ich hier wie im Paradies.« Er lächelte breit, griff sich den Sellerie, riß die Stangen auseinander, wusch sie und begann sie zu würfeln. »Geh, leg dich in dein Bett. Du siehst ganz fertig aus. Um sechs kommst du wieder rüber und ißt einen Teller Suppe.«
»Sei mir nicht böse, falls ich nicht erscheine«, sagte ich. »Wenn ich Glück habe, schlafe ich vielleicht durch.«
Ich ging in meine Wohnung und schleppte mich in die Mansarde hinauf, zog meine Schuhe aus und kroch unter die Steppdecke.
Eine halbe Stunde später läutete das Telefon. Ich quälte mich aus Schlafestiefen empor. Es war Rupert Valbusa. Er hatte mit Lieutenant Whiteside gesprochen, der ihm mit Nachdruck klargemacht hatte, wie wichtig es sei, die Zeichnung möglichst bald fertigzustellen. Er sei die nächsten fünf Tage auf Reisen, sagte er, aber wenn ich frei sei, erwarte er mich innerhalb der nächsten Stunde in seinem Atelier. Ich stöhnte innerlich, aber im Grunde hatte ich gar keine Wahl. Ich schrieb mir die Adresse auf. Das Atelier war nicht weit von meiner Wohnung in einem Industriegebiet nahe beim Strand. Ein ehemaliges Lagerhaus in der Anaconda Street war in ein Atelierhaus für Künstler umgewandelt worden. Ich schlüpfte in meine Schuhe und tat mein Möglichstes, um mich einigermaßen präsentabel zu machen. Dann nahm ich die Autoschlüssel, eine Jacke und die Fotos von Jaffe.
Die Luft draußen war feucht, vom Meer her wehte ein kühles Lüftchen. Als ich den Cabana Boulevard hinunterfuhr, sah ich am Himmel, dort, wo die Wolkendecke aufriß, ein paar blaue Stellen. Am späten Nachmittag würden wir vielleicht sogar noch eine Stunde Sonnenschein bekommen. Ich parkte in einer schmalen, von Bäumen gesäumten Straße, sperrte den Wagen ab und ging um das Lagerhaus herum zur Nordseite. Die Tür, durch die ich eintrat, war von zwei imposanten Metallskulpturen flankiert. Innen waren die Korridore weiß getüncht und mit Arbeiten der derzeit im Haus arbeitenden Künstler geschmückt. Die Decke im Vorsaal erhob sich über drei Stockwerke zum Dach mit einer Reihe schräger Fenster, durch die in breiten Balken das Tageslicht einfiel.
Valbusa hatte sein Atelier im obersten Stockwerk. Ich stieg die Eisentreppe am hinteren Ende des Vorsaals hinauf. Das Klirren meiner Schritte brach sich dumpf an den Betonwänden. Als ich oben ankam, hörte ich gedämpfte Country-Musik. Ich klopfte an Valbusas Tür, und das Radio wurde abgestellt.
Rupert Valbusa war Hispano, stämmig und muskulös. Ich schätzte ihn auf Mitte Dreißig. Er hatte breite Schultern und einen kräftigen, gewölbten Brustkasten. Die Augen unter den buschigen Brauen waren sehr dunkel. Dichtes dunkles Haar umrahmte sein Gesicht. Wir machten uns an der Tür miteinander bekannt und gaben einander die Hand, ehe ich ihm in das Atelier folgte. Als er sich von mir abwandte, um mir vorauszugehen, sah ich, daß er einen dünnen Zopf hatte, der ihm bis unter die Schulterblätter reichte. Er trug ein weißes T-Shirt, abgeschnittene Jeans und Sandalen mit dicken Gummisohlen. Er hatte gutgeformte Beine, deren Konturen von dunklen seidigen Härchen begrenzt wurden.
Das Atelier war sehr groß und sehr kühl, mit einem Betonfußboden und breiten Arbeitstischen an den Wänden. Es roch nach feuchtem Ton, und auf allen Oberflächen lag kreidiger Porzellanstaub. Große Blöcke weichen Tons waren in Plastikhäute gehüllt. Er hatte zwei Töpferscheiben, eine, die mit dem Fuß zu betätigen war, und eine elektrische, und zwei Brennöfen. Auf zahllosen Borden standen Keramikschalen, die gebrannt waren, aber noch nicht glasiert. Am Ende eines der Arbeitstische standen ein Kopiergerät, ein Anrufbeantworter und ein Projektor für Dias. Daneben lagen Stapel eselsohriger Skizzenblöcke, drängten sich Gläser mit Stiften und Federn und Pinseln aller Art. Im Raum standen drei Staffeleien mit abstrakten Ölgemälden in unterschiedlichen Stadien der Vollendung.
»Gibt es etwas, was sie nicht tun?«
»Das sind nicht alles meine Sachen. Ein Teil ist von meinen Schülern. Ich habe nämlich zwei Schüler angenommen, obwohl mir das Unterrichten eigentlich keinen großen Spaß macht. Malen Sie auch?«
»Nein, leider nicht, aber ich beneide alle, die es können.«
Er trat zum nächsten Arbeitstisch und nahm einen braunen Umschlag, der eine Fotografie enthielt. »Lieutenant Whiteside hat das herschicken lassen. Da ist anscheinend auch die Adresse der Ehefrau des Burschen beigelegt.« Er reichte mir einen Zettel, den ich sogleich einsteckte.
»Danke. Wunderbar. Das spart mir Zeit.«
»Und das ist der Bursche, der Sie interessiert?« Valbusa zeigte mir die Fotografie. Ich betrachtete die körnige Porträtaufnahme einen Moment. »Ja, das ist er. Er heißt Wendell Jaffe. Ich habe hier noch ein paar Aufnahmen, auf denen Sie ihn aus anderer Perspektive sehen können.«
Ich gab ihm die Sammlung von Fotografien, die ich von Mac bekommen hatte, und beobachtete ihn, während er sie aufmerksam durchsah und dann nach einem System, das nur er kannte, ordnete. »Ein gutaussehender Mann. Was hat er getan?«
»Er und sein Partner haben Geschäfte mit unerschlossenen Grundstücken gemacht, von denen einige ganz legitim waren, bis sie sich völlig übernahmen. Am Ende mußten sie die Riesengewinne, die sie ihren Anlegern versprochen hatten, mit den Geldern bezahlen, die sie neuen Anlegern abknöpften. Jaffe merkte dann wohl, daß das nicht mehr lange so weitergehen konnte. Er verschwand eines Tages bei einem Segeltörn von seinem Boot und ward nie wieder gesehen. Bis vor einigen Tagen. Sein Partner mußte ins Gefängnis, ist aber inzwischen wieder auf freiem Fuß.«
»Ach ja, die Geschichte kenne ich. Ich glaube, der Dispatch hat vor ein paar Jahren mal einen Bericht gebracht.«
»Gut möglich. Es ist eines dieser ungelösten Rätsel, die die Phantasie der Leute anregen. Ein angeblicher Selbstmord, aber ohne Leiche – das gibt zu einer Menge Spekulationen Anlaß.«
Valbusa studierte die Bilder genau, die Konturen von Jaffes Gesicht, den Haaransatz, den Abstand zwischen den Augen. Er hielt sich das Foto dicht vors Gesicht und neigte es schräg zum Fenster, durch das das Licht einfiel. »Wie groß ist er?«
»Ungefähr einsneunzig. Und wiegt vielleicht hundert Kilo. Er ist Ende Fünfzig, aber gut in Form. Ich habe ihn in der Badehose gesehen.« Ich zog die Augenbrauen hoch. »Nicht übel.«
Valbusa ging zum Kopiergerät und machte zwei Kopien des Fotos auf grobem beigefarbenen Papier. Er rückte einen Hocker ans Fenster. »Setzen Sie sich doch«, sagte er und wies mit dem Kopf auf eine Gruppe hölzerner Hocker.
Ich trug einen zum Fenster und ließ mich neben ihm nieder. Schweigend sah ich zu, wie er Zeichenfedern aussuchte und schließlich vier aus dem Glas nahm. Er öffnete eine Schublade und holte einen Kasten Buntstifte und einen Kasten Pastellkreiden heraus. Er wirkte geistesabwesend, und die Fragen, die er mir nun zu stellen begann, schienen beinahe Teil eines Rituals zu sein, das zur Vorbereitung auf die anstehende Aufgabe gehörte. Er befestigte die Kopie des Fotos auf einer Agenda.
»Fangen wir oben an. Wie ist sein Haar?«
»Weiß. Früher war es mittelbraun. In Wirklichkeit ist es an den Schläfen dünner als auf dem Foto.«
Valbusa nahm den weißen Stift und färbte das dunkle Haar hell. Augenblicklich sah Jaffe zwanzig Jahre älter aus und tief gebräunt.
Ich mußte lächeln. »Nicht schlecht«, sagte ich. »Ich glaube, er hat sich die Nase schmaler machen lassen. Da, am Nasenrücken und vielleicht auch hier an den Seiten.« Die Stellen, die ich mit meinem Finger berührte, tönte Valbusa mit feinen Kreide- oder Bleistiftstrichen. Die Nase auf dem Papier wurde schmal und aristokratisch.
Valbusa begann zu plaudern. »Es verblüfft mich immer wieder, wie viele Variationen sich aus den Grundelementen eines menschlichen Gesichts herausholen lassen. Wenn man bedenkt, daß die meisten von uns mit der Standardausführung zur Welt kommen – eine Nase, ein Mund, zwei Augen und zwei Ohren. Nicht nur sieht jeder von uns anders aus, wir können die Gesichter auch im allgemeinen auf den ersten Blick voneinander unterscheiden. Wenn man viel porträtiert wie ich, fängt man langsam an, die Feinheiten des Prozesses richtig zu würdigen.« Mit sicherem Strich verlieh Valbusa dem Mann auf dem Bild zusätzliche Jahre und Statur. Er hielt inne und deutete auf ein Auge. »Wie steht’s mit der Falte hier? Hat er seine Augen auch korrigieren lassen?«
»Nein, ich glaube nicht.«
»Hängen die Lider? Hat er schwere Tränensäcke? In fünf Jahren bekommt man schon ein paar Fältchen.«
»Vielleicht. Aber nicht viele. Seine Wangen wirkten eingefallener. Er sah beinahe hager aus«, sagte ich.
Er arbeitete einen Moment schweigend. »So?«
Ich studierte die Zeichnung. »Das ist sehr ähnlich.«
Als er schließlich fertig war, hatte ich ein ziemlich getreues Abbild des Mannes vor mir, den ich in Mexiko gesehen hatte. »Ich glaube, das ist es. Er sieht gut aus.« Ich sah zu, wie er das Papier mit einem Fixierer besprühte.
»Ich mache gleich ein Dutzend Kopien und schicke sie Lieutenant Whiteside rüber«, sagte er. »Möchten Sie auch welche für sich? Sie können gern auch ein Dutzend haben.«
»Das wäre prima.«