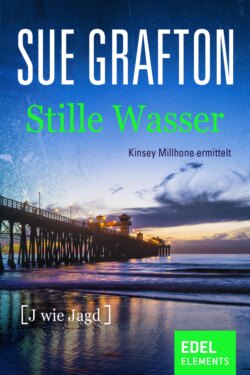Читать книгу Stille Wasser - Sue Grafton - Страница 6
2
ОглавлениеBis zum Start der Mexicana-Maschine nach Cabo San Lucas hatte ich drei Stunden Aufenthalt in Los Angeles. Mac hatte mir eine Mappe mit Zeitungsartikeln über Jaffes Verschwinden und seine Nachwehen mitgegeben. Ich machte es mir in einer der Flughafenbars bequem und sah die Ausschnitte durch. Dazu schlürfte ich eine Margarita. Zum Einstimmen. Zu meinen Füßen stand die in aller Eile gepackte Reisetasche, in der neben anderen Dingen meine 35-Millimeter-Kamera, mein Feldstecher und der Videorecorder, den ich mir selbst zum vierunddreißigsten Geburtstag geschenkt hatte, verstaut waren. Mir gefiel das Spontane dieser Reise, und ich verspürte schon jetzt dieses Gefühl geschärfter Selbstwahrnehmung, das mit dem Reisen kommt. Meine Freundin Vera und ich besuchten zur Zeit einen Spanischkurs für Anfänger bei der Volkshochschule in Santa Teresa. Allerdings waren wir in unserem sprachlichen Ausdruck fürs erste noch auf das Präsens und kurze Aussagen von zweifelhaftem Nutzen beschränkt – es sei denn, da hockten irgendwo ein paar schwarze Katzen in den Bäumen; dann konnten Vera und ich mit dem Finger auf sie zeigen und sagen: Muchos gatos negros están en los árboles, si? Si, muchos gatos. Mindestens bot mir diese Reise Gelegenheit, meine Sprachkenntnisse zu erproben und zu vertiefen.
Zu den Zeitungsausschnitten hatte Mac mehrere Schwarzweißfotos gelegt, die Jaffe bei verschiedenen öffentlichen Anlässen zeigten – Ausstellungseröffnungen, politischen Veranstaltungen, Wohltätigkeitsfesten. Er hatte offensichtlich zur Elite gehört: gutaussehend, elegant gekleidet, stets im Mittelpunkt. Häufig jedoch war sein Gesicht das eine, das unscharf war, so als wäre er genau in dem Moment, als der Fotograf auf den Auslöser drückte, einen Schritt zurückgewichen oder hätte sich abgewandt. Ich überlegte, ob er vielleicht damals schon ganz bewußt vermieden hatte, fotografiert zu werden. Er war Mitte Fünfzig, ein kräftiger Mann mit grauem Haar über einem Gesicht mit hohen Wangenknochen, vorspringendem Kinn und großer Nase. Er wirkte ruhig und selbstbewußt, ein Mann, dem es ziemlich gleichgültig war, was andere von ihm dachten.
Einen Moment lang fühlte ich mich ihm irgendwie verbunden, als ich mir vorstellte, wie es wäre, einfach die Identität zu wechseln. Für mich, die geborene Lügnerin, hatte die Vorstellung immer schon etwas Verlockendes gehabt. Der Gedanke, einfach aus dem eigenen Leben auszusteigen und sich in ein neues, ganz anderes hineinzubegeben wie ein Schauspieler, der die Rolle wechselt, entbehrte nicht einer gewissen Romantik. Vor nicht allzulanger Zeit hatte ich mit einem entsprechenden Fall zu tun gehabt: Ein Mann, der wegen Mordes verurteilt war, war bei einem Arbeitseinsatz geflohen und hatte es geschafft, sich eine ganz neue Persönlichkeit zu kreieren. Er hatte nicht nur seine ganze Vergangenheit abgelegt, sondern sich auch des Makels seiner Verurteilung wegen Mordes entledigt. Er hatte sich eine neue Familie und eine gute Stellung zugelegt und war in seiner neuen Gemeinde ein geachteter Mann. Es wäre ihm vielleicht gelungen, die Täuschung bis ans Ende seines Lebens aufrechtzuerhalten, hätte sich nicht siebzehn Jahre später bei der Ausstellung eines richterlichen Haftbefehls ein Irrtum eingeschlichen, der, Laune des Schicksals, zu seiner Verhaftung führte. Wir können eben unserer Vergangenheit nicht entkommen.
Ein Blick auf meine Uhr sagte mir, daß es Zeit war zu gehen. Ich packte die Zeitungsausschnitte wieder ein und nahm meine Reisetasche. Ich ging durch die Halle, passierte die Sicherheitskontrolle und trat den langen Marsch zu meinem Flugsteig an. Es gehört zu den unabänderlichen Gesetzen des Reisens mit dem Flugzeug, daß sich der Flugsteig, an dem man ankommt oder abfliegt, stets am äußersten Ende des Terminals befindet, besonders wenn man schweres Gepäck schleppen muß oder zu enge Schuhe anhat. Ich setzte mich in den Warteraum und rieb meinen schmerzenden Fuß, während langsam meine Mitreisenden eintrudelten.
Sobald ich in der Maschine auf meinem Platz saß, nahm ich den Hochglanzprospekt des Hotels zur Hand, den Mac zu den Tickets gelegt hatte. Er hatte mir nicht nur den Flug gebucht, sondern auch gleich in dem Ferienhotel, in dem Wendell Jaffe gesichtet worden war, ein Zimmer bestellt. Ich war zwar nicht überzeugt davon, daß der Mann dort noch anzutreffen sein würde, aber weshalb hätte ich einen kostenlosen Urlaub ausschlagen sollen?
Das Bild der Hacienda Grande de Viento Negro zeigte ein zweistöckiges Gebäude mit einem Streifen dunklen Strandes im Vordergrund. Im Untertitel wurden ein Restaurant, zwei Bars und ein beheizter Pool angepriesen sowie Freizeitangebote von der Stadtrundfahrt mit freien Drinks bis zum Tennis, Schnorcheln und Tiefseetauchen.
Meine Nachbarin las mit. Beinahe hätte ich den Prospekt mit der Hand abgeschirmt wie in der Schule, wenn jemand abzuschreiben versuchte. Die Frau war in den Vierzigern, sehr dünn, sehr braungebrannt, sehr schick im schwarzen Hosenanzug mit beigefarbenem Top darunter.
»Sie wollen nach Viento Negro?« fragte sie.
»Ja. Kennen Sie die Gegend?«
»O ja. Und ich kann nur hoffen, Sie haben nicht die Absicht, da zu wohnen.« Sie deutete auf den Prospekt und verzog geringschätzig den Mund dabei.
»Wieso nicht? Ich finde, das Hotel sieht sehr ordentlich aus.«
Sie zog leicht die Brauen hoch. »Na ja, es ist Ihr Geld.«
»Nein, ist es nicht. Ich bin geschäftlich unterwegs«, entgegnete ich.
Sie nickte nur, offensichtlich nicht überzeugt. Sie tat so, als vertiefte sie sich in ihre Zeitschrift, gab mir aber durch ihre Miene klar zu verstehen, daß sie sich nur mit Mühe zurückhielt. Einen Augenblick später sah ich, wie sie ihrem Nachbarn zur Rechten etwas zumurmelte. Dem Mann hing ein Bausch Kleenex aus einem Nasenloch; vermutlich um das Nasenbluten zu stillen, das durch den steigenden Druck in der Kabine des Flugzeugs hervorgerufen worden war. Der Zellstoffstreifen sah aus wie eine dicke selbstgedrehte Zigarette. Der Mann beugte sich ein wenig vor, um mich besser sehen zu können.
Ich richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf die Frau. »Mal ehrlich. Ist da etwas nicht in Ordnung?«
»Ach, es ist sicher okay«, antwortete sie gedämpft.
»Kommt nur drauf an, was man von Staub, Feuchtigkeit und Ungeziefer hält«, warf der Mann ein.
Ich lachte – hahaha –, da ich annahm, er scherze. Keiner von beiden verzog eine Miene.
Verspätet lernte ich, daß viento negro »schwarzer Wind« heißt, eine passende Beschreibung für die Wolken dunklen Lavastaubs, die jeden Tag gegen Ende des Nachmittags vom Strand heraufgewirbelt wurden. Das Hotel war bescheiden, ein Bau in Form eines auf dem Kopf stehenden Us, aprikosenfarben gestrichen, mit kleinen Balkonen. Aus Blumenkästen fiel Bougainvillea in kardinalroten Kaskaden herab. Das Zimmer war sauber, aber ziemlich schäbig, mit Blick auf den Golf von Kalifornien im Osten.
Zwei Tage strich ich auf der Suche nach einem Opfer, das auch nur annähernde Ähnlichkeit mit den fünf Jahre alten Fotografien von Wendell Jaffe hatte, im Hacienda Grande und im Ort, Viento Negro, umher. Wenn alles schiefgeht, sagte ich mir, kannst du immer noch versuchen, in deinem verbesserungsbedürftigen Spanisch das Personal auszuquetschen; wobei ich allerdings Angst hatte, einer der Leute würde Jaffe dann vielleicht einen Tip geben. Vorausgesetzt natürlich, er war überhaupt hier. Ich setzte mich an den Pool, hing im Hotelfoyer herum, nahm den Zubringerbus in den Ort. Ich führte mir sämtliche Touristenattraktionen zu Gemüte: die Sonnenuntergangskreuzfahrt, einen Schnorchelausflug, eine Höllenfahrt über staubige Gebirgsstraßen in einem gemieteten Geländewagen. Ich versuchte mein Glück in den beiden anderen Hotels in der Gegend, in den Restaurants und Kneipen der Umgebung. Ich testete den Nachtclub in meinem Hotel, klapperte sämtliche Discos und Geschäfte ab. Nirgends fand ich eine Spur von ihm.
Schließlich rief ich Mac an, um ihm von meinen bis dato vergeblichen Bemühungen zu berichten. »Das wird hier allmählich ganz schön teuer. Vielleicht ist er ja längst weg – wenn dein Kollege ihn überhaupt gesehen hat.«
»Dick schwört Stein und Bein, daß er’s war.«
»Nach fünf Jahren?«
»Hör mal, bleib einfach noch zwei, drei Tage dran. Wenn er bis Ende der Woche nicht aufgetaucht ist, kannst du dich in die nächste Maschine Richtung Heimat setzen.«
»Mir soll’s recht sein. Ich wollte dich nur vorwarnen, falls ich mit leeren Händen kommen sollte.«
»Das verstehe ich. Versuch’s weiter.«
»Du bist der Boß«, sagte ich.
Ich fand Gefallen an dem Städtchen, das man vom Hotel aus mit dem Taxi auf einer staubigen zweispurigen Straße in zehn Minuten erreichte. Die meisten Bauten, an denen ich vorüberkam, waren unfertig, roher Löschbeton, den man dem wuchernden Unkraut überlassen hatte. Der einst herrliche Blick auf den Hafen war jetzt durch Hochhäuser verstellt, und in den Straßen wimmelte es von Kindern, die Chichlets verkauft, das Stück für hundert Pesos. Hunde dösten auf den Bürgersteigen in der Sonne. Die Fassaden der Geschäfte an der Hauptstraße leuchteten in kräftigen Blau- und Gelbtönen, in knalligem Rot und Papageiengrün, bunt wie Urwaldblumen. Plakatwände kündeten von weitreichenden kommerziellen Interessen von Fujifilm bis Immobilien 2000. Die meisten geparkten Autos standen mit zwei Rädern auf dem Bürgersteig, und den Kennzeichen war zu entnehmen, daß Touristen bis aus Oklahoma hierherkamen. Die Geschäftsleute waren höflich und zeigten sich meinem stockenden Spanisch gegenüber geduldig. Es gab keine Anzeichen von Kriminalität oder Rowdytum. Alle waren viel zu abhängig von den amerikanischen Touristen, um es zu riskieren, sie vor den Kopf zu stoßen. Dennoch waren die auf dem Markt angebotenen Waren minderwertig und überteuert, und das Essen in den Restaurants war ausgesprochen zweitklassig. Unermüdlich wanderte ich von einem Ort zum anderen und suchte in den Menschenmengen nach Wendell Jaffe oder seinem Ebenbild.
Am Mittwochnachmittag – ich war inzwischen zweieinhalb Tage hier – gab ich die Suche schließlich auf und legte mich eingecremt, daß ich wie eine frisch gebackene Kokosmakrone roch, an den Pool. Kühn zeigte ich in einem ausgebleichten schwarzen Bikini meinen Körper, der gesprenkelt war von alten Schußwunden und gestreift von den bleichen Narben diverser anderer Verletzungen, die man mir im Lauf der Jahre beigebracht hatte. Ja, mein körperliches Befinden scheint viele Leute zu kümmern. Im Moment hatte meine Haut einen schwachen Orangeton, da ich, um die winterliche Blässe zu kaschieren, eine Grundierung in Form von Selbstbräunungscreme aufgetragen hatte. Natürlich hatte ich das Zeug unregelmäßig aufgetragen, und an den Fußknöcheln war ich scheußlich fleckig. Es sah aus, als hätte ich eine besondere Form der Gelbsucht. Ich kippte mir den Strohhut ins Gesicht und versuchte, die Schweißbäche zu ignorieren, die sich in meinen Kniekehlen sammelten. Sonnenbaden ist so ziemlich der langweiligste Zeitvertreib auf Erden. Aber positiv war immerhin, daß ich hier von Telefon und Fernsehen abgeschnitten war. Ich hatte keinen Schimmer, was in der Welt passierte.
Ich mußte wohl eingenickt sein; plötzlich jedenfalls hörte ich das Rascheln einer Zeitung, dann die Stimmen zweier Leute in den Liegestühlen rechts von mir. Sie unterhielten sich auf Spanisch, und in meinen Ohren klang das ungefähr so: Bla-bla-bla... aber ... bla-bla-bla-bla ... weil ... bla-bla-bla ... hier. Eine Frau mit eindeutig amerikanischem Akzent sagte etwas von Perdido, Kalifornien, dem kleinen Ort dreißig Meilen südlich von Santa Teresa. Ich horchte auf. Ich war gerade dabei, meinen Hut etwas hochzuschieben, um mir die Frau ansehen zu können, als ihr Begleiter ihr auf Spanisch erwiderte. Ich rückte meinen Hut zurecht und drehte ganz langsam den Kopf, bis ich ihn im Blickfeld hatte. Verdammt, das mußte Jaffe sein. Wenn man das Alter und mögliche kosmetische Korrekturen berücksichtigte, war dieser Mann zumindest ein heißer Kandidat. Ich kann nicht behaupten, daß er dem Wendell Jaffe auf den Fotos glich wie ein Ei dem anderen, aber er hatte eine gewisse Ähnlichkeit: das Alter, die Figur, seine Haltung, die Art, wie er seinen Kopf neigte, für ihn typische Merkmale, derer er sich wahrscheinlich gar nicht bewußt war.
Er war in eine Zeitung vertieft. Flink huschten seine Augen von einer Spalte zur nächsten. Dann schien er meine Aufmerksamkeit zu spüren und sandte einen vorsichtigen Blick in meine Richtung. Wir sahen uns flüchtig an, während die Frau an seiner Seite weiterbabbelte. Wechselnde Emotionen spiegelten sich in seinem Gesicht, und er berührte mit einem warnenden Blick zu mir den Arm der Frau. Vorübergehend versiegte der Wortschwall. Mir gefiel die Paranoia. Sie sagte einiges über seine geistige Verfassung aus.
Ich griff mir meine Strohtasche und kramte in ihren Tiefen, bis er das Interesse an mir verlor. Und ich Idiotin hatte meinen Fotoapparat nicht mit! Ich hätte mich ohrfeigen können. Ich holte mein Buch heraus und schlug es irgendwo in der Mitte auf, dann scheuchte ich einen imaginären Käfer von meinem Bein und sah mich um, wobei ich – wie ich hoffte – einen Eindruck absoluten Desinteresses vermittelte. In leiserem Ton nahmen die beiden ihr Gespräch wieder auf. Inzwischen verglich ich die Gesichtszüge des Mannes im Geist mit denen des Typen, dessen Foto ich in meiner Mappe hatte. Die Augen verrieten ihn: dunkel und tiefliegend unter sehr hellen silberweißen Augenbrauen. Dann sah ich mir die Frau an seiner Seite an; ich war ziemlich sicher, daß ich sie nie zuvor gesehen hatte. Sie war in den Vierzigern, sehr klein und dunkel und tief gebräunt. Der BH aus Hanfgarn verhüllte Brüste wie Briefbeschwerer, und die eingezogene Krümmung unter der Bikinihose zeigte, daß sie geprügelt worden war, wo es weh tat.
Den Hut über dem Gesicht, ließ ich mich tiefer in meinen Liegestuhl sinken und lauschte unverfroren dem sich steigernden Streitgespräch. Immer noch sprachen die beiden Spanisch miteinander, und das Wesen des Dialogs schien mir von schlichter Meinungsverschiedenheit in hitzige Auseinandersetzung überzugehen. Sie brach das Gespräch plötzlich ab, indem sie sich in dieses gekränkte Schweigen hüllte, dem Männer immer ratlos gegenüberstehen. Fast den ganzen Nachmittag lagen sie nebeneinander auf ihren Liegestühlen, sprachen kaum ein Wort und beschränkten sich in ihren Interaktionen auf ein Minimum. Liebend gern hätte ich ein paar Fotos geschossen. Zweimal dachte ich daran, in mein Zimmer hinaufzulaufen, aber ich meinte, es könnte merkwürdig aussehen, wenn ich wenige Minuten später mit voller Fotoausrüstung zurückkehren würde. Ich hielt es für besser, mich in Geduld zu fassen und auf den geeigneten Moment zu warten. Die beiden waren eindeutig Hotelgäste, und ich konnte mir nicht vorstellen, daß sie so spät am Tag noch abreisen wollten. Morgen konnte ich ein paar Bilder machen. Heute sollten sie sich erst einmal an meinen Anblick gewöhnen.
Um fünf begann der Wind in den Palmen zu rascheln, und vom Strand stiegen Spiralen schwarzen Staubs in die Höhe. Sandkörner knallten auf meine Haut, legten sich auf meine Zunge, und meine Augen fingen an zu tränen. Die wenigen Hotelgäste in meiner Nähe packten eilig ihre Sachen zusammen. Ich wußte inzwischen aus Erfahrung, daß die Staubböen sich bei Sonnenuntergang legten. Jetzt jedoch schloß sogar der Mann im Kiosk seine Bude und suchte schleunigst Deckung.
Der Mann, den ich beobachtet hatte, stand auf. Seine Begleiterin wedelte sich mit der Hand vor dem Gesicht herum, als wollte sie einen Mückenschwarm vertreiben. Mit gesenktem Kopf, um den Staub nicht in die Augen zu bekommen, sammelte sie ihre und seine Sachen ein. Sie sagte etwas auf Spanisch zu ihm und rannte dann zum Hotel. Er ließ sich Zeit, völlig unbeeindruckt, wie es schien, von dem plötzlichen Wetterumschwung. Er faltete die Badetücher zusammen, schraubte den Deckel auf eine Tube Sonnenschutzcreme, verstaute dies und jenes in einer Strandtasche und trottete dann ganz gemächlich zum Hotel zurück. Es schien ihm nichts daran zu liegen, seine Freundin einzuholen. Vielleicht war er ein Mann, der Konfrontationen gern aus dem Weg ging. Ich ließ ihm etwas Vorsprung, packte dann meine Sachen und machte mich auch auf.
Ich trat ins untere Foyer, das im allgemeinen den Elementen offenstand. Bunte Leinensofas standen so, daß man den Fernsehapparat sehen konnte. Sessel waren zu kleinen Plauderecken für die wenigen Gäste gruppiert. Der Raum erhob sich über zwei Stockwerke zu einer Galerie, die das obere Foyer mit dem Empfang abschloß. Das Paar war nirgends zu sehen. Der Barkeeper war damit beschäftigt, die hohen Holzläden zu schließen, um den Raum vor dem Eindringen des heißen, beißenden Windes zu schützen. Augenblicklich war die Bar in künstliches Dämmerlicht getaucht. Ich ging die breite, glänzende Treppe zur Linken hinauf, um im Hauptfoyer, das im Obergeschoß war, nach den beiden zu sehen. Dann wandte ich mich zum Portal, denn es konnte ja sein, daß sie doch in einem anderen Hotel wohnten und nun ihren Wagen vom Parkplatz holten. Alles war leer und verlassen. Der immer heftiger tobende Wind hatte die Menschen in die Häuser getrieben. Ich kehrte zu den Aufzügen zurück und fuhr zu meinem Zimmer hinauf.
Als ich die Schiebetür zum Balkon geschlossen hatte, war der Wind so stark geworden, daß der Sand wie ein plötzlicher sommerlicher Regenschauer gegen das Glas prasselte. Der Tag versank in geisterhaftem Zwielicht. Wendell und die Frau waren irgendwo im Hotel, hatten sich vermutlich genau wie ich in ihrem Zimmer verkrochen. Ich holte mein Buch heraus, legte mich aufs Bett unter die verblichene Baumwolldecke und las, bis mir die Augen zufielen.
Um sechs Uhr fuhr ich mit einem Ruck in die Höhe. Der Wind hatte sich wieder gelegt; und dank der wie wild arbeitenden Klimaanlage war es im Zimmer ungemütlich kalt geworden. Das Sonnenlicht war zum milden Gold des schwindenden Tages verblichen und badete die Wände meines Zimmers in sanftem maisgelben Glanz. Draußen begann das Hotelpersonal wie jeden Tag zu fegen. Alle Gehwege mußten gekehrt und die Haufen schwarzen Sandes zum Strand hinuntergefegt werden.
Ich duschte und kleidete mich an, fuhr ins Foyer hinunter und machte, in der Hoffnung, das Paar wieder zu sichten, eine Runde durchs Hotel. Ich sah mich im Restaurant, in den beiden Bars, auf der Terrasse und im Innenhof um. Vielleicht machten sie ein Nickerchen oder aßen in ihrem Zimmer zu Abend. Vielleicht waren sie auch zum Essen in den Ort gefahren. Ich schnappte mir selbst ein Taxi und ließ mich nach Viento Negro bringen. Um diese Zeit erwachte das Städtchen gerade wieder zum Leben. Die Strahlen der untergehenden Sonne vergoldeten für kurze Zeit die Telefondrähte. Die Luft war schwer von der Hitze und durchdrungen vom Geruch des Buschlands.
In einem Selbstbedienungsrestaurant im Freien fand ich einen unbesetzten Tisch für zwei – mit Blick auf eine verlassene Baustelle. Der viele von Unkraut überwachsene Beton und die rostigen Stangen und Gitter konnten meinen Appetit nicht im geringsten dämpfen. Mit einem Pappteller voll gedünsteter Shrimps, die ich schälte und in Salsa tauchte, saß ich auf einem wackligen Klappstuhl und ließ es mir schmecken. Blecherne Musik vom Band dröhnte aus den Lautsprechern über mir. Das Bier war eiskalt und das Essen, wenn auch mittelmäßig, so doch wenigstens billig und sättigend.
Um halb neun kam ich ins Hotel zurück. Wieder sah ich mich im Foyer um und machte dann noch einmal einen Abstecher zum Restaurant und den beiden Bars des Hotels. Nirgends fand ich eine Spur von Wendell oder der Frau in seiner Begleitung. Ich konnte mir nicht vorstellen, daß er unter dem Namen Jaffe reiste, es hatte also wenig Sinn, am Empfang nach ihm zu fragen. Ich hoffte, daß die beiden nicht ausgezogen waren. Eine Stunde streifte ich im Hotel herum und ließ mich endlich auf einem Sofa im Foyer in der Nähe des Eingangs nieder. Ich kramte mein Buch aus meiner Handtasche und las zerstreut bis weit nach Mitternacht.
Erst da gab ich auf und ging in mein Zimmer. Sicherlich würden die beiden am folgenden Morgen wieder auftauchen. Vielleicht konnte ich den Namen herausbekommen, unter dem Jaffe derzeit reiste. Ich wußte nicht recht, was ich mit der Information anfangen würde, aber ich war sicher, daß es Mac interessieren würde.