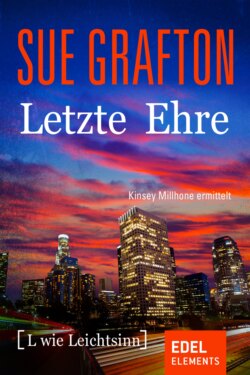Читать книгу Letzte Ehre - Sue Grafton - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеIch folgte Bucky zur Hintertür hinaus und die Stufe der Veranda hinab. »Kann es sein, daß Ihr Großvater einen Banksafe hatte?«
»Nee, das war nicht sein Stil. Pappy konnte Banken nicht leiden und hat Bankern nicht getraut. Er hatte ein Girokonto für seine Rechnungen, aber er besaß keine Aktien oder Schmuck oder irgend so etwas. Er bewahrte seine Ersparnisse – alles in allem etwa hundert Dollar – in dieser alten Kaffeebüchse hinten im Kühlschrank auf.«
»War nur eine Idee.«
Wir überquerten den uneben zementierten Autostellplatz bis hin zu der freistehenden Garage und erklommen die steile, unlackierte Holztreppe, die zu einem kleinen Absatz im ersten Stock führte, der gerade groß genug für die Tür zu John Lees Wohnung und ein schmales Schiebefenster war, das auf die Treppe hinausging. Während Bucky seine Schlüssel sortierte, hielt ich eine hohle Hand an das Glas und äugte in die möblierten Räume. Sah nach nicht viel aus: zwei Zimmer mit einer Decke, die sich von einem Firstbalken herabsenkte. Zwischen den beiden Räumen war ein Türrahmen ohne Tür. An einer Wand befand sich ein Einbauschrank, über dessen Öffnung ein Vorhang gezogen war.
Bucky schloß die Tür auf und ließ sie hinter sich offenstehen, als er hineinging. Eine Hitzewand schien den Eingang zu blockieren wie eine unsichtbare Barriere. Sogar jetzt im November hatte die auf das schlecht isolierte Dach herunterbrennende Sonne das Innere auf stickige dreißig Grad aufgeheizt. Ich blieb auf der Schwelle stehen und nahm den Geruch in mich auf wie ein Tier. Die Luft wirkte dumpf und roch nach trockenem Holz und altem Tapetenkleister. Sogar noch nach fünf Monaten konnte ich Zigarettenrauch und gebratene Speisen wahrnehmen. Noch eine Minute länger, und ich hätte vermutlich feststellen können, was der alte Mann sich als letzte Mahlzeit gekocht hatte. Bucky ging zu einem der Fenster hinüber und schob es auf. Die Luft schien sich nicht zu regen. Den knarrenden, unebenen Fußboden bedeckte eine uralte Schicht rissigen Linoleums. Die Wände waren mit einem Muster aus winzigen blauen Kornblumen auf cremefarbenem Hintergrund tapeziert, wobei die Tapete so alt war, daß sie an den Rändern wie angesengt aussah. Die Fenster, zwei an der vorderen Wand und zwei an der hinteren, hatten vergilbte Jalousien, die gegen das flache Novemberlicht halb heruntergezogen waren.
Im großen Zimmer befand sich ein Einzelbett mit weißgestrichenem Eisengestell. Eine hölzerne Kommode stand dicht vor der hinteren Wand, während eine alte Gartenmöbelgarnitur aus Korbgeflecht als Sitzgruppe diente. Ein kleiner hölzerner Schreibtisch mit passendem Stuhl war in einer Ecke untergebracht. Auf dem Fußboden standen kreuz und quer zehn bis zwölf Pappkartons in verschiedensten Größen. Manche der Kartons waren vollgepackt und beiseite gestellt worden, ihre Verschlußlaschen ineinandergesteckt, um den Inhalt zu sichern. Zwei Bretter des Bücherregals waren ausgeräumt worden, und die Hälfte der übrigen Bücher war umgekippt.
Ich suchte mir durch den Irrgarten aus Kisten einen Weg in den zweiten Raum, in dem sich ein Herd und ein kleiner Kühlschrank befanden, während auf der Arbeitsfläche dazwischen ein kleiner Mikrowellenherd stand. Eine Spüle war in ein dunkel gebeiztes Holzschränkchen mit billig wirkenden Scharnieren und Griffen eingelassen worden. Die Türen des Schränkchens sahen aus, als würden sie festkleben, wenn man versuchte, sie zu öffnen. Hinter der Küche schloß sich ein kleines Badezimmer mit Waschbecken, Toilette und einer kleinen Badewanne mit Klauenfüßen an. Sämtliche Porzellanteile waren mit Flecken übersät. Plötzlich sah ich mich selbst im Spiegel über dem Waschbecken und stellte fest, daß sich meine Mundwinkel vor Ekel nach unten verzogen hatten. Bucky hatte das Apartment als hübsch bezeichnet, aber ich würde mich lieber erschießen, als in einem solchen Loch zu enden.
Ich blickte aus einem der Fenster. Buckys Frau Babe stand an der Hintertür am anderen Ende des Wegs. Sie hatte ein rundes Gesicht mit großen braunen Augen und eine Stupsnase. Ihr Haar war dunkel und glatt und unkleidsam hinter die Ohren geklemmt. Sie trug Gummilatschen, enge schwarze Radlerhosen und ein schwarzes, ärmelloses Baumwolltop, das sich über ihrem Hängebusen spannte. Ihre Oberarme waren drall, und ihre Schenkel sahen aus, als würden sie beim Gehen aneinanderscheuern. Alles an ihr sah unangenehm feucht aus. »Ich glaube, Ihre Frau ruft nach Ihnen.«
Babes Stimme drang zu uns herauf. »Bucky?«
Er ging zum Treppenabsatz. »Komme sofort«, brüllte er zu ihr hinunter und sagte dann in gemessenerem Tonfall zu mir: »Ist es Ihnen recht, wenn ich Sie hier einfach allein lasse?« Ich sah ihm zu, wie er den Wohnungsschlüssel von seinem Schlüsselbund drehte.
»Ist mir recht. Es hört sich wirklich danach an, als hätten Sie getan, was Sie konnten.«
»Das dachte ich auch. Mein Dad ist derjenige, den es wirklich gepackt hat. Er heißt übrigens Chester, für den Fall, daß er vor uns zurückkommt.« Er reichte mir den Schlüssel. »Sperren Sie ab, wenn Sie fertig sind, und werfen Sie den Schlüssel durch den Briefschlitz in der Vordertür. Wenn Sie irgend etwas finden, das wichtig sein könnte, lassen Sie es uns wissen. Wir sind gegen ein Uhr wieder da. Haben Sie eine Visitenkarte?«
»Klar.« Ich nahm eine Karte aus meiner Tasche und reichte sie ihm.
Er steckte die Karte ein. »Alles klar.«
Ich hörte, wie er draußen die Treppe hinunterpolterte. Ich stand da und fragte mich, wie lange ich anstandshalber warten mußte, bevor ich abschloß und ging. Ich spürte, wie sich mein Magen mit der gleichen seltsamen Spannung aus Angst und Aufregung verkrampfte, wie wenn ich illegal in eine fremde Wohnung eindringe. Meine Anwesenheit hier war legal, aber ich hatte das Gefühl, als würde ich irgendwie eine unerlaubte Handlung begehen. Unten hörte ich Babe und Bucky plaudern, als sie das Haus absperrten und unter mir die Garagentür aufmachten. Ich ging ans Fenster, spähte hinunter und sah zu, wie der Wagen herauskam, dem Anschein nach direkt unter meinen Füßen. Das Auto sah aus wie ein Buick, Baujahr 1955 oder so, grün, mit einem großen, verchromten Kühlergrill. Bucky blickte über seine Schulter nach hinten, als er rückwärts die Einfahrt entlangfuhr, während Babe mit einer Hand auf seinem Knie ununterbrochen auf ihn einredete.
Ich hätte gehen sollen, sowie das Auto aus der Einfahrt verschwunden war, aber ich dachte an Henry, und mein Ehrgefühl verlangte es, daß ich wenigstens ein letztes Mal so tat, als würde ich nach etwas Bedeutsamem Ausschau halten. Ich möchte ja nicht kaltschnäuzig wirken, aber Johnny Lee bedeutete mir absolut nichts, und bei der Vorstellung, seine Sachen zu durchwühlen, packte mich das kalte Grausen. Die Wohnung war deprimierend, stickig und heiß. Sogar die Stille fühlte sich klebrig an.
Ich verbrachte ein paar Minuten damit, von einem Zimmer ins andere zu wandern. Badezimmer und Küche enthielten nichts von Belang. Ich kehrte ins große Wohnzimmer zurück und erkundete es rundum. Ich schob den Vorhang vor der Öffnung des Wandschranks beiseite. Johnnys wenige Kleider hingen in einer mutlosen Reihe da. Seine Hemden waren vom häufigen Waschen weich geworden und am Kragen abgetragen, und an manchen fehlte ein Knopf. Ich durchsuchte sämtliche Taschen und äugte in die Schuhschachteln, die auf dem Schrankbrett aufgereiht waren. Wie zu erwarten, enthielten die Schuhschachteln alte Schuhe.
Die Kommode war voller Unterwäsche, Socken, T-Shirts und ausgefranster Taschentücher; nichts Interessantes war zwischen den Stapeln verborgen. Ich setzte mich an seinen kleinen Schreibtisch und begann, systematisch eine Schublade nach der anderen aufzuziehen. Ihr Inhalt war harmlos. Bucky hatte offensichtlich den größten Teil der Papiere des alten Mannes entfernt: Rechnungen, Quittungen, eingelöste Schecks, Kontoauszüge und alte Einkommensteuererklärungen. Ich stand auf und sah in einige der geschlossenen Pappkartons, wobei ich die Deckel zurückklappte, damit ich den Inhalt durchwühlen konnte. Den größten Teil des wichtigen Finanzkrams fand ich in der zweiten Schachtel, die ich öffnete. Eine kurze Durchsuchung erbrachte nichts Erstaunliches. Ich fand keinerlei persönliche Unterlagen und auch keine praktischen gelben Umschläge voller Dokumente, die einen früheren Militärdienst belegt hätten. Aber warum sollte er Souvenirs aus Kriegszeiten auch über vierzig Jahre lang aufbewahren? Falls er es sich anders überlegte und er doch Zuschüsse beim Veteranenamt beantragen wollte, brauchte er ihnen nur die Daten zu nennen, die er vermutlich im Kopf hatte.
Die dritte Schachtel, in die ich sah, enthielt unzählige Bücher über den Zweiten Weltkrieg, was auf anhaltendes Interesse an diesem Thema schließen ließ. Worin auch immer sein eigener Beitrag zum Krieg bestanden hatte, offenbar las er gern die Schilderungen anderer. Die Titel waren eintönig, abgesehen von den wenigen, die mit Ausrufezeichen versehen waren. Jagdbomber! Bomben los! Kampfflieger in die Luft! Kamikaze! Alles war »strategisch«. Strategisches Kommando. Strategischer Luftkampf über Europa. Strategisches Luftbombardement. Strategische Kampftaktiken. Ich zog den Schreibtischstuhl näher an die Kiste heran und setzte mich. Dann zog ich ein Buch nach dem anderen heraus, hielt es am Rücken fest und blätterte die Seiten durch. Ich mache ständig so blödsinniges Zeug. Was hatte ich denn vermutet – daß mir seine Entlassungsurkunde in den Schoß fiele? Es ist eben so, daß die meisten Schnüffler aufs Schnüffeln trainiert sind. Das können wir am besten, auch wenn wir von dem betreffenden Auftrag nicht gerade begeistert sind. Wenn man uns einen Raum zur Verfügung stellt und uns zehn Minuten allein läßt, können wir gar nicht anders, als herumzuschnüffeln und automatisch in anderer Leute Angelegenheiten herumzuwühlen. Sich um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern, macht nicht halb so viel Spaß. Meine Vorstellung vom Himmel ist, versehentlich über Nacht im Polizeiarchiv eingeschlossen zu werden.
Ich überflog mehrere Seiten der Erinnerungen eines Luftwaffenpiloten und las von Luftkämpfen, Rettungsaktionen, Flammen, die aus Heckkanonen schossen, Mustangs, P-4oern, Nakajima-Jagdflugzeugen und V-Formationen. Dieses Kriegszeug steckte voller Dramatik, und ich begriff, weshalb Männer danach süchtig wurden. Ich bin selbst ein kleiner Adrenalin-Junkie und habe meine »Sucht« im Laufe zweier Jahre bei der Polizei entwickelt.
Ich hob den Kopf und hörte auf der Außentreppe das Klappern von Schritten. Ich sah auf die Uhr: Es war erst fünf nach halb elf. Gewiß war es nicht Bucky. Ich stand auf, ging zur Tür und spähte hinaus. Ein Mann Mitte sechzig war gerade auf dem Treppenabsatz angelangt.
»Kann ich Ihnen helfen?« fragte ich.
»Ist Bucky hier oben?« Er bekam langsam eine Glatze, und das weiße Haar um seinen Schädel war kurz geschnitten. Sanfte, haselnußbraune Augen, eine große Nase, ein Grübchen im Kinn und das Gesicht von weichen Falten durchzogen.
»Nein, er ist im Moment nicht da. Sind Sie Chester?«
Er murmelte: »Nein, Ma’am.« Sein Verhalten ließ vermuten, daß er in diesem Moment die Mütze gezogen hätte, wenn er eine getragen hätte. Er lächelte schüchtern und entblößte dabei eine kleine Spalte zwischen seinen beiden Vorderzähnen. »Ich heiße Ray Rawson. Ich bin ein alter Freund von Johnny... äh, bevor er gestorben ist.« Er trug Chinos, ein sauberes weißes T-Shirt und Tennisschuhe mit weißen Socken.
»Kinsey Millhone«, stellte ich mich vor. Wir schüttelten uns die Hände. »Ich wohne hier unten ganz in der Nähe.« Meine Geste war vage, vermittelte aber die ungefähre Richtung.
Rays Blick ging an mir vorbei in die Wohnung. »Haben Sie eine Ahnung, wann Bucky wieder da ist?«
»Gegen eins, hat er gesagt.«
»Möchten Sie sie mieten?«
»O Gott, nein. Sie?«
»Tja, ich hoffe darauf«, sagte er. »Wenn ich Bucky dazu überreden kann. Ich habe schon eine Anzahlung geleistet, aber er hält mich hin, was den Mietvertrag angeht. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt, aber ich habe Angst, daß er sie mir unter den Fingern weg weitervermietet. Als ich diese ganzen Kisten gesehen habe, dachte ich einen Moment lang, Sie würden einziehen.« Der Typ hatte einen Südstaaten-Akzent, den ich nicht genau einordnen konnte. Vielleicht Texas oder Arkansas.
»Ich glaube, Bucky möchte die Wohnung ausräumen. Waren Sie derjenige, der angeboten hat, für einen Mietnachlaß den ganzen Kram wegzuschaffen?«
»Nun, ja, und ich dachte, er würde darauf eingehen, aber jetzt, seit sein Vater hier ist, hecken die beiden andauernd etwas Neues aus. Zuerst haben Bucky und seine Frau beschlossen, in diese Wohnung zu ziehen und statt dessen das Haus zu vermieten. Dann sagte sein Vater, er wolle die Wohnung dafür haben, wenn er zu Besuch käme. Ich möchte ja nicht drängen, aber ich hatte gehofft, im Laufe dieser Woche einziehen zu können. Ich wohne in einem Hotel... nichts Nobles, aber es summiert sich.«
»Ich wünschte, ich könnte Ihnen helfen, aber das müssen Sie mit ihm ausmachen.«
»Oh, ich weiß, daß es nicht Ihr Problem ist. Ich wollte es nur erklären. Vielleicht schaue ich nochmal rein, wenn er zurück ist. Ich wollte nicht stören.«
»Sie stören nicht. Kommen Sie doch herein, wenn Sie möchten. Ich sehe nur gerade ein paar Kisten durch«, sagte ich. Ich setzte mich wieder auf meinen Stuhl, hob ein Buch in die Höhe und blätterte die Seiten durch.
Ray Rawson betrat den Raum mit ebensoviel Vorsicht wie eine Katze. Ich schätzte ihn auf einsfünfundsiebzig, gut achtzig Kilo, mit für einen Mann seines Alters stattlichem Brustkorb und Bizeps. An einem Arm trug er eine Tätowierung mit dem Wort »Marla« zur Schau; am anderen einen Drachen auf den Hinterbeinen, der die Zunge herausstreckte. Er sah sich interessiert um und musterte die Anordnung der Möbel. »Schön, die Wohnung wiederzusehen. Nicht so groß, wie ich sie in Erinnerung habe. Das Gedächtnis spielt einem manchmal Streiche, nicht wahr? Ich hatte mir... ich weiß nicht was ... mehr Stellfläche an den Wänden oder sowas ausgemalt.« Er lehnte sich an das Bettgestell und sah mir beim Arbeiten zu. »Suchen Sie etwas?«
»Mehr oder weniger. Bucky hofft, irgendwelche Daten über Johnnys Militärzeit zu finden. Ich bin der Durchsuchungs- und Beschlagnahmungstrupp. Waren Sie vielleicht zufällig mit ihm bei der Air Force?«
»Nee. Wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt. Wir waren damals beide auf einer Werft beschäftigt – bei den Jefferson Boat Works bei Louisville, Kentucky. Das war vor langer Zeit, kurz nach Kriegsbeginn. Wir haben LST-Landungsboote gebaut. Ich war zwanzig. Er war zehn Jahre älter und in gewisser Weise wie ein Vater für mich. Das war die Zeit des Aufschwungs. Während der Depression – früher, um 1932 – strichen die meisten Männer nicht einmal einen Riesen pro Jahr ein. Stahlarbeiter verdienten nur halb soviel, weniger als Kellnerinnen. Damals, als ich zu arbeiten anfing, ging es wirklich aufwärts. Natürlich ist alles relativ, und was wußten wir schon? Johnny machte alles mögliche. Er war ein kluger Kopf und brachte mir vieles bei. Kann ich Ihnen helfen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich bin fast fertig«, sagte ich. »Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn ich weitermache, aber ich würde gern fertig werden, bevor ich gehe.« Ich nahm das nächste Buch zur Hand und blätterte es durch, bevor ich es zu den anderen legte. Wenn Johnny eine Abneigung gegen Banken hatte, könnte er ja vielleicht Geld zwischen den Seiten versteckt haben.
»Was gefunden?«
»Nein«, sagte ich. »Ich werde Bucky wohl sagen, daß er’s vergessen soll. Die einzige Information, die er braucht, ist, in welcher Kampfeinheit sein Großvater war. Ich bin Privatdetektivin. Das hier mache ich gratis, und es kommt mir ehrlich gesagt nicht besonders ergiebig vor. Wie gut kannten Sie Johnny?«
»Recht gut, denke ich. Wir hörten voneinander... vielleicht ein- oder zweimal im Jahr. Ich wußte, daß er hier drüben Angehörige hatte, aber ich hatte sie bis jetzt nie kennengelernt.«
Ich hatte einen Rhythmus entwickelt. Ein Buch am Rücken aufnehmen, die Seiten durchblättern, es ablegen. Buch am Rücken aufnehmen, durchblättern, ablegen. Ich zog das letzte Buch aus der Kiste. »Ich kann Ihren Akzent nicht richtig einordnen. Sie haben Kentucky erwähnt. Kommen Sie von dort?« Ich stand auf und bohrte mir die Fäuste ins Kreuz, um die Steifheit zu vertreiben. Ich bückte mich und begann, die Bücher wieder in die Schachtel zu legen.
Ray hockte sich daneben und half mir. »Stimmt. Ich stamme ursprünglich aus Louisville, war aber seit Jahren nicht mehr dort. Ich habe in Ashland gewohnt, aber Johnny hat immer gesagt, wenn ich mal nach Kalifornien käme, solle ich ihn besuchen. Was soll’s. Ich hatte ein bißchen Zeit, also hab’ ich mich auf den Weg gemacht. Ich wußte die Adresse, und er hat mir erzählt, daß er in der Garagenwohnung hinter dem Haus wohnt, also bin ich zuerst hierher gekommen. Als niemand aufmachte, bin ich hinübergegangen und habe an Buckys Tür geklopft. Ich hatte keine Ahnung, daß Johnny gestorben war.«
»Muß ein Schock gewesen sein.«
»Allerdings. Mir war schrecklich zumute. Ich habe nicht mal vorher angerufen. Er hatte mir ein paar Monate zuvor einen kurzen Brief geschrieben, und ich wollte ihn überraschen. Jetzt bin ich wohl der Dumme. Wenn ich das gewußt hätte, hätte ich mir die Reise sparen können. Nicht einmal, wenn man mit dem Auto fährt, ist es billig.«
»Wie lange sind Sie schon hier?«
»Etwas über eine Woche. Ich wollte eigentlich gar nicht bleiben, aber ich bin über zweitausend Meilen gefahren, um hierher zu kommen, und ich brachte es nicht übers Herz, kehrtzumachen und zurückzufahren. Ich hätte nicht gedacht, daß mir Kalifornien gefallen würde, aber es ist schön.« Ray hatte die eine Kiste fertig gepackt, steckte die Deckellaschen ineinander und stellte sie beiseite, während ich mich an die nächste machte.
»Viele Leute finden es gewöhnungsbedürftig.«
»Ich nicht. Ich hoffe, Bucky hält mich nicht für pietätlos, weil ich hier einziehen möchte. Ich schlage nicht gern einen Vorteil aus dem Unglück anderer Menschen, aber was soll’s«, meinte er. »Darf doch ruhig auch irgend etwas Gutes dabei herauskommen. Die Gegend macht einen netten Eindruck, und ich bin gern nahe am Strand. Ich glaube nicht, daß Johnny etwas dagegen hätte. Warten Sie, ich schaffe Ihnen die aus dem Weg.« Ray hob eine Kiste hoch, stellte sie auf eine andere und schob beide auf eine Seite.
»Wo wohnen Sie jetzt?«
»Ein paar Häuserblocks weiter. Im Lexington. Gleich beim Strand, und das Zimmer hat nicht einmal Meerblick. Ich habe festgestellt, daß man von hier oben ein kleines Stück Meer sehen kann, wenn man durch die Bäume da schaut.«
Ich sah mich aufmerksam im Zimmer um, sah aber nichts weiter, was eine Untersuchung wert gewesen wäre. Johnny hatte nicht besonders viel besessen, und was er besaß, war nicht aufschlußreich. »Tja, ich glaube, ich gebe auf.« Ich klopfte meine Jeans aus und fühlte mich schmuddelig und verschwitzt. Ich ging in die Küche und wusch mir an der Spüle die Hände. Die Leitungen kreischten, und das Wasser war voller Rost. »Möchten Sie noch irgend etwas nachsehen, solange Sie hier sind? Den Wasserdruck oder die Installationen? Sie könnten noch wegen der Gardinen ausmessen, bevor ich hier zuschließe«, schlug ich vor.
Er lächelte. »Ich warte lieber, bis ich eine Art Mietvertrag unterschrieben habe. Ich sehe meinen Einzug noch nicht als garantiert an, so wie Bucky sich verhält. Wenn Sie mich fragen, ist der Junge nicht der hellste.«
Ich war ganz seiner Meinung, hielt es aber für diplomatisch, in diesem Fall meinen Mund zu halten. Ich ging wieder ins große Zimmer, holte meine Schultertasche und schlang mir den Riemen über die Schulter. Dann zerrte ich den Schlüssel aus meiner Hosentasche. Ray verließ die Wohnung direkt vor mir und wartete auf der Treppe unter mir, während ich abschloß. Danach folgte ich ihm die Stufen hinunter, und wir gingen gemeinsam die Einfahrt entlang bis zur Straße. Ich machte einen raschen Umweg über die Veranda, wo ich den Schlüssel in den Briefschlitz in der Mitte der Haustür steckte. Ich gesellte mich wieder zu ihm, und als wir auf der Straße angelangt waren, begann er in die entgegengesetzte Richtung zu gehen.
»Danke für die Hilfe. Ich hoffe, Sie und Bucky werden sich einig.«
»Das hoffe ich auch. Wiedersehen.« Er winkte kurz und ging davon.
Als ich zu Hause ankam, stand Henrys Küchentür offen, und ich vernahm Stimmengewirr, was bedeutete, daß Nell, Charlie und Lewis da waren. Noch vor Ende des Tages würden sie sich in Scrabble und Binokel, Halma und Schwarzer Peter vertiefen und sich wie Kinder beim Mensch-ärgere-dich-nicht streiten.
Als ich endlich meine Wohnung betrat, war es fast elf Uhr. Das Signallämpchen an meinem Anrufbeantworter blinkte, und ich drückte auf die Abspieltaste. »Kinsey? Hier ist deine Cousine Tasha aus Lompoc. Könntest du mich zurückrufen?« Sie hinterließ eine Telefonnummer, die ich pflichtbewußt notierte. Der Anruf war vor fünf Minuten gekommen.
Das verhieß nichts Gutes, dachte ich mir.
Im Alter von achtzehn Jahren hatte sich meine Mutter von ihrer wohlhabenden Familie gelöst, als sie gegen die Wünsche meiner Großmutter rebellierte und mit einem Briefträger davonlief. Im Beisein meiner Tante Gin, der einzigen ihrer Schwestern, die es wagte, sich auf ihre Seite zu stellen, heirateten sie und mein Vater vor einem Richter in Santa Teresa. Sowohl meine Mutter als auch Tante Gin waren aus der Familie ausgestoßen worden, eine Isolation, die noch anhielt, als ich fünfzehn Jahre später zur Welt kam. Meine Eltern hatten bereits jede Hoffnung auf Nachwuchs aufgegeben, doch mit meiner Geburt wurden wieder zaghafte Kontakte zu den übrigen Schwestern geknüpft, welche die wiederaufgenommenen Gespräche geheim hielten. Als meine Großeltern anläßlich ihres Hochzeitstags auf einer Kreuzfahrt waren, fuhren meine Eltern zu Besuch nach Lompoc. Ich war damals vier und erinnere mich nicht daran. Ein Jahr später, als wir zu einem anderen heimlichen Treffen in Richtung Norden unterwegs waren, kam ein Felsbrocken den Berg heruntergerollt, zertrümmerte unsere Windschutzscheibe und tötete meinen Vater auf der Stelle. Das Auto kam von der Straße ab, und meine Mutter erlitt schwere Verletzungen. Sie starb kurz darauf, während die Sanitäter noch damit beschäftigt waren, uns aus dem Wrack herauszuholen.
Danach wurde ich von Tante Gin aufgezogen, und soweit ich weiß, gab es keine weiteren Kontakte zur Familie. Tante Gin hatte nie geheiratet, und ich wurde aufgrund ihrer etwas merkwürdigen Vorstellungen erzogen, wie ein kleines Mädchen zu sein hatte. Infolgedessen bin ich zu einem etwas seltsamen Wesen geworden, obwohl ich nicht annähernd so »verdreht« bin, wie manche Leute glauben mögen. Seit dem Tod meiner Tante vor ungefähr zehn Jahren habe ich mit meinem einsamen Status Frieden geschlossen.
Ich hatte vor einem Jahr im Zuge von Ermittlungen von meinen »lange verschollenen« Verwandten erfahren und es bislang geschafft, sie mir vom Leib zu halten. Die bloße Tatsache, daß sie eine Beziehung wollten, verpflichtete mich zu nichts. Ich gebe zu, daß ich auf die Angelegenheit vielleicht ein wenig schlecht zu sprechen war, aber ich konnte es nicht ändern. Ich bin fünfunddreißig Jahre alt, und mein Waisenstatus ist mir ganz recht. Außerdem – wenn man in meinem Alter »adoptiert« wird, woher soll man da wissen, daß sie nicht bald ernüchtert sein und einen wieder verstoßen werden?
Ich nahm das Telefon und wählte Tashas Nummer, bevor ich Zeit hatte, mich aufzuregen. Sie meldete sich, und ich sagte, wer ich war.
»Danke, daß du so schnell zurückrufst. Wie geht’s dir?« sagte sie.
»Mir geht’s gut«, antwortete ich und versuchte herauszufinden, was sie von mir wollte. Ich war ihr nie begegnet, doch während eines vorhergegangenen Telefongesprächs hatte sie mir erzählt, daß sie Anwältin für Erbrecht war und Testamente und Nachlässe bearbeitete. Brauchte sie eine Privatdetektivin? Wollte sie mich in Sachen Treuhandverwaltung beraten?
»Hör mal, meine Liebe. Ich rufe an, weil wir hoffen, daß wir dich dazu überreden können, nach Lompoc heraufzukommen und Thanksgiving mit uns zu verbringen. Die ganze Familie wird da sein, und wir dachten, daß es eine nette Gelegenheit wäre, um sich kennenzulernen.«
Ich merkte, wie sich meine Stimmung verdüsterte. Ich hatte null Interesse an diesem Familientreffen, beschloß jedoch, höflich zu sein. Ich versah meine Stimme mit einem unechten Unterton des Bedauerns. »Ach, du liebe Zeit, danke, Tasha, aber da bin ich schon verplant. Gute Freunde von mir heiraten an diesem Tag, und ich bin Brautjungfer.«
»An Thanksgiving? Das ist aber merkwürdig.«
»Es war der einzige Termin, an dem sie es einrichten konnten«, sagte ich und dachte ha ha hi hi.
»Wie wär’s mit Freitag oder Samstag an dem Wochenende?« schlug sie vor.
»Ah.« Mir fiel rein gar nichts ein. »Mmm... ich glaube, da habe ich zu tun, aber ich könnte mal nachsehen«, sagte ich. In beruflichen Angelegenheiten bin ich eine hervorragende Lügnerin. Im privaten Bereich bin ich genauso phantasielos wie jeder andere. Ich griff nach meinem Kalender und wußte genau, daß nichts darin stand. Einen Sekundenbruchteil lang spielte ich mit dem Gedanken, »ja« zu sagen, doch in meinem Innersten erhob sich instinktives Protestgeheul. »O je. Nein, da kann ich nicht.«
»Kinsey, ich kann deinen Widerwillen spüren, und ich muß dir sagen, wie leid uns das allen tut. Der Streit zwischen deiner Mutter und Grand hatte doch mit dir nichts zu tun. Wir würden es gern wiedergutmachen, wenn du uns läßt.«
Ich merkte, wie meine Augäpfel nach oben rollten. So sehr ich gehofft hatte, dieser Sache zu entgehen, mußte ich mich ihr nun stellen. »Tasha, das ist lieb, und es freut mich, daß du das sagst, aber es wird nicht funktionieren. Ich weiß nicht, was ich dir sonst sagen soll. Die Vorstellung, dort hinaufzufahren, ist mir sehr unangenehm, noch dazu an einem Feiertag.«
»Oh, wirklich? Warum das?«
»Ich, weiß nicht, warum. Ich habe keine Erfahrung mit Familie, und daher ist das auch nichts, was mir fehlen würde. So ist es nun mal.«
»Möchtest du nicht deine anderen Cousinen kennenlernen?«
»Äh, Tasha, ich hoffe, das klingt jetzt nicht grob, aber bislang sind wir auch gut ohne einander ausgekommen.«
»Woher willst du wissen, ob du uns nicht mögen würdest?«
»Das würde ich vermutlich sogar«, sagte ich. »Darum geht es nicht.«
»Worum dann?«
»Zum einen sind Gruppen nicht mein Fall, und außerdem, bin ich nicht besonders scharf darauf, bedrängt zu werden«, erklärte ich.
Schweigen. »Hat das etwas mit Tante Gin zu tun?« wollte sie wissen.
»Tante Gin? Überhaupt nicht. Wie kommst du darauf?«
»Wir haben gehört, daß sie exzentrisch war. Ich gehe vermutlich davon aus, daß sie dich irgendwie gegen uns aufgehetzt hat.«
»Wie das? Sie hat euch kein einziges Mal auch nur erwähnt.«
»Findest du nicht, daß das seltsam war?«
»Natürlich ist es seltsam. Paß auf, Tante Gin hielt viel von Theorie, aber sie war offenbar nicht sonderlich erpicht auf menschliche Kontakte. Das soll keine Beschwerde sein. Sie hat mir vieles beigebracht, und vieles davon wußte ich sehr zu schätzen, aber ich bin nicht wie andere Leute. Offen gesagt, ist mir momentan meine Unabhängigkeit lieber.«
»Das ist doch Schwachsinn. Das glaube ich dir nicht. Wir bilden uns alle gern ein, wir wären unabhängig, aber kein Mensch lebt isoliert. Wir sind eine Familie. Du kannst die Verwandtschaft nicht leugnen. Sie ist eine Tatsache. Du gehörst zu uns, ob es dir paßt oder nicht.«
»Tasha, laß uns mal Klartext reden, wenn wir schon dabei sind. Es wird keine rührenden, sentimentalen Familienszenen geben. Das ist einfach nicht drin. Wir werden uns nicht zu irgendwelchen nostalgischen Singrunden ums Klavier versammeln.«
»So sind wir auch nicht. Wir machen so etwas nicht.«
»Ich spreche nicht von euch. Ich versuche, dir von mir zu erzählen.«
»Willst du denn nichts von uns?«
»Was denn zum Beispiel?«
»Jetzt bist du wohl wütend.«
»Gespalten«, korrigierte ich. »Die Wut liegt ein paar Schichten tiefer. So weit bin ich noch nicht vorgedrungen.«
Sie schwieg einen Moment lang. »In Ordnung. Das akzeptiere ich. Ich verstehe deine Reaktion, aber warum willst du es an uns auslassen? Wenn Tante Gin ›unzulänglich‹ war, hättest du das mit ihr ausmachen müssen.«
Ich spürte, wie sich in mir der Widerstand regte. »Sie war nicht ›unzulänglich‹. Das habe ich nicht gesagt. Sie hatte exzentrische Ansichten über Kindererziehung, aber sie tat, was sie konnte.«
»Ich bin mir sicher, daß sie dich geliebt hat. Ich wollte nicht unterstellen, daß sie unfähig war.«
»Ich sage dir mal eines. Was auch immer ihre Mängel waren, sie hat mehr getan, als Grand je getan hat. Im Grunde hat sie wahrscheinlich die gleiche Art von Mütterlichkeit weitervermittelt, die sie selbst mitbekommen hat.«
»Du bist also eigentlich wütend auf Grand.«
»Natürlich! Das habe ich dir von Anfang an gesagt«, rief ich. »Hör mal, ich fühle mich nicht als Opfer. Was vorbei ist, ist vorbei. Es hat sich eben so ergeben, wie es ist, und ich kann damit leben. Es ist verrückt, sich einzubilden, daß wir alles zurückdrehen und das Ergebnis ändern können.«
»Natürlich können wir die Vergangenheit nicht ändern, aber wir können beeinflussen, was jetzt geschieht«, sagte Tasha. Sie schlug eine andere Gangart ein. »Nichts für ungut. Vergiß es. Ich möchte dich nicht provozieren.
»Ich möchte genausowenig wie du zu streiten anfangen«, sagte ich.
»Ich versuche nicht, Grand in Schutz zu nehmen. Ich weiß, daß es falsch war, was sie getan hat. Sie hätte Kontakt aufnehmen sollen. Sie hätte es tun können, aber sie hat es nicht getan, okay? Das sind alte Geschichten. Vergangenheit. Es hat mit keiner von uns etwas zu tun, also warum es noch eine Generation weiterschleppen? Ich liebe sie. Sie ist ein Schatz. Außerdem ist sie eine übellaunige, knauserige alte Dame, aber sie ist kein Ungeheuer.«
»Ich habe nie behauptet, daß sie ein Ungeheuer sei.«
»Warum kannst du es dann nicht einfach ad acta legen und weitermachen? Du bist unfair behandelt worden. Das hat zu einigen Problemen geführt, aber jetzt ist es aus und vorbei.«
»Abgesehen davon, daß ich fürs Leben gezeichnet bin und zwei ruinierte Ehen hinter mir habe, die das belegen. Ich bin bereit, das zu akzeptieren. Wozu ich aber nicht bereit bin, ist, alles unter den Teppich zu kehren, damit sie sich gut fühlt.«
»Kinsey, mir ist unwohl bei diesem... Groll, den du mit dir herumträgst. Das ist nicht gesund.«
»Ach, komm wieder auf den Boden. Warum überläßt du die Sorge um meinen Groll nicht mir?« sagte ich. »Weißt du, was ich letztlich gelernt habe? Ich muß nicht perfekt sein. Ich kann fühlen, was ich fühle, und sein, wer ich bin, und wenn dir das unangenehm ist, dann bist du vielleicht diejenige mit dem Problem, und nicht ich.«
»Du bist also entschlossen, gekränkt zu sein, oder?«
»He, Schätzchen, nicht ich habe dich angerufen. Du hast mich angerufen«, sagte ich. »Es ist nur schlicht und einfach zu spät.«
»Du klingst so verbittert.«
»Ich bin nicht verbittert. Ich bin realistisch.«
Ich spürte, wie sie mit sich selbst absprach, wie sie weiter verfahren sollte. Die Anwältin in ihrer Natur neigte vermutlich dazu, nachzuhaken wie bei einem gegnerischen Zeugen. »Tja, ich sehe ein, daß es keinen Zweck hat, das weiterzuverfolgen.«
»Stimmt.«
»Unter diesen Umständen gibt es wohl auch keinen Grund für ein gemeinsames Mittagessen.«
»Wahrscheinlich nicht.«
Sie atmete schwer aus. »Nun gut. Wenn es jemals etwas gibt, was ich für dich tun kann, hoffe ich, daß du mich anrufst«, sagte sie.
»Das ist nett von dir. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, was das sein könnte, aber ich werde es mir merken.«
Ich legte den Telefonhörer auf, und mein Rücken war ganz feucht vor lauter Anspannung. Ich stieß ein Bellen aus und schüttelte mich von Kopf bis Fuß. Dann floh ich vom Ort des Geschehens, da ich fürchtete, Tasha könnte umschwenken und noch einmal anrufen. Ich ging auf einen Sprung in den Supermarkt, wo ich das Nötigste besorgte: Milch, Brot und Klopapier. Ich hielt bei der Bank und reichte einen Scheck ein, hob fünfzig Dollar in bar ab, tankte meinen VW voll und kehrte nach Hause zurück. Ich war gerade dabei, die Lebensmittel zu verstauen, als das Telefon klingelte. Beklommen nahm ich den Hörer ab. Die Stimme, die mich begrüßte, gehörte Bucky.
»He, Kinsey? Hier ist Bucky. Sie kommen am besten gleich rüber. Jemand ist in Pappys Wohnung eingebrochen, und vielleicht möchten Sie sich mal umsehen.«