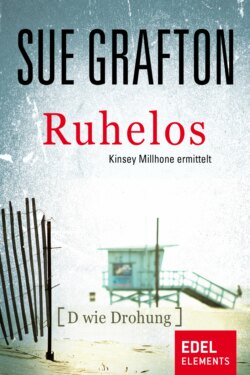Читать книгу Ruhelos - Sue Grafton - Страница 5
3
ОглавлениеDa ich schon mal in der Gegend war, ging ich gleich noch bei der Bank vorbei. Die Frau am Beratungsschalter hätte kaum weniger hilfsbereit sein können. Sie hatte dunkles Haar, war Anfang Zwanzig und wohl neu dort. Das entnahm ich der Tatsache, daß sie auf jede einzelne meiner Fragen mit dem gequälten Blick eines Menschen reagierte, der sich über die Bestimmungen nicht sicher ist und deshalb zu allem nein sagt. Sie wollte »Alvin Limardos« Kontonummer nicht bestätigen, ebensowenig wie die Tatsache, daß das Konto gelöscht worden war. Sie wollte mir auch nicht sagen, ob es vielleicht ein anderes Konto unter John Daggetts Namen gab. Ich wußte, daß es eine Kopie der Kassenanweisung selbst geben mußte, aber sie weigerte sich, die Information zu bestätigen, die er selbst mir gegeben hatte. Ich glaubte immer noch, daß ich einen anderen Weg einschlagen konnte, vor allem, wo es um so viel Geld ging. Es konnte der Bank doch gewiß nicht gleichgültig sein, was mit fünfundzwanzigtausend Dollar geschah. Ich stand am Schalter und starrte die Frau an, und sie starrte zurück. Vielleicht hatte sie nicht begriffen.
Ich zog die Fotokopie meiner Lizenz hervor und zeigte darauf. »Schauen Sie her, sehen Sie das? Ich bin Privatdetektiv. Ich habe wirklich ein Problem. Ich wurde beauftragt, eine Kassenanweisung zuzustellen, aber jetzt kann ich den Mann nicht finden, der mir die Anweisung gegeben hat, und ich weiß nicht, wo sich die Person aufhält, die das Geld erhalten soll. Ich versuche doch nur, eine Spur ausfindig zu machen, damit ich tun kann, was man mir aufgetragen hat.«
»Das verstehe ich.«
»Aber Sie wollen mir keine der nötigen Informationen geben, richtig?«
»Das verstößt gegen die Bankvorschriften.«
»Verstößt es denn nicht gegen die Bankvorschriften, wenn Alvin Limardo mir einen ungedeckten Scheck ausstellt?«
»Doch.«
»Was soll ich dann damit tun?« Ich kannte die Antwort bereits ... vergessen Sie ihn ... aber ich fühlte mich stur und pervers.
»Bringen Sie ihn vor Gericht«, schlug sie vor.
»Aber ich kann den Mann nicht finden. Er kann nicht vor Gericht gestellt werden, wenn niemand weiß, wo er ist.«
Sie starrte mich nur stumm an.
»Was ist mit den fünfundzwanzigtausend Dollar?« wollte ich wissen. »Was soll ich damit tun?«
»Keine Ahnung.«
Ich starrte auf den Tisch. Als ich im Kindergarten war, war ich bissig, und ich kämpfe noch heute mit diesem Trieb. Es gibt einem einfach ein gutes Gefühl, verstehen Sie? »Ich möchte mit Ihrem Vorgesetzten sprechen.«
»Mr. Stallings? Der hat schon Feierabend.«
»Also schön, gibt es hier sonst irgend jemanden, der mir dabei helfen könnte?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich bin für den Kundendienst zuständig.«
»Aber Sie tun doch nichts. Wie können Sie das Kundendienst nennen, wenn Sie überhaupt nichts tun?«
Sie preßte die Lippen zusammen. »Bitte reden Sie nicht so mit mir. Das ist sehr beleidigend.«
»Was muß ich also tun, damit mir hier jemand hilft?«
»Haben Sie ein Konto bei uns?«
»Wenn ich es hätte, würde das helfen?«
»Nicht in diesem Fall. Es ist uns nicht gestattet, Informationen über unsere Kunden weiterzugeben.«
Das war nun wirklich albern. Ich entfernte mich von ihrem Schalter. Ich wollte eine beißende Bemerkung machen, aber mir fiel keine ein. Ich weiß, daß ich einfach wütend auf mich selbst war, weil ich diesen Job überhaupt angenommen hatte, aber ich hoffte, ein wenig Zorn an ihr auszulassen ... ein sinnloses Unterfangen. Ich kehrte zu meinem Wagen zurück und steuerte den Freeway an. Als ich Santa Teresa erreichte, war es 4 Uhr 35. Ich fuhr einfach am Büro vorbei und direkt nach Hause. Meine Laune besserte sich im selben Augenblick, als ich eintrat. Meine Wohnung war früher eine Einzelgarage und besteht jetzt aus einem Zimmer, sechs Meter jede Wand, mit einer schmalen Ausbuchtung zur Rechten, die als Kochnische dient und durch eine Anrichte vom Wohnbereich abgetrennt ist. Der Raum ist hervorragend genutzt: eine kombinierte Wasch-Trocken-Maschine neben dem Herd, Bücherregale, Schubladen und Vorratskammern in die Wand eingebaut. Alles ist sauber und ordentlich und genau das Richtige für mich. Ich besitze ein ausziehbares Sofa, auf dem ich zur Zeit meistens nur schlafe, einen Schreibtisch, einen Stuhl, einen Beistelltisch und dicke Kissen, die als zusätzliche Sitzplätze dienen, wenn Besuch kommt.
Mein Badezimmer ist eine dieser vorgeformten Naßzellen, in die alles eingelassen ist, einschließlich Handtuchhalter, Seifenschale und ein Ausschnitt für das Fenster, das auf die Straße hinausgeht. Manchmal stehe ich in der Badewanne, die Ellbogen auf das Fensterbrett gestützt, und schaue den vorbeifahrenden Autos zu, denke, wie glücklich ich doch bin. Ich bin gern allein. Das ist fast so, als wäre man reich.
Ich ließ meine Handtasche auf den Schreibtisch fallen und hängte die Jacke an einen Haken. Dann setzte ich mich auf die Couch und zog die Stiefel aus, ehe ich zum Kühlschrank hinübertappte und eine Flasche Weißwein und einen Korkenzieher holte. Hin und wieder versuchte ich, mich zu benehmen, als hätte ich Stil, mit anderen Worten, ich trinke Wein aus einer Flasche und nicht aus einem Pappbehälter. Ich zog den Korken heraus und goß mir etwas in ein Glas. Dann ging ich zum Schreibtisch hinüber, holte das Telefonbuch aus der obersten Schublade und schleppte Telefon, Buch und Weinglas zum Sofa. Ich stellte das Weinglas auf den Beistelltisch und blätterte das Buch durch, um zu sehen, ob Billy Polo geführt wurde. Natürlich wurde er nicht. Ich schlug den Namen Gahan nach. Nichts. Ich trank etwas Wein und überlegte, was ich als nächstes tun könnte.
Aus einem Impuls heraus suchte ich nach Daggett. Lovella hatte erwähnt, daß er früher hier gelebt hatte. Vielleicht hatte er noch Verwandte in der Stadt.
Es waren vier Daggetts aufgeführt. Ich wählte sie der Reihe nach an und sagte jedesmal dasselbe. »Hallo. Ich versuche, einen John Daggett zu erreichen, der früher hier in der Gegend gewohnt hat. Können Sie mir sagen, ob das die richtige Nummer ist?«
Die beiden ersten Anrufe brachten mich nicht weiter, aber bei dem dritten reagierte der Mann, der meine Frage entgegennahm, mit diesem sonderbaren Schweigen, das verrät, daß eine Information zu erwarten ist.
»Was wollen Sie von ihm?« fragte er. Er hörte sich an, als wäre er um die Sechzig, wählte seine Worte vorsichtig, achtete sorgsam auf meine Antwort, war aber unentschieden, wieviel er verraten sollte.
Er kam tatsächlich direkt auf den kitzligsten Teil der Sache zu sprechen. Nach allem, was ich über Daggett gehört hatte, war er ein Schurke. Also wagte ich nicht, mich als seine Freundin zu bezeichnen. Wenn ich zugab, daß er mir Geld schuldete, würde man am anderen Ende nur den Hörer auf die Gabel knallen. Für gewöhnlich erklärte ich in einer solchen Situation, daß ich Geld für ihn hätte, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das würde in diesem Fall nicht klappen. Die Leute kommen allmählich hinter diesen Mist.
Ich band ihm die erste Lüge auf, die mir einfiel. »Also, um die Wahrheit zu sagen, ich habe John nur einmal gesehen, aber ich versuche, einen gemeinsamen Bekannten zu finden, und ich glaube, John hat seine Adresse und Telefonnummer.«
»Wen wollten Sie denn sprechen?«
Das überraschte mich total, da ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht hatte. »Wen? Äh ... Alvin Limardo. Hat John Alvin je erwähnt?«
»Nein, ich glaube nicht. Aber vielleicht sind Sie hier doch nicht richtig. Der John Daggett, der hier gewohnt hat, ist derzeit im Gefängnis, und zwar seit, ich würde sagen, zwei Jahren.« Seine Art ließ einen Mann ahnen, der selbst noch aus einer falschen Verbindung interessante Möglichkeiten zieht. Trotzdem war es klar, daß ich ins Schwarze getroffen hatte.
»Das ist genau der, von dem ich rede. Er war in San Luis Obispo.«
»Ist er noch.«
»O nein. Er ist draußen. Er ist vor sechs Wochen entlassen worden.«
»John? O nein, Ma’am. Der ist noch im Gefängnis, und ich hoffe, er bleibt auch da. Ich will ja nichts Schlechtes von dem Mann sagen, aber er ist genau das, was ich einen problematischen Menschen nenne.«
»Problematisch?«
»Nun ja. So muß man das wohl sehen. John gehört zu der Sorte Menschen, die Probleme schaffen, und zwar für gewöhnlich ernsthafte.«
»Ach, wirklich? Das habe ich gar nicht gemerkt.« Es gefiel mir, daß der Mann bereit war zu schwatzen. Wenn ich ihn am Reden halten konnte, fiel mir vielleicht sogar noch ein, wie ich eine Verbindung zu Daggett herstellen könnte. Ich gab einen Schuß ins Blaue ab. »Sind Sie sein Bruder?«
»Ich bin sein Schwager, Eugene Nickerson.«
»Dann müssen Sie mit seiner Schwester verheiratet sein.«
Er lachte. »Nein, er ist mit meiner Schwester verheiratet. Sie war eine Nickerson, ehe sie eine Daggett wurde.«
»Dann sind Sie Lovellas Bruder?« Ich versuchte mir Geschwister mit einem Altersunterschied von vierzig Jahren vorzustellen.
»Nein, Essies.«
Ich hielt den Hörer ein Stück von meinem Ohr ab und starrte ihn an. Wovon redete er eigentlich? »Äh, Moment mal. Vielleicht bin ich ein wenig durcheinander. Vielleicht reden wir doch nicht von demselben Mann.« Ich gab ihm ein kurzes Porträt in Worten von dem John Daggett, den ich kannte. Ich konnte mir zwar nicht vorstellen, daß es zwei geben sollte, aber irgend etwas stimmte hier nicht.
»Das ist er schon. Wie, sagten Sie, haben Sie ihn kennengelernt?«
»Ich habe ihn letzten Samstag getroffen, hier in Santa Teresa.«
Das Schweigen am anderen Ende der Leitung wog schwer.
Schließlich unterbrach ich es. »Gibt es eine Möglichkeit, daß ich vorbeikomme, damit wir uns in Ruhe unterhalten können?« fragte ich.
»Ich glaube, das wäre das beste. Wie heißen Sie wieder?«
»Kinsey Millhone.«
Er erklärte mir, wie ich zu dem Haus kommen würde.
Es war ein weißes Haus mit einer kleinen Holzveranda, das sich in den Schatten des Capillo Hill auf der Westseite der Stadt duckte. Es war eine kurze Straße, nur drei Häuser auf jeder Seite, ehe der Teerbelag in den Kiesflecken überging, der neben dem Haus der Daggetts als Parkplatz diente. Auf der anderen Seite des Hauses wuchsen spärliche Bäume und Unterholz auf dem Hügel. Sonnenlicht drang niemals in den Hof. Ein durchhängender Zaun aus Maschendraht verlief entlang der Grundstücksgrenzen. In Intervallen waren Büsche eingepflanzt worden, waren aber nicht angegangen, so daß es jetzt nur Haufen getrockneter Zweige gab. Das Haus hatte einen Armesünderblick wie ein Streuner, der nur darauf wartete, daß die Hundefänger kommen.
Ich stieg die steilen Holzstufen empor und klopfte. Eugene Nickerson öffnete die Tür. Er war ziemlich genau so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte: um die Sechzig, von mittlerer Größe, mit drahtigem, grauem Haar und zusammengezogenen Augenbrauen. Seine Augen waren klein und blaß, die Wimpern nahezu weiß. Schmale Schultern, dicke Taille, Hosenträger, Flanellhemd. In der linken Hand hielt er eine Bibel, den Zeigefinger zwischen den Seiten, um die Stelle nicht zu verlieren.
O-ho, dachte ich.
»Ich muß Sie noch einmal um Ihren Namen bitten«, sagte er, als er mich einließ. »Mein Gedächtnis ist auch nicht mehr, was es mal war.«
Ich schüttelte ihm die Hand. »Kinsey Millhone. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Nickerson. Ich hoffe, ich störe nicht.«
»Aber überhaupt nicht. Wir bereiten uns auf unsere Bibelstunde vor. Normalerweise treffen wir uns mittwochs abends, aber diese Woche liegt unser Pfarrer mit Grippe im Bett, und deshalb ist das Treffen verschoben worden. Das ist meine Schwester, Essie Daggett, Johns Frau.« Er zeigte auf die Frau, die auf dem Sofa saß. »Sie können mich Eugene nennen, wenn Sie wollen«, fügte er noch hinzu. Ich lächelte kurz als Zeichen meiner Zustimmung und konzentrierte mich dann auf sie.
»Hallo, wie geht es Ihnen? Ich danke Ihnen, daß ich so einfach kommen durfte.« Ich trat zu ihr und streckte ihr die Hand hin. Sie ließ es zu, daß ein paar Finger kurz in meiner Hand ruhten. Es war, als schüttelte man einen Gummihandschuh.
Sie hatte ein breites, farbloses Gesicht, das ergrauende Haar war ungünstig geschnitten, und sie trug eine Brille mit dicken Gläsern und einem schweren Plastikrahmen. Auf der rechten Seite ihrer Nase hatte sie einen Grützbeutel, der etwa so groß war wie ein Stückchen Popcorn. Ihr Unterkiefer ragte aggressiv vor, zeigte auf beiden Seiten aufragende Eckzähne. Sie roch stark nach Maiglöckchen.
Eugene bedeutete mir, Platz zu nehmen, und ich hatte die Wahl zwischen der Couch, auf der Essie saß, und einem Stuhl, aus dem eine Feder herausragte. Ich entschied mich für den Sessel und setzte mich ganz nach vorne, um nicht noch etwas kaputtzumachen. Eugene selbst nahm in einem Korbschaukelstuhl Platz, der unter seinem Gewicht knarrte. Er nahm das schmale, purpurfarbene Band, das aus der Bibel heraushing, kennzeichnete die Stelle, an der er war, und legte das Buch dann vor sich auf den Tisch. Essie hatte noch nichts gesagt, hielt den Blick starr auf ihren Schoß gerichtet.
»Kann ich Ihnen ein Glas Wasser holen?« bot er an. »Wir haben nie koffeinhaltige Getränke hier, aber ich kann Ihnen gern 7-Up anbieten.«
»Danke, ich möchte nichts«, sagte ich. Ich machte mir ernsthafte Gedanken. Wenn man mit strenggläubigen Christen zusammen ist, dann ist das ungefähr genauso wie mit ganz Reichen. Man spürt, daß gewisse Regeln befolgt werden, eine sonderbare Etikette, die man unabsichtlich verletzen könnte. Ich versuchte, nur harmlose Dinge zu denken, und hoffte, ich würde nicht mit einem Schimpfwort herausplatzen. Wie konnte John Daggett mit diesen beiden verwandt sein?
Eugene räusperte sich. »Ich habe Essie gerade das Durcheinander zu erklären versucht, wo sich John Daggett herumtreibt. Wir waren der Meinung, daß John noch im Gefängnis sitzt, aber Sie scheinen einen anderen Standpunkt zu vertreten.«
»Ich bin genauso verwirrt wie Sie.« Ich dachte schnell nach, fragte mich, wieviel Informationen ich erhalten konnte, ohne etwas zu verraten. So wütend ich auch auf Daggett war, wollte ich doch nicht indiskret werden. Nicht nur, daß er auf Bewährung entlassen war – da war auch noch Lovella. Ich wollte nicht diejenige sein, die aus der Schule plaudert und dieser Frau, die scheinbar noch mit ihm verheiratet war, von seiner neuen Braut erzählen. »Haben Sie zufällig ein Foto von ihm?« erkundigte ich mich. »Es wäre ja möglich, daß der Mann, mit dem ich gesprochen habe, einfach nur behauptet, Ihr Schwager zu sein.«
»Ich weiß nicht«, meinte Eugene zweifelnd. »Nach allem, was Sie erzählt haben, wie Sie ihn beschrieben haben – das hörte sich schon sehr nach ihm an.«
Essie streckte die Hand aus und griff nach einem Farbfoto im verzierten Silberrahmen. »Das ist an unserem fünfunddreißigsten Hochzeitstag gemacht worden«, erzählte sie. Ihre Stimme klang nasal, mit mürrischem Unterton. Sie gab das Foto an ihren Bruder weiter, als hätte er es nie zuvor gesehen und würde vielleicht auch gern einen Blick darauf werfen.
»Kurz ehe John nach San Luis mußte«, erläuterte Eugene und reichte mir das Foto. Seinem Ton nach hätte man glauben können, John befände sich auf einer Geschäftsreise.
Ich musterte das Bild. Das war wirklich Daggett. Er wirkte so verlegen wie jemand in einer dieser Buden, in denen man sich als Konföderierter oder viktorianischer Gentleman verkleiden kann. Sein Kragen sah zu eng aus, sein Haar zu schlüpfrig von der Pomade. Auch sein Gesicht wirkte verspannt, als wollte er jede Minute davonlaufen. Essie saß neben ihm, so ungerührt wie eine Grießschnitte. Sie trug etwas, das aussah wie ein violettes Crêpe-de-Chine-Kleid mit Schulterpolstern und Glasknöpfen und einem wuchtigen Orchideen-Schmuck auf der linken Schulter.
»Reizend«, murmelte ich und fühlte mich falsch und schuldbewußt. Es war ein schreckliches Bild. Sie sah aus wie eine Bulldogge und John wie jemand, der mühsam einen Furz unterdrückt.
Ich gab Essie das Bild zurück. »Welche Art Verbrechen hat er begangen?«
Essie holte hörbar Luft.
»Wir ziehen es vor, nicht davon zu sprechen«, warf Eugene ein. »Vielleicht sollten Sie uns erzählen, wie Sie selbst ihn kennengelernt haben.«
»Nun ja, ich kenne ihn natürlich nicht so gut. Ich glaube, das habe ich bereits am Telefon gesagt. Wir haben einen gemeinsamen Freund, und er ist derjenige, mit dem ich hoffte, Verbindung aufnehmen zu können. John hat erwähnt, daß er in dieser Gegend Verwandte hat, und da habe ich es einfach versucht. Ich vermute, Sie haben in letzter Zeit nicht mit ihm gesprochen.«
Essie rückte auf der Couch herum. »Wir haben, so lange wir konnten, zu ihm gehalten. Der Pfarrer sagt, seiner Meinung nach haben wir genug getan. Wir wissen nicht, womit John im Finstern seiner Seele ringt, aber es gibt Grenzen für das, was andere hinnehmen können.« Schärfe lag in ihrer Stimme, und ich fragte mich, woher sie rührte: Zorn, Beleidigung vielleicht, das Märtyrertum der Sanftmütigen unter den Händen der Elenden.
»Ich schätze, John ist eine harte Probe gewesen!«
Essie preßte die Lippen zusammen, verschränkte die Hände auf dem Schoß. »Nun, das ist genau, wie es in der Bibel steht. ›Liebet eure Feinde; segnet, die euch fluchen; tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen!‹« Ihr Ton war anklagend. Sie begann, aufgeregt hin- und herzuwippen.
Himmel, dachte ich, diese Dame ist bereits auf 100.
Eugenes Stuhl knarrte, er selbst zog meine Aufmerksamkeit durch ein leises Räuspern auf sich. »Sie sagten, Sie hätten ihn am Samstag gesehen. Darf ich fragen, bei welcher Gelegenheit?«
Da wurde mir klar, daß ich der Geschichte, die ich erzählen wollte, viel mehr Zeit hätte widmen müssen, denn jetzt wußte ich nicht, was ich antworten sollte. Essie Daggetts Ausbruch hatte mich so entnervt, daß mein Hirn ganz leer war.
In diesem Augenblick beugte sie sich vor. »Sind Sie errettet worden?«
»Verzeihung, was?« Ich blinzelte sie an.
»Haben Sie Jesus in Ihrem Herzen aufgenommen? Haben Sie die Sünde verworfen? Haben Sie Buße getan? Sind Sie im Blut des Lammes gewaschen worden?«
Ein Tröpfchen Spucke landete auf meinem Gesicht, aber ich wagte nicht zu reagieren. »In letzter Zeit nicht«, sagte ich. Was habe ich nur an mir, daß ich Frauen wie sie anziehe?
»Hör mal, Essie, sie ist bestimmt nicht hergekommen, um über den Zustand ihrer Seele zu reden«, bemerkte Eugene. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Herrje, ich glaube, es wird Zeit für deine Medizin.«
Ich ergriff die Gelegenheit, um mich zu erheben. »Ich möchte Ihre Zeit nicht noch mehr in Anspruch nehmen«, entschuldigte ich mich. »Ich bin für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit wirklich dankbar, und wenn ich noch weitere Informationen benötige, werde ich Sie anrufen.« Ich suchte in meiner Tasche nach einer Visitenkarte und ließ sie auf dem Tisch zurück.
Essie lief inzwischen auf Hochtouren. »›Und sie werden mit Steinen werfen ...‹«
»Also, noch mal vielen Dank«, rief ich auf dem Weg zur Tür. Eugene tätschelte Essies Hände, zu abgelenkt, um sich wegen meines Aufbruchs Gedanken machen zu können.
Ich schloß die Tür und trabte eilig zu meinem Wagen zurück. Es war dunkel, und die Nachbarschaft gefiel mir nicht.