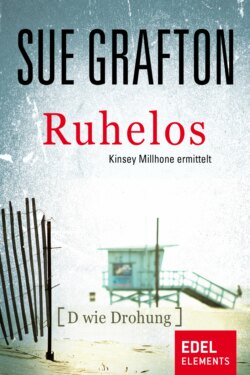Читать книгу Ruhelos - Sue Grafton - Страница 7
5
ОглавлениеAls ich schließlich mein Büro abgeschlossen hatte und unten zu meinem Wagen kam, sahen die Wolken über mir aus wie dunkelgraue Flocken aus dem Staubsauger, und der Regen hatte angefangen, den Fußweg mit dicken Punkten zu übersäen. Ich schob Daggetts Akte auf den Beifahrersitz und fuhr rückwärts aus meiner Parklücke, bog vom Parkplatz nach rechts in die Cannon Street und dann wieder direkt in die Chapel ein. Drei Blocks weiter hielt ich an, schoß in den Supermarkt, um Milch, Diätcola, Brot, Eier und Toilettenpapier zu holen. Ich befand mich wieder einmal in Belagerungsstimmung und freute mich darauf, die Zugbrücke hochzuziehen und den Regen abzuwarten. Mit ein wenig Glück würde ich tagelang nicht rausgehen müssen.
Das Telefon klingelte, als ich meine Wohnung betrat. Ich stellte die Einkaufstüte ab und griff nach dem Hörer.
»Herrje, ich wollte es gerade aufgeben«, stöhnte Jonah. »Ich hab’s schon im Büro versucht, aber nur den Anrufbeantworter erwischt.«
»Ich habe für heute Schluß gemacht. Ich kann auch daheim arbeiten, wenn ich in Stimmung bin. Bin ich aber nicht. Hast du den Regen gesehen?«
»Regen? Ach ja, ja. Ich hab noch nicht mal aus dem Fenster geschaut, seit ich gekommen bin. Himmel, das ist ja toll!« sagte er. »Aber jetzt hör zu, ich hab ein paar von den Informationen, die du haben wolltest. Der Rest muß eben warten. Woody hatte eine vordringliche Anfrage, und ich mußte raus. Aber ich arbeite morgen, da kann ich den Rest abrufen.«
»Du arbeitest Samstag?«
»Ich vertrete Sobel. Meine gute Tat der Woche. Hast du was zu schreiben? Von Polo hab ich ’ne Spur.«
Er rasselte Billy Polos Alter, Geburtsdatum, Größe, Gewicht, Augen- und Haarfarbe, seine Decknamen und einen kurzen Überblick über seine Vorstrafen herunter. Automatisch notierte ich alles. Er hatte den Namen von Billy Polos Bewährungshelfer herausgefunden, aber der Knabe war nicht im Büro und würde nicht vor Montagnachmittag zu erreichen sein.
»Danke. Ich werde in der Zwischenzeit noch auf eigene Faust Nachforschungen anstellen«, erklärte ich. »Ich wette, ich finde ihn vor dir.« Er lachte und legte auf.
Ich räumte die Einkäufe fort und setzte mich dann an meinen Schreibtisch, zog die kleine, tragbare Smith-Corona hervor, die ich dort aufbewahrte. Ich übertrug die Daten, die Jonah mir gegeben hatte, auf Index-Karten und saß dann da und starrte sie an. Billy Polo, geb. William Polokowski, war dreißig Jahre alt, eins siebzig groß und wog siebzig Kilo. Er hatte braunes Haar, braune Augen, keine Narben. Tätowierungen oder andere »auffällige Körpermerkmale«. Sein Vorstrafenregister hörte sich an wie ein Quiz über das kalifornische Strafgesetz, mit Gefängnisstrafen für kleinere Vergehen sowie für Schwerverbrechen. Raub, Fälschung, Hehlerei, schwerer Diebstahl, Verstöße gegen das Drogengesetz. Einmal war er sogar wegen »Beschädigung eines öffentlichen Gefängnisses« angeklagt worden, einem kleineren Vergehen in diesem Staat. Wäre es im Zuge eines Ausbruchsversuchs gewesen, so hätte man ihn eines Schwerverbrechens angeklagt. Ich schätze, er war dabei erwischt worden, wie er schmutzige Worte in die Gefängniswände ritzte. Das war schon ein richtiger Profi, dieser Kerl.
Scheinbar war Billy Polo ziemlich vielseitig, wenn es darum ging, ein Gesetz zu brechen, und er hatte sich auch nie nur auf ein bestimmtes Gebiet festgelegt, um dort Erfahrungen zu sammeln. Er war sechzehnmal verhaftet worden, neunmal verurteilt, zweimal freigesprochen und fünfmal zur Bewährung ausgesetzt. Zweimal hatte man ihn gegen Kaution freigelassen, aber nichts schien sich auf sein Verhalten ausgewirkt zu haben, das in seiner Heftigkeit fast pathologisch schien. Der Mann war entschlossen, sich zu ruinieren. Seit seinem achtzehnten Lebensjahr hatte er alles in allem neun Jahre im Gefängnis verbracht. Ich hatte keine Ahnung, wie seine Jugendstrafen aussahen. Ich nahm an, daß seine Bekanntschaft mit John Daggett auf sein letztes Vergehen zurückging, einen bewaffneten Raubüberfall, für den er im kalifornischen Staatsgefängnis San Luis Obispo, einer Sicherheitseinrichtung, ungefähr neunzig Meilen nördlich von Santa Teresa, zwei Jahre und zehn Monate abgesessen hatte.
Ich holte noch einmal das Telefonbuch heraus und überprüfte die Eintragungen unter Polokowski. Nichts. Herrje, warum kann in diesem Job auch nichts einfach sein? Na schön. Im Augenblick wollte ich mir deshalb keine Sorgen machen.
Inzwischen konnte ich den Regen an den verglasten Windfang trommeln hören, der meine Wohnung mit Henry Pitts Haus verbindet. Er ist mein Vermieter, und das seit fast zwei Jahren. Bei trockenem Wetter stellt er eine alte Wiege, gefüllt mit Brotteig, in den Windfang. Wenn die Sonne scheint, wirkt der Gang wie ein Solarofen, warm und windgeschützt, und der Teig geht auf und steigt über den Rand der Wiege wie ein Federkissen. So kann er zwanzig Laibe auf einmal vorbereiten und sie dann in dem großen Industriebackofen backen, den er sich hat einbauen lassen, als er sich aus dem Geschäft zurückzog. Jetzt verkauft er frisches Brot und Teigwaren in der Nachbarschaft und bessert damit seine Rente auf. Außerdem verdient er sich noch etwas dazu, indem er Kreuzworträtsel entwirft, die er an ein paar dieser »Zeitschriften« verkauft, die man im Supermarkt bekommen kann. Henry Pitts ist einundachtzig, und jedermann weiß, daß ich halb in ihn verliebt bin.
Ich dachte kurz daran, bei ihm vorbeizuschauen, aber schon die paar Meter schienen bei dieser Nässe zuviel zu sein. Ich setzte Teewasser auf, griff mir ein Buch und streckte mich auf dem Sofa aus, eine Steppdecke über mir. So verbrachte ich den Rest des Tages.
Im Laufe der Nacht nahm der Regen noch zu, und ich wachte zweimal auf und hörte ihn an die Scheiben peitschen. Es hörte sich an, als würde jemand mit einem Schlauch die Wände abspritzen. Hin und wieder grollte der Donner in der Ferne, blaues Licht blitzte in den Fenstern, Äste tauchten kurz auf, ehe das Zimmer wieder schwarz wurde. Es war klar, daß ich meinen Lauf um sechs Uhr streichen mußte, ein erzwungener Tag der Ruhe. Also vergrub ich mich wie ein kleines Tier noch tiefer in meine Decke, entzückt von der Aussicht, lange zu schlafen.
Um acht Uhr wachte ich auf, duschte, zog mich an und aß ein weichgekochtes Ei auf Toast mit Unmengen von Lawry’s Seasoned Salt. Ich werde nicht auf Salz verzichten. Mir ist es egal, was die Leute sagen.
Jonah rief an, als ich meinen Teller abwusch. »Hallo, rat mal, was passiert ist? Dein Freund Daggett ist aufgetaucht.«
Ich klemmte mir den Hörer zwischen Kopf und Schulter, drehte das Wasser aus und trocknete mir die Hände ab. »Was ist passiert? Ist er aufgegriffen worden?«
»Mehr oder weniger. Ein Penner hat ihn heute morgen mit dem Gesicht nach unten in der Brandung liegen gesehen, verfangen in einem Fischernetz. Ein Boot ist ungefähr zweihundert Meter weiter an Land getrieben. Wir sind ziemlich sicher, daß das zusammenpaßt.«
»Ist er gestern abend gestorben?«
»Sieht so aus. Der Arzt schätzt, er ist zwischen Mitternacht und fünf Uhr früh ins Wasser gegangen. Aber wir haben noch keinen Bericht über die Todesursache. Nach der Autopsie wissen wir sicher mehr.«
»Woher weißt du, daß es Daggett war?«
»Fingerabdrücke. Er lag als xy im Leichenschauhaus, bis wir den Computer gefüttert haben. Willst du ihn dir ansehen?«
»Ich komme sofort. Was ist mit den Verwandten? Sind Sie schon benachrichtigt worden?«
»Ja, ein Streifenbeamter ist hingegangen, nachdem wir ihn identifiziert hatten. Kennst du die Familie?«
»Nicht gut, aber ich hab sie kennengelernt. Bezieh dich nicht auf mich, aber ich schätze, du wirst rausfinden, daß er Bigamist war. Da ist noch eine Frau unten in L. A., die auch behauptet, mit ihm verheiratet zu sein.«
»Reizend. Am besten kommst du kurz zu uns, wenn du St. Terrys verläßt«, sagte er und hängte ein.
Die Polizei von Santa Teresa hat kein eigenes Leichenschauhaus. Es gibt einen Sheriff, der gleichzeitig Leichenbeschauer ist, in diesem Staat eine gewählte Position, aber die eigentliche forensische Arbeit wird auf verschiedene Pathologen in diesem Gebiet verteilt. Die notwendigen Räumlichkeiten werden vom Santa Teresa Hospital (für gewöhnlich kurz St. Terrys genannt) und dem früheren County General Hospital zur Verfügung gestellt. Daggett lag offensichtlich im St. Terrys, und dahin fuhr ich, nachdem ich Regenmantel, Schirm und Handtasche zusammengesucht hatte.
Der Besucherparkplatz am Krankenhaus war halb leer. Es war Samstag, und die Ärzte würden ihre Runden wahrscheinlich erst später machen. Der Himmel war dick mit Wolken verhangen, und hoch oben konnte ich sehen, wie der Wind durch sie hindurchpeitschte und weißen Nebel durch das Grau trieb. Das Pflaster war mit kleinen Zweigen übersät, Blätter klebten flach am Boden. Überall hatten sich Pfützen gebildet, Regentropfen versahen sie mit kleinen Pockennarben. Ich parkte so dicht am Hintereingang, wie ich nur konnte, schloß dann meinen Wagen ab und rannte los.
»Kinsey!«
Ich drehte mich um, als ich den Schutz des Gebäudes erreichte. Barbara Daggett eilte von der anderen Seite des Platzes zu mir herüber, den Schirm gegen den Regen geneigt. Sie trug einen Regenmantel und Stiefel, das weißblonde Haar lag wie ein Heiligenschein um ihr Gesicht. Ich hielt die Tür für sie auf, und wir betraten das Foyer.
»Haben Sie das von meinem Vater gehört?«
»Deshalb bin ich ja hier. Wissen Sie, wie es passiert ist?«
»Nicht direkt. Onkel Eugene hat mich um Viertel nach acht angerufen. Ich schätze, die haben versucht, Mutter zu benachrichtigen, und er hat sich eingeschaltet. Der Arzt hat sie so mit Medikamenten vollgestopft, daß es überhaupt keinen Sinn hat, es ihr schon zu erzählen. Er macht sich Sorgen, wie sie es aufnehmen wird, so instabil, wie sie ist.«
»Kommt Ihr Onkel auch?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich sagte, ich würde das erledigen. Es besteht kein Zweifel daran, daß es Daddy ist, aber jemand muß unterschreiben, damit sie den Leichnam zur Bestattung freigeben können. Natürlich wird vorher noch die Autopsie gemacht. Wie haben Sie es herausgefunden?«
»Durch einen Polizisten, den ich kenne. Ich hatte ihm erzählt, daß ich versuchen wollte, eine Spur von Ihrem Vater zu bekommen, und deshalb hat er mich angerufen, als man ihn anhand der Fingerabdrücke identifiziert hatte. Ist es Ihnen gestern noch gelungen, ihn zu finden?«
»Nein, aber offensichtlich jemand anderem.« Sie schloß ihren Schirm und schüttelte ihn aus. Dann warf sie mir einen Blick zu. »Offen gesagt, ich vermute, daß ihn jemand umgebracht hat.«
»Lassen Sie uns keine voreiligen Schlüsse ziehen«, sagte ich, obwohl ich ihr insgeheim zustimmte.
Wir traten durch die innere Tür und auf einen Flur hinaus. Hier war die Luft wärmer und roch nach Farbe.
»Ich möchte, daß Sie die Sache für mich untersuchen, auf jeden Fall«, sagte sie.
»Hören Sie, dafür ist die Polizei zuständig. Ich habe nicht die Mittel dazu. Warum warten Sie nicht erst einmal ab, was sie dazu zu sagen haben?«
Sie musterte mich kurz und ging dann weiter. »Denen ist es doch egal, was mit ihm passiert ist. Warum sollte es sie kümmern? Er war ein Trunkenbold.«
»Ach, hören Sie auf. Die Polizisten müssen sich darum kümmern. Wenn es Mord war, müssen sie ihre Arbeit tun, und das werden sie gut machen.«
Als wir den Autopsieraum erreichten, klopfte ich, und ein junger, schwarzer Angestellter, in Chirurgengrün gekleidet, kam heraus. Sein Namensschild wies ihn als Hall Ingraham aus. Er war schlank, seine Haut hatte die Farbe von Pekanholz, das auf Hochglanz poliert ist. Sein Haar war kurz geschnitten und verlieh ihm das Aussehen einer Skulptur, das längliche Gesicht wirkte fast stilisiert in seiner Perfektion.
»Das ist Barbara Daggett«, stellte ich vor.
Er schaute in ihre Richtung, ohne ihrem Blick zu begegnen. »Sie können gleich hier draußen warten«, sagte er. Er ging zwei Türen weiter, und wir folgten ihm, warteten höflich, als er einen Monitorraum aufschloß und uns hineinführte.
»Es dauert nur eine Minute«, sagte er.
Er verschwand, und wir nahmen Platz. Das Zimmer war klein, vielleicht drei auf drei Meter, mit vier aus blauem Plastik gegossenen Stühlen, die unten miteinander verbunden waren, einem niedrigen Holztisch, auf dem alte Zeitschriften lagen, und einem Bildschirm, der schräg oben in einer Ecke des Zimmers befestigt war. Ich sah, wie ihr Blick hinaufwanderte.
»Sie zeigen ihn dort oben«, erklärte ich.
Sie nahm eine Zeitschrift und blätterte zerstreut darin. »Sie haben mir nie erzählt, warum er Sie eigentlich angeheuert hat«, meinte sie. Eine Anzeige hatte scheinbar ihre Aufmerksamkeit erregt, und sie betrachtete sie jetzt, als wäre meine Antwort nur nebensächlich.
Mir fiel kein Grund ein, warum ich es ihr jetzt nicht erzählen sollte, aber ich merkte, daß ich mir Beschränkungen auferlegte, eine alte Angewohnheit. Ich halte gern etwas zurück. Wenn man eine Information erst mal gegeben hat, kann man sie nicht zurücknehmen. Also ist es besser, Vorsicht zu üben, ehe man den Mund aufmacht. »Er wollte, daß ich ein Kind namens Tony Gahan für ihn finde«, berichtete ich.
Dieser bemerkenswerte zweifarbige Blick wurde auf mich gerichtet, und ich ertappte mich bei dem Versuch zu entscheiden, welche Augenfarbe ich vorzog. Das Grün war ungewöhnlicher, aber das Blau war klar und kräftig. Die beiden zusammen ergaben einen Gegensatz wie eine Ampel an einer Straßenecke, auf der gleichzeitig Rot und Grün aufblitzen.
»Kennen Sie ihn?« fragte ich.
»Seine Eltern und eine jüngere Schwester waren es, die bei dem Unfall ums Leben gekommen sind, zusammen mit zwei anderen Personen, die mit ihnen im Wagen saßen. Was hat Daddy von ihm gewollt?«
»Er hat erzählt, Tony Gahan hätte ihm einmal geholfen, als er auf der Flucht vor den Cops war. Er wollte sich bei ihm bedanken.«
Ihr Blick war ungläubig. »Aber das ist doch albern!«
»Das dachte ich auch«, stimmte ich zu.
Sie hätte mich vielleicht weiter nach Informationen ausgequetscht, aber der Bildschirm flimmerte in diesem Augenblick weiß auf und schaltete dann auf eine Großaufnahme von John Daggett. Er lag auf einer Bahre, ein Tuch war säuberlich bis zu seinem Hals hinaufgezogen. Er hatte den leeren Plastikausdruck, den der Tod manchmal mit sich bringt; als wäre das menschliche Gesicht nicht mehr als ein leeres Blatt, auf dem die Linien von Gefühlen und Erfahrungen erst markiert und dann wieder ausgelöscht worden sind. Er wirkte eher wie zwanzig als wie fünfundfünfzig, mit einem Stoppelbart und unordentlichen Haaren. Sein Gesicht wies keine Spuren von Gewalt auf.
Barbara starrte ihn an, ihr Mund öffnete sich, ihr Gesicht lief rosa an. Tränen traten ihr in die Augen, blieben dort hängen, gefangen im Brunnen ihres Unterlids. Ich wandte mich von ihr ab, wollte nicht aufdringlicher sein, als ich mußte. Die Stimme des Angestellten erreichte uns über die Gegensprechanlage.
»Lassen Sie mich wissen, wenn Sie soweit sind.«
Barbara wandte sich abrupt ab.
»Danke, es ist schon genug«, rief ich. Der Monitor wurde dunkel ...
Kurz darauf klopfte es an der Tür, und er tauchte wieder auf, mit einem verschlossenen großen Umschlag und einem Klemmbrett in der Hand.
»Wir müssen wissen, welche Anordnungen Sie zu treffen wünschen.« Er sprach in diesem Ton einstudierter Neutralität, den ich schon oft bei denen gehört habe, die mit Hinterbliebenen zu tun haben. Die Wirkung ist unpersönlich und tröstlich, ermöglicht es, Geschäftliches zu regeln, ohne von störenden Emotionen gehindert zu werden. Er hätte sich keine Sorgen zu machen brauchen. Barbara Daggett war Geschäftsfrau, dazu erzogen, die ehrfurchtgebietende Haltung zu bewahren, die Männer so aus der Fassung bringt, weil sie an weibliche Unterwürfigkeit gewöhnt sind. Ihr Verhalten war jetzt glatt, ihr Ton so gleichgültig wie seiner.
»Ich habe mit Wynington-Blake gesprochen«, erklärte sie und bezog sich damit auf eines der Bestattungsinstitute in der Stadt. »Wenn Sie dort Bescheid geben, nachdem die Autopsie abgeschlossen ist, werden sie sich um alles kümmern. Ist dieses Formular für mich?«
Er nickte und hielt ihr das Brett mit dem daran befestigten Stift entgegen. »Eine Empfangsbestätigung seiner persönlichen Habe«, erklärte er.
Sie kritzelte eine Unterschrift so schwungvoll, als würde sie ein Autogramm geben. »Wann haben Sie die Ergebnisse der Autopsie vorliegen?«
Er reichte ihr den Umschlag, der scheinbar Daggetts persönliche Habe enthielt. »Wahrscheinlich am späten Nachmittag.«
»Wer macht das?« erkundigte ich mich.
»Dr. Yee. Er hat sie für halb drei angesetzt.«
Barbara Daggett warf mir einen Blick zu. »Sie ist Privatdetektivin. Ich wünsche, daß ihr alle Informationen zugänglich gemacht werden. Muß ich dafür eine gesonderte Vollmacht ausstellen?«
»Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt es da etwas, aber für mich ist das neu. Ich kann es überprüfen und Sie später anrufen, wenn Sie wünschen.«
Sie klemmte ihre Visitenkarte auf das Brett, als sie es ihm zurückgab. »Tun Sie das.«
Zum ersten Mal begegneten sich ihre Blicke, und ich konnte sehen, wie er die unterschiedlichen Farben ihrer Augen wahrnahm. Sie rauschte an ihm vorbei aus dem Zimmer. Er starrte ihr nach. Die Tür fiel zu.
Ich streckte die Hand aus. »Ich bin Kinsey Millhone, Mr. Ingraham.«
Er lächelte zum ersten Mal. »Ah ja. Ich habe durch Kelly Borden von Ihnen gehört. Freut mich, Sie kennenzulernen.«
Kelly Borden arbeitete ebenfalls im Leichenschauhaus, wo ich bei der Untersuchung eines Mordes im August zu tun gehabt hatte.
»Angenehm. Was können Sie mir in diesem Fall erzählen?«
»Ich kann Ihnen da nicht viel sagen. Sie haben ihn gegen sieben gebracht, als ich gerade zur Arbeit kam.«
»Haben Sie eine Ahnung, wie lange er da schon tot war?«
»Ich weiß es nicht sicher, aber lange kann es noch nicht gewesen sein. Der Körper war nicht aufgedunsen, und es hatte auch noch keine Verwesung eingesetzt. Nach allem, was ich an Ertrunkenen gesehen habe, würde ich sagen, er ist spät letzte Nacht ins Wasser gefallen. Aber berufen Sie sich dabei nicht auf mich. Die Armbanduhr, die er trug, war um 2 Uhr 37 stehengeblieben, aber die kann auch kaputt gewesen sein. Es ist eine billige Uhr, und sie sieht recht mitgenommen aus. Ist bei seinen anderen Sachen. Himmel, was weiß ich? Ich bin bloß ein kleiner Helfer, der kleinste der Kleinen. Dr. Yee haßt es, wenn wir so mit den Leuten reden.«
»Glauben Sie mir, ich werde nichts sagen. Ich frage nur für mich selbst. Was ist mit seiner Kleidung? Wie war er angezogen?«
»Jackett, Hose, Hemd.«
»Schuhe und Strümpfe?«
»Na ja, Schuhe schon. Aber Socken hatte er keine an, und er hatte auch keine Brieftasche oder so bei sich.«
»Irgendwelche Anzeichen einer Verletzung?«
»Keine, die ich gesehen hätte.«
Mir fiel nichts ein, was ich noch hätte fragen können. So bedankte ich mich bei ihm und erklärte, ich würde in Kontakt bleiben.
Dann ging ich hinaus, um nach Barbara Daggett zu suchen. Wenn ich für sie arbeiten sollte, dann mußten wir das Geschäftliche regeln.