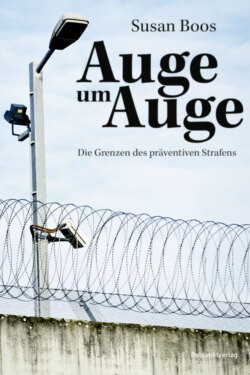Читать книгу Auge um Auge - Susan Boos - Страница 9
4Die Vermessung der Gefährlichkeit
ОглавлениеFrank Urbaniok, jung, engagiert, unbelastet, ein drahtiger Mann mit schmalem Gesicht und Ring im Ohr. Er hat ein Instrument entwickelt, das die Gefährlichkeit von Menschen erfassen soll, das »forensische operationalisierte Therapie-Risiko-Evaluations-System«, kurz Fotres.
Wir treffen uns im Psychiatrisch-Psychologischen Dienst des Kantons Zürich, den er zu der Zeit noch leitet. Der Dienst befindet sich in einem nüchternen Gebäude, das zwischen anderen nüchternen Bürogebäuden im Westen der Stadt Zürich steht, gleich neben dem Bahnhof Altstetten. Es ist heiß. Die Jalousien sind geschlossen.
Zuerst will er wissen, wie ich auf das Thema gekommen bin. Das hat unter anderem mit Ralf Scherrer zu tun, dessen Fall ich seit Jahren verfolge. Ralf Scherrer ist ein Pseudonym. Ein Mann, Mitte fünfzig, pädophil. 2005 wird er verhaftet. Das Gericht verurteilt ihn zu 35 Monaten Gefängnis. Die Strafe wird aber »zugunsten einer Maßnahme aufgeschoben«, wie das in Juristensprache heißt. Er soll also therapiert werden.
Scherrer opponiert ständig. Wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, schreibt er Beschwerden. Er fühlt sich oft ungerecht behandelt und wird von einer Anstalt in die andere verlegt. Seine Aufsässigkeit führt dazu, dass die Maßnahme immer wieder verlängert wird. Am Ende ist er zwölf Jahre eingesperrt für ein Delikt, für das er vier Jahre hätte sitzen müssen. Eine richtige Therapie hat er die ganze Zeit nicht erhalten. Seine Renitenz wird ihm als Gefährlichkeit ausgelegt.
Urbaniok hört zu und antwortet, er kenne den Fall nicht, könne sich deshalb nicht dazu äußern. »Ich muss Ihnen ganz klar sagen, ich bin konsequent für die Verhinderung von Straftaten, ich bin auch für Repression. Damit habe ich keine Mühe. Es gibt allerdings ein großes Aber. Ich finde, man muss jeden Tag, den jemand da drin sitzt, sachlich rechtfertigen können. Das muss unser Maßstab sein. Das heißt vor allem qualitativ gute Therapien, die mit ausreichender Intensität gezielt und zügig durchgeführt werden. Doch schlägt dann oft der Alltag zu. Man hat im Vollzug Zeit, verzettelt sich in irgendwelchen Dingen. Das ist weder fair noch rechtsstaatlich in Ordnung. Und das bedrückt mich. Ich habe zu viele Fälle gesehen, zu denen man einfach sagen muss, das geht so nicht. In Düsseldorf habe ich einen Fall begutachtet, der Mann war siebzehn Jahre alt, als er ins Gefängnis kam. Er saß 23 Jahre, es gab über ihn ein Dutzend Gutachten und unzählige psychiatrische Stellungnahmen. Irgendwann hat jeder Gutachter nur noch vom anderen abgeschrieben, und keiner hat mehr hingeguckt. Das hatte eine Eigendynamik angenommen, da bekommt man diese kafkaesken und orwellschen Fantasien.«
Der Mann hatte die Diagnose Sadismus und Paranoide Persönlichkeitsstörung. Die sei falsch, sagt Urbaniok. Eine solche Diagnose werde man aber nie mehr los. Er schrieb ihm ein positives Gutachten. Basierend auf diesem Gutachten, entließ ihn dann die Richterin. Es sei nicht selbstverständlich, dass eine Richterin diesen Mut aufbringe, sagt Urbaniok. Der Mann lebt nun seit mehr als fünf Jahren in Freiheit und ist nicht rückfällig geworden.
»Am Schluss war er sieben Jahre ohne Therapie hochgesichert untergebracht. Wenn sich die Angst, es handle sich bei einer Person um einen Sadisten, einmal in den Hinterköpfen festgesetzt hat, ist das wie ein Perpetuum mobile. Benimmt sich der Mann unauffällig, belegt das, wie kontrolliert er ist; gebärdet er sich auffällig, belegt es, dass er ein Problem hat.« Das gehe überhaupt nicht, sagt Urbaniok. Das sei eine gefährliche Fehlentwicklung.
Da sitzt nicht der Urbaniok, den ich erwartet hatte, der Hardliner, der ohne Skrupel alle wegsperrt. Anwält:innen, Menschenrechtsorganisationen und auch Psychiater:innen kritisieren ihn für Fotres. Das Prognoseinstrument täusche eine Exaktheit vor, die unrealistisch sei. Es sei ein rechtsstaatlich fragwürdiges Instrument. »Der Delinquent wird nicht für seine Tat, sondern für seine Persönlichkeit weggesperrt«, kritisiert zum Beispiel der bekannte Zürcher Psychiater Mario Gmür. Was stimmt? Wie kam das Instrument zustande? Wie funktioniert es?
Frank Urbaniok berichtet, wie er in Zürich angefangen hat. Der Mord am Zollikerberg lag zwei Jahre zurück. Das Vollzugssystem sei paralysiert gewesen, sagt er. Er habe am Anfang viel Aufräumarbeit leisten müssen. Es habe unzureichende oder gar keine Dokumentationen gegeben. Jeder habe ein bisschen gemacht, was er für richtig hielt. »Und dann war da natürlich der Punkt ›Risikobeurteilung‹. Ich wusste, ich habe einen Dienst mit vielen Therapeuten, die mit gefährlichen Leuten arbeiten. Die ganz praktische Herausforderung war: Wie mache ich Qualitätsmanagement?« So entstand Fotres, gedacht als Instrument der Qualitätsmessung.
Urbaniok erzählt von einem Vergewaltiger. Er arbeitete dessen Akten durch und stellte fest, dass in der Therapie über vieles geredet worden sei, sehr oft über die Mutter, aber in zwei Jahren nicht ein einziges Mal über das Delikt. Urbaniok verlangt, dass sich Täter mit ihren Taten beschäftigen. Dazu brauche es eine deliktorientierte Therapie, wie er es nennt.
Ihm schwebte eine Standardisierung vor – damit sich die Therapeut:innen überhaupt austauschen können und alle dasselbe meinen, wenn sie über den Verlauf einer Therapie reden. Er arbeitete zuerst mit bereits bestehenden Checklisten, wie zum Beispiel der Dittmann-Liste. Doch er fand sie unbefriedigend. Als Beispiel nennt er die »hochspezifische Täter-Opfer-Beziehung«. Ein Mann bringt eine Frau um. Falls sich die beiden gut gekannt haben, wirkt sich das gemäß Dittmann-Liste positiv auf die Prognose aus. Man geht davon aus, dass dieser Täter ein kleines Risiko hat, erneut zu töten. »Das kann sein, muss aber nicht«, sagt Urbaniok. »Nehmen wir einmal an, Sie haben einen wirklich narzisstisch gestörten Menschen, der eine Beziehung eingeht. Solange die Frau ihn bewundert, ist alles gut. Sobald sie das nicht mehr tut, schlägt er die Frau tot. Da liegt eben eine hochspezifische Täter-Opfer-Beziehung vor, doch sobald der Mann in die nächste Beziehung geht, wird er das Gleiche tun, wenn die Problematik nicht verändert ist. Das zeigt ein bisschen das Problem. Die hochspezifische Täter-Opfer-Beziehung ist nur dann prognostisch günstig, wenn die Tat in einer totalen Ausnahmesituation stattfindet und persönlichkeitsfremd ist.« »Persönlichkeitsfremd« ist auch ein forensischer Begriff. Wird eine Frau von ihrem Mann ständig erniedrigt und gequält, doch sie wehrt sich über Jahre kaum, bis sie ihn eines Tages brutal erschlägt, gehört diese Gewalteruption nicht zu ihrer Persönlichkeit. Bei ihr sähe die Prognose wie die Therapie anders aus als bei einer Person, die fortwährend gewalttätig ist.
Dass Fotres auch als Prognoseinstrument benutzt werden kann, war Urbaniok am Anfang nicht bewusst. Er begann damit, lauter Einzelfälle auseinanderzunehmen, analysierte Fälle über Fälle und suchte nach Regeln. Es sei eine Rund-um-die-Uhr-Beschäftigung gewesen, sagt er rückblickend. Zuerst habe er mit einer Kriterienliste gearbeitet, die zu einer Excel-Tabelle anwuchs. Die Liste ergänzt er kontinuierlich. »Wenn immer ich Fälle sehe, die nicht genau mit den bestehenden Risikoeigenschaften abgebildet werden können, fülle ich die Lücke durch das, was ich neu sehe«, sagt er. Die aktuelle Version von Fotres enthält 102 Risikoeigenschaften.
Nur, wie funktioniert Fotres?
»Als erstes wählen Sie ein Zieldelikt aus«, sagt Urbaniok.
»Ein Zieldelikt? Ist das ein Delikt, das ein Täter wieder beginge, wenn er erneut rückfällig würde?«
»Genau. Rückfallrisiken schweben nicht einfach frei in der Luft. Man muss sie zieldeliktspezifisch analysieren. Fotres macht das.« Urbaniok erklärt die Logik. Da ist zum Beispiel ein Täter, der schon diverse Einbrüche begangen hat, durch Exhibitionismus aufgefallen ist und immer wieder seine Partnerin misshandelt. Als erstes stellt sich die Frage: Was ist das Zieldelikt? Die Einbrüche, der Exhibitionismus oder die häusliche Gewalt? In diesem Fall, sagt Urbaniok, würde er drei verschiedene Fotres-Bewertungen machen, für jedes Delikt eine.
Für die häusliche Gewalt bietet das Computerprogramm danach verschiedene Risikoeigenschaften an. Eine »sensitive Persönlichkeit« – jemand wittert überall Verschwörungen. Eine »querulatorische Persönlichkeit« sieht überall Ungerechtigkeit. Bei »Dissozialität« will eine Person immer im Mittelpunkt stehen, wirkt dadurch anstrengend. So geht es weiter über »Fetischismus« bis hin zur »kaltblütigen Persönlichkeit«.
Die Gutachter:innen können so viele der Risikoeigenschaften anklicken, wie sie für richtig halten. Seiner Erfahrung nach sollten sie sich auf zwei bis fünf Risikoeigenschaften beschränke, sagt Urbaniok. Würden zu viele Risikoeigenschaften diagnostiziert, sei das ein starkes Indiz, dass die Gutachter:innen das Delikt noch nicht verstanden hätten. »Weil sie keine klare Vorstellung haben, ergänzen sie mit dieser und jener Eigenschaft, die es vielleicht auch noch sein könnte.«
Urbaniok spricht oft vom »Deliktmechanismus«. »Ich habe auf der einen Seite eine Person mit Persönlichkeitseigenschaften und auf der anderen Seite eine Tat mit Tatmerkmalen. Dabei gilt grundsätzlich, dass das, was ein Mensch tut, irgendetwas mit seinen Gedanken, seinen Gefühlen und seinen Wahrnehmungen zu tun hat. Deswegen muss es eine Verbindung zwischen den Persönlichkeitseigenschaften und der Art der Tatbegehung geben. Um diese Verbindung erkennen zu können, muss ich herausfinden, welches die risikorelevanten Persönlichkeitsmerkmale sind. Welche Emotionen, Gedanken, Wahrnehmungen haben zu einer bestimmten Tat geführt? Mit den richtigen Risikoeigenschaften finde ich den Schlüssel zum Deliktmechanismus.«
»Wie konkret?«
»Indem ich mit der Person spreche. Meistens kenne ich zudem die Akten genau. Und die ›Tatmusterinformation‹.«
»Was ist denn das?«
»Die ergibt sich aus dem Tatablauf. Es ist ein Unterschied, ob jemand eine Waffe mit an den Tatort bringt oder erst dort einen Gegenstand ergreift und damit zuschlägt. Es ist ein bisschen wie Schachspielen. Man muss sich fragen: Warum hat jemand eine Tat so und nicht anders begangen? Da gibt es immer mehrere Möglichkeiten.«
Wir kommen auf den Fall Rupperswil zu sprechen, eines der grausamsten Verbrechen überhaupt. Einige Wochen vor unserem Treffen stand der Täter vor Gericht. Thomas N., Anfang dreißig, gutaussehend, wie die Medien immer wieder schrieben. Die Tat ist so brutal, dass man die Einzelheiten nicht erzählen mag. Der Mann brachte nach Weihnachten 2015 eine Familie um. Er überredete die Mutter, ihn ins Haus zu lassen, indem er behauptete, er sei Schulpsychologe. Er wies eine gefälschte Visitenkarte vor, die er eigens hatte anfertigen lassen. Vier Menschen waren im Haus, die Mutter, ihre beiden Söhne und die Freundin des älteren Sohns. Thomas N. verbrachte Stunden im Haus. Er schickte die Mutter sogar raus, um Geld abzuheben. Sie tat es, in der Hoffnung, der Unbekannte würde dann von ihnen ablassen. Sie getraute sich nicht, Hilfe zu holen. Am Ende missbrauchte Thomas N. den jüngeren Sohn, zeichnete es auf seinem Handy auf. Danach schlitzte er allen vier Menschen die Kehle auf und zündete das Haus an.
Als Thomas N. vor Gericht stand, saß ich im Saal. Der Medienrummel war enorm. Alle warteten auf eine Erklärung für die unfassbare Tat. Daraus wurde nichts. Der Täter stammt aus behüteten Verhältnissen, liebte seine Hunde, trainierte die Jungen des lokalen Fussballklubs. Er war der normale Schweizer von nebenan. Nie auffällig, mal abgesehen davon, dass er immer noch bei seiner Mutter wohnte. Als er sein Studium abgebrochen hatte, schaffte er es nicht, dies seiner Mutter zu erzählen. Er führte ein Doppelleben, verbrachte viel Zeit im Internet, konsumierte Kinderpornografie und entwickelte Gewaltfantasien. Mehr war vor Gericht nicht zu erfahren. Er selbst wirkte kalt oder niedergeschlagen. Das ließ sich so genau nicht auseinanderhalten. Auch versuchte er mehrmals, sich zu entschuldigen für das, was er den Opfern und deren Angehörigen angetan hatte. Was nicht funktionieren konnte. Für diese Morde gibt es keine Entschuldigung. Aber auch das sagte er vor Gericht, dass er das wisse und verstehe und dass er seine Tat durch nichts wiedergutmachen könne. Man ging aus dem Gerichtssaal und hatte überhaupt nichts kapiert. Ein netter junger Mann wird aus dem Nichts zum Monster.
Ist er einfach böse? Psychisch krank? Kann man so jemanden therapieren?
Urbaniok kommt in Fahrt. Das Rupperswiler Beispiel illustriere, weshalb man in der Forensik mit Diagnosen nicht weiterkomme. Im Fall Thomas N. haben zwei Psychiater unabhängig voneinander ein Gutachten verfasst. Beide haben Diagnosen gestellt, die sich am ICD-10 orientieren. ICD ist die Abkürzung von »International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems«, ein Verzeichnis, das alle Krankheiten auflistet und definiert. Es ist die zehnte Version, bald wird die elfte publiziert, das wird dann die ICD-11 sein. Die Weltgesundheitsorganisation veröffentlicht diese Liste.
Beide Psychiater, die Thomas N. begutachteten, finden eine Persönlichkeitsstörung. Der eine diagnostiziert eine »zwanghafte Persönlichkeitsstörung«, der andere eine »narzisstische Persönlichkeitsstörung« – was zwei vollkommen unterschiedliche Diagnosen sind. Einem zwanghaften Menschen sind Perfektionismus und ständige Kontrolle wichtig. Er fürchtet sich krankhaft davor, Fehler zu machen. Dem Narzisst fehlt die Empathie. Er überschätzt sich ständig, will, dass alle ihn bewundern, und reagiert stark gekränkt, wenn die Bewunderung ausbleibt. Die beiden Krankheiten haben in der Logik des IDC-10 so viel gemeinsam wie Diabetes mit Bluthochdruck. In einem Punkt sind sich die beiden Psychiater jedoch einig: Thomas N. leide an einer »Störung der Sexualpräferenz« und sei »kernpädophil«.
Beide Gutachter hätten den Deliktmechanismus überhaupt nicht erklären können, sagt Urbaniok. Trotzdem kämen sie zu dem Schluss, der Mann sei therapierbar. »Wenn sie sagen würden, die narzisstische Persönlichkeitsstörung – lassen wir mal dahingestellt, ob er eine hat oder nicht – sei der Grund für die Tat, dann hätten wir jede Woche ein solches Delikt, weil es viele Menschen mit narzisstischen Störungen gibt. Die ›sexuelle Präferenz‹ erklärt den Deliktmechanismus auch nicht. Pädophile sind zu 99 Prozent nicht gewalttätig. Das finde ich das Gefährliche an diesen Diagnosen. Es gibt in ihnen eine Scheinplausibilität. In der Bevölkerung vermischt sich das dann. ›Da ist dieser Pädophile, der irgendwas Schlimmes gemacht hat, und das ist gefährlich.‹ Das wäre so, als würden sie angesichts eines heterosexuellen Mörders sagen: Die Heterosexuellen bringen dauernd jemanden um. Für einen Pädophilen ist diese Gewalt aber etwas total Untypisches, wirklich total untypisch.« Die Gutachten hätten überhaupt nichts erklärt. Also müsse man auch offen dazu stehen.
Urbanioks These lautet: Wenn der Deliktmechanismus nicht erklärt werden kann, lässt sich nichts zum künftigen Risiko sagen. Dann kann man auch nicht prognostizieren, ob jemand therapierbar sei. Man weiß ja gar nicht, was man therapieren soll, damit das Risiko sinkt. Aus Sicht von Urbaniok ist daher die Einschätzung zur Therapierbarkeit des Täters in beiden Gutachten falsch. »Es ist, wie wenn ein Spezialist bei Thomas N. eine Schilddrüsenerkrankung diagnostizieren würde. Nun schließt der Spezialist daraus, dass Thomas N. therapiefähig ist, weil man Schilddrüsenerkrankungen grundsätzlich therapieren kann. Nur hat die Schilddrüsenerkrankung nichts mit dem Delikt zu tun.«
Seine Kritik hatte Urbaniok öffentlich gemacht. Man empfand das als arroganten Versuch, das Gericht zu beeinflussen und die Gutachter zu demontieren.
Fotres ist wie ein Entscheidungsbaum. Aus Sicht von Urbaniok hilft es den Gutachterinnen und Therapeuten, durch alle relevanten Fragen zu navigieren.
»Die Fotres-Auswertung wird dem Gutachten einfach beigelegt. Jeder Anwalt kann das nachvollziehen und nachfragen, wenn er mit einer Wertung nicht einverstanden ist. Wenn dann eine Diskussion entsteht, finde ich das richtig. Die muss kommen. Ein Gutachter muss begründen können, was er macht.«
Sein Ziel sei Transparenz. Dem Vorwurf, er habe intransparente Algorithmen ins Programm eingebaut, entgegnet er sachlich wie ein Informatiker: »Es gibt in Fotres keine Algorithmen.« Man könne Fotres auch ohne Computer anwenden. Manche würden nur mit dem Handbuch arbeiten.
Die einzelnen Eigenschaften werden allerdings gewichtet. Das System bietet eine Skala von 0 bis 4 an. 0 steht für »nicht vorhanden«, 2 für »moderat«, 4 für »sehr hoch«. Urbaniok erklärt: »Nehmen wir an, der Gutachter hat die Risikoeigenschaft ›Dominanzproblematik‹ gewählt – das sind Personen, die versuchen, andere Menschen und Situationen zu kontrollieren und die Bedürfnisse anderer Menschen ignorieren. Das Fotres-Programm fragt nun die Anwender:innen: Wie ausgeprägt ist bei diesem Täter die Dominanzproblematik? Ist sie gering, setzt der Gutachter eine 1. Danach fragt Fotres: Wie relevant ist diese Eigenschaft für das Risiko? Dem Gutachter steht erneut die Skala von 1 bis 4 zur Verfügung.«
»Kommen dabei nicht unterschiedliche Resultate raus? Je nachdem, wie ein Gutachter gewichtet?«
»Ja, das ist richtig.«
»Das Ergebnis hängt also vom Gutachter ab?«
»Da kann es Unterschiede geben. Die Wertung ist aber transparent. Und weil die Bewertung bis in die einzelnen, klar definierten Kriterien nachvollzogen werden kann, kann man sie diskutieren und korrigieren.«
Das ist Urbanioks Credo. Deshalb hält er überhaupt nichts von Gutachtern, die mit eigenen Begrifflichkeiten ohne Kriterienkatalog aus dem Bauch heraus arbeiten: »Das ist sehr fehleranfällig, häufig intransparent und kann nur schwer überprüft werden.«
Am Ende dieses Prozederes gibt Fotres eine Zahl zwischen 1 und 4 aus. Auch hier gilt: 1 steht für ein »geringes« Rückfallrisiko 4 für ein »sehr hohes«. Übersetzt bedeutet das, bei 1 ist das Risiko, dass eine Person wieder ein vergleichbares Delikt begeht, verglichen mit der Normalbevölkerung, sehr klein. Bei einer 4 sieht es ganz anders aus; da sei das Risiko sehr hoch, sofern die Person keine entsprechende »risikosenkende Therapie« bekomme, wie Urbaniok sagt.
Welchen Einfluss hatte der Fall Hauert auf sein Modell?
»Vor dem Fall Hauert sind Verwahrte nach zwei bis drei Jahren entlassen worden. Da hatten wir satte Rückfallraten, sehr satte. Das ist das eine Extrem gewesen. Die Rückfälligkeit allein ist aber noch kein Indiz dafür, ob jemand gefährlich ist oder nicht. Ich sage das bewusst pointiert. Die Welt zerfällt ja nicht in Menschen mit Nullrisiko und Menschen mit hundert Prozent Risiko. Die Leute haben ein Risiko von dreißig oder sechzig Prozent.«
»Wie viel tolerieren Sie?«
»Nehmen wir an, Sie haben zwei Personen mit einem Fünfzig-Prozent-Risiko, islamistischer Selbstmordattentäter zu werden. Wenn Sie beide entlassen, wird genau einer Selbstmordattentäter, der andere nicht. Aber beide haben dasselbe Risiko. Ich mache es noch ein bisschen gemeiner: Ich nehme nicht zwei, ich nehme zehn Personen, alle haben ein Fünfzig-Prozent-Risiko. Fünf machen die Tat, fünf machen sie nicht. Nehmen wir an, Sie haben eine Zeitmaschine, mit der Sie zurückreisen können. Sie merken sich nun, welche fünf die Tat begangen haben. Diese fünf bleiben nun eingesperrt. Dann passiert aber Folgendes: 2,5 der andern werden nun die Tat begehen, weil die alle wieder ein fünfzigprozentiges Risiko haben. Deswegen greift die Frage, ob es dann jemand wirklich macht, zu kurz. Es ist vergleichbar mit zehn Personen, die besoffen und mit überhöhter Geschwindigkeit Auto fahren. Einige von ihnen werden einen Unfall machen, die anderen nicht. Dann würden Sie auch nicht sagen: Die, die unfallfrei durchkommen, müssen wir nicht stoppen – da ist ja nichts passiert. Das können Sie nicht machen. Wenn Sie die Risikofaktoren ›starke Alkoholisierung‹ und ›überhöhte Geschwindigkeit‹ sehen, stoppen Sie das Auto und warten nicht, bis es einen schweren Unfall gibt. Was wir im Einzelfall tun, hängt am Schluss immer davon ab, wie viel Risiko wir tolerieren. Das ist dann wieder abhängig von der Schwere der Straftaten. Wenn Sie von Sexualmorden reden, um es mal sehr drastisch zu sagen, ist ein Fünfzig-Prozent-Risiko sicher zu hoch.«
Er sagt, er habe mit Juristen diskutiert, die ihm hätten weismachen wollen, ein Vergewaltiger, der seine Strafe von zwei oder drei Jahren abgesessen habe, habe das Recht, nochmals eine Vergewaltigung zu begehen, für die er dann natürlich wieder zu bestrafen sei. Das entspreche der Logik, der dogmatischen Schuldtheorie. »Er dürfe es jetzt wieder machen, dann kriege er das nächste Mal vier Jahre. – Ich muss sagen, das sehe ich anders«, sagt Urbaniok bestimmt.
»Haben Sie deshalb die Verwahrungsinitiative von Anita Chaaban unterstützt?«
»Das Bedürfnis, das dahinter stand, verstehe ich total. Ich war Anfang 1998 in St. Margrethen an einer Auftaktveranstaltung. Da waren Betroffene. Eine Mutter hatte sich gemeldet, die hat einen Sohn durch einen Kindermörder verloren. Das waren Opfer. Die haben eine ganz einfache Frage gestellt: Wie könnt ihr uns garantieren, dass so etwas wie Hauert nicht nochmals passiert? Das waren deren Fragen. Politisch waren die nicht.«
Unglücklicherweise seien sie von rechts instrumentalisiert worden. Das sei nicht von Anfang an so gewesen. »Gerade Frau Chaaban, die ich gut kenne, die hat irgendwann das Visier runter geklappt und gesagt, jetzt könnt ihr mich alle mal. Und dann hat alles eine Rechts-links-Schlagseite bekommen. Ich habe das sehr bedauert.« Er findet, Frau Chaaban habe etwas Wahnsinniges geleistet mit der Initiative. Der Text sei juristisch problematisch. Es hätte Chancen gegeben, das besser zu machen. An Hearings hätten Strafrechtsprofessoren Frau Chaaban aber nicht ernst genommen, so im Stil von ›da gibt es in der EMRK diesen und jenen Paragrafen, davon verstehen Sie als Hausfrau natürlich nichts, ich muss das jetzt hier mal kurz erläutern‹. Das war der Duktus.«
Urbaniok hat viele Männer gesehen, die schlimme Taten begangen haben. Wie viele würde er für immer wegsperren?
»Wenige. Ich kann keine genaue Zahl sagen.«
»Ist die Zahl eher zwei- oder dreistellig?«
»Eher im zweistelligen Bereich. Aber es sind auch mehr als nur drei oder vier Personen.«
Das Gespräch ist fast zu Ende, da bemerkt er: »Ich habe eine schwere Erkrankung. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben.«
Ich habe davon gehört und frage, wie es ihm geht.
Er klopft auf den Tisch. »So weit, so gut …«
Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er sei durch die Hölle gegangen. Aber er habe nie damit gehadert. »Nicht dass ich es gut finde – aber es ist, wie es ist. Man muss es annehmen. Ich will nicht klagen. Es könnte sehr viel schlechter sein. Ich könnte auch schon tot sein.«
Seine Funktion als Leiter des Psychiatrisch-Psychologischen Dienstes hat er aufgegeben.