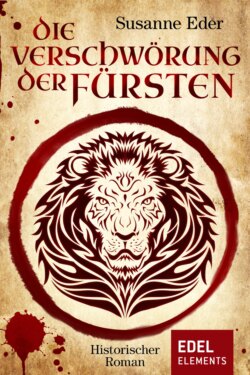Читать книгу Die Verschwörung der Fürsten - Susanne Eder - Страница 7
Kapitel 2
ОглавлениеEs dämmerte, und Morgennebel lag noch über der Waldlichtung, auf der ihr Heim stand, als Garsende von der rückwärtigen Seite der Hütte zurückkam. Sie hatte ihre beiden Ziegen gefüttert und trug Holz für ihr Herdfeuer unter dem Arm. Prüfend warf sie einen Blick in den Himmel. Dann nickte sie zufrieden. Die ersten blauen Streifen durchzogen das Grau der Dämmerung, und keine Wolke war zu sehen. Es würde ein sonniger Tag werden. Genau das richtige Wetter, um Baldrian vom Flussufer auszustechen, dachte sie. Aber sie würde noch warten müssen, bis der Nebel sich gehoben hatte. Im Gegensatz zu anderen Kräutern, deren Wirksamkeit nur dann erwuchs, wenn man sie bei Mondschein erntete, mochten Baldrianwurzeln bei trockenem Wetter und Tageslicht ausgegraben werden, damit sie ihre Kraft für ein ruhiges Gemüt entfalteten.
»Ich werde mich mit der Ernte sputen müssen«, überlegte sie laut. Fastrada, die Gemahlin Ludgers von Blochen, würde heute kommen, um sich ein Schlafpulver zu holen, das Garsende für sie gemischt hatte.
Ein Schatten flog über ihr Gesicht. Sie hatte Fastrada angeboten, ihr das Schlafpulver ins Haus zu bringen, denn sie wollte ohnehin in die Stadt, um auf dem Markt nach echtem Theriak Ausschau zu halten. Doch Ludgers Gemahlin zog es vor, zu ihr zu kommen. Der Fußmarsch durch den Wald würde ihr guttun, hatte sie behauptet, doch Garsende wusste es besser. Die Bauersleute sahen in Garsende noch immer die Heilerin, die Weise Frau, wie es noch zu Zeiten ihrer Großmutter gewesen war, und kamen ohne Scheu zu ihr. Doch just Frauen von Stand, zu denen auch Fastrada gehörte, pflegten oft hinter den Ärmeln ihrer Gewänder über sie zu tuscheln, weil sie ohne männlichen Schutz lebte und einer Tätigkeit nachging, die von der Kirche nur mehr geduldet wurde.
Ärgerlich warf Garsende ihren langen Zopf in den Nacken und seufzte. Sie hatte Glück, dass schon ihre Großmutter und Mutter hier gelebt und sich einen guten Ruf erworben hatten, sonst hätte sie es sehr schwer gehabt, sich ihr Auskommen zu sichern. Zwar kamen die Frauen noch immer lieber zur Heilerin als zu den gestrengen Brüdern der Stifte in der Stadt, doch taten sie es oft mit Vorbehalt und ließen die Anerkennung ihrem Tun gegenüber vermissen.
Garsende schüttelte die leise Bitterkeit ab, die in ihr aufgekommen war, legte das Bündel Holz vor der Tür zur Hütte ab und ging weiter zu einem Verschlag, um den das Holzhaus erweitert worden war. Als sie die Klappe öffnete, schlug ihr ein durchdringender Geruch entgegen. Hier lagerten, geschützt vor Wind und Regen, viele der Pflanzen und Wurzeln zum Trocknen, die sie im Lauf des Jahres gesammelt hatte.
Das Schnauben eines Pferdes in ihrem Rücken ließ sie herumfahren, und misstrauisch sah sie dem Reiter entgegen. Sie kannte ihn nicht, sah aber an seiner Gewandung, dass es ein Mann von Stand sein musste. Was mochte er so früh am Morgen von ihr wollen? Ein Kranker, der Heilung suchte? Garsende unterdrückte einen Anflug von Angst, der bei seinem unerwarteten Auftauchen unwillkürlich in ihr aufgekeimt war, und rief ihm ein »Grüß Euch Gott« zu.
Der Reiter ignorierte den Gruß und stieg erst ab, als er kaum eine Armeslänge vor der Heilerin zum Stehen kam. Er schien noch recht jung zu sein und hochgewachsen, doch sein Körper zeigte bereits erste Ansätze von Fettleibigkeit. Garsende, selbst groß für eine Frau, musste zu ihm aufschauen, als er sie von ihrem haselnussfarbenen Schopf bis zu ihren bloßen Füßen, die mit Erde behaftet unter ihrem geschürzten Gewand hervorschauten, einer beleidigenden Musterung unterzog.
»Du also bist der Bastard meines Großvaters«, stellte er endlich fest.
Garsende zuckte zusammen. Seit ihrer Zeit im Kloster hatte niemand mehr sie so genannt. Aber nun wusste sie auch endlich, wen sie vor sich hatte.
»Weigand von Rieneck«, sagte sie leise und zwang sich zu einem Knicks.
»Graf Weigand von Rieneck«, betonte er.
»So lebt Konradin nicht mehr?« Die Nachricht stimmte sie traurig. Auch wenn sie ihren Halbbruder kaum gekannt hatte, berührte sie sein Ableben doch, schließlich waren sie von gleichem Blut gewesen.
»Ganz recht. Und deshalb bin ich hier.«
»Um mir die Nachricht persönlich zu überbringen?«, fragte Garsende überrascht.
Der neue Herr von Rieneck verzog die Lippen und lachte spöttisch: »Du maßt dir zu viel an, Weib. Ich bin hier, weil es an der Zeit ist, dass du von hier verschwindest.«
Die Furcht griff so plötzlich nach ihr, dass Garsende vor ihm zurückwich, bis sie den Pfosten des Verschlags in ihrem Rücken spürte.
»Was ... was meint Ihr damit?«, hörte sie sich mit spröder Stimme fragen.
»Was meint Ihr damit?«, äffte Weigand sie nach und schüttelte den Kopf. »Du hast hier lange genug vom Jagdprivileg profitiert, das mein Großvater dir törichterweise überlassen hat. Mein Vater hat es geduldet, doch ich werde das nicht tun. Es ist höchste Zeit, dass Land und Recht in die Familie zurückkehren. Das meine ich damit.« Seine Stimme war lauter geworden, und seine plumpe, geäderte Nase färbte sich rot.
Die Leber, schoss es Garsende durch den Sinn, und beinahe hätte sie gelacht. Ihre Anspannung löste sich ein wenig, und ebenso plötzlich wie die Furcht gesellte sich ein Gutteil Zorn zu ihrem Schrecken. Mit einer Hand griff sie nach dem Pfosten, als könne er ihr Halt geben, und straffte sich.
»Wald und Land vom Weg nach Roxheim bis hinunter zum Rhein gab mir Graf Konrad von Rieneck selbst zu Eigen als meine Mitgift, und dafür habe ich Brief und Siegel«, erklärte sie fest.
»Mitgift? Was du nicht sagst.« Weigand schnaubte verächtlich. »Und wo ist dein Ehemann?«
»Die Ausstattung ist an keine Bedingung geknüpft, und Bischof Arnold hat mein Recht noch letztes Jahr bestätigt«, sagte Garsende schnell. Sie stieß sich vom Pfosten ab und trat einen Schritt vor. »Ihr könnt mich nicht von hier vertreiben.«
»Und was willst du gegen mein Wort ausrichten, Drude? Bischof Adalbero speist an meiner Tafel, und der Landgraf geht mit mir zur Jagd. Hast du einen Bürgen von edlem Blut, dem es zusteht, gegen mich zu sprechen?« Weigand setzte seinen Stiefel in den Steigbügel und zog sich in den Sattel. »Du kannst von Glück sagen, dass mich dringende Geschäfte nach Speyer rufen und du Zeit hast, deine Habseligkeiten zu packen. Zum Tag des Heiligen Lukas werde ich wieder zurück sein, und dann will ich dich hier nicht mehr vorfinden.«
Er wendete seinen Gaul, drehte sich im Sattel aber noch einmal um und zeigte ihr ein herablassendes Lächeln. »Und was die Bestätigung von Bischof Arnold betrifft, hat es damit keinerlei Bewandtnis. Das Waldstück hat niemals zum bischöflichen Eigen gezählt. Du hättest schon den König um Bestätigung bemühen sollen«, rief er noch, dann stieß er dem Pferd seine lederbewehrten Fersen in die Flanken und ritt grußlos davon.
Niedergeschmettert und wütend zugleich starrte Garsende ihm nach. Er hatte Recht. Die Herren von Rieneck waren Edelleute mit Land und Gütern, Vogteien und Privilegien; sie dagegen war nur eine Frau und noch dazu eine, die ohne Ehemann und Vormund dastand. Weder die Besitzurkunde noch ihr guter Ruf würden gegen sein Wort genügen. Wenn es ihr nicht gelang, einen Mann von Stand zu beschaffen, der für ihre Sache eintreten und für sie bürgen würde, dann wäre ihr Eigen – Brief hin, Brief her – verloren. Aber wo, bei allen Heiligen, sollte sie nur einen solchen Bürgen bis zum Lukastag auftreiben?
»Auf dass Euch die Leber platzen und Eure Galle überlaufen möge!«, schrie sie ihm endlich zornentbrannt hinterher, doch der Reiter war längst hinter den Bäumen verschwunden.
Als Matthäa kurz vor Sonnenaufgang erwachte, hatte sich Penelope bereits aus dem Staub gemacht. Bandolf schlief noch tief und fest, und Matthäa schlüpfte leise in ihr Gewand, um ihn nicht vorzeitig zu wecken. Der Burggraf schätzte seinen Schlaf und reagierte übellaunig auf Unterbrechungen. Hildrun hatte schon das Feuer im Kamin geschürt, und die stämmige Filiberta rührte mit vor Qualm zusammengekniffenen Augen im Kessel über der Feuerstelle, als Matthäa nach unten kam. Dem großen eisernen Topf entstieg ein Duft nach Hirse, Milch, Kümmel, Lauch und Zwiebeln.
In der Halle war der Überfall auf den Erzbischof von Bremen bereits in aller Munde. Der Kurze Thomas hatte die aufregende Neuigkeit noch vor Sonnenaufgang zusammen mit einem Eimer Wasser ins Haus gebracht, und die Hauseigenen und Dienstleute des Burggrafen, die sich nach und nach zum Frühstück in der Halle einfanden, stürzten sich mit schaudernder Begeisterung auf das Ereignis.
»Der Kurze Thomas meint, dass man ihn halbtot und mit zerrissenem Gewand auf dem Pfalzhof aufgefunden hat«, bemerkte Prosperius, der wie immer als Erster seinen Platz am Tisch eingenommen hatte. Der junge Schreiber war nur eine Handbreit größer als die Hausherrin, und sein Kittel hing lose um seinen schmächtigen Körper. Braunes Haar fiel lang und wirr in sein schmales Gesicht, und die großen dunklen Augen erweckten stets den täuschenden Eindruck engelsgleicher Unschuld. Wohlgefällig schnupperte er an der Schüssel, die Matthäa auf den Tisch stellte.
»Hildrun, hast du nicht gesagt, der Erzbischof hätte splitterfasernackt vor dem Altar der Pfalzkapelle gelegen?«, wollte Werno, der kahlschädelige Hausmeier des Burggrafen, wissen.
Die junge Magd, die sich untätig an der Feuerstelle herumdrückte, wurde bis über die Ohren rot. Werno wandte sich an seinen Nachbarn. »Was meinst du, Stallmeister, hatte er seine Kleider noch am Leib?« Herwald, Bandolfs schweigsamer Marschalk, verzog jedoch nur mürrisch den Mund und grunzte etwas Unverständliches.
»Der Erzbischof trägt stets nur die feinsten Gewänder aus kostbaren Stoffen. Sogar sein Hemd unter der Albe soll aus purer Seide sein. Das sagt dir jeder«, gab Hildrun mit glänzenden Augen zum Besten und warf dabei Jacob, dem Pferdeknecht, einen bedeutsamen Blick zu.
»Dummes Ding. Du hast nur Unsinn im Kopf«, brummte Filiberta unwirsch und drückte ihr einen Stoß Holzteller in die Hand. »Seide, wie?« Sie warf sich in die Brust. »Seine Eminenz trägt natürlich ein härenes Hemd unter seiner Albe. Das erinnert ihn an die Leiden Unseres Herrn.«
»Woher weißt du das?«, fragte Prosperius mit ernster Miene.
Filiberta quittierte das Gelächter der Männer mit einem empörten Schnauben und gab Hildrun einen Stoß. »Nun trödel nicht herum, und verteile die Teller.«
Hüfteschwingend bewegte sich die junge Magd zum Tisch.
»Das Gör beträgt sich wie eine läufige Hündin und ist dabei so faul wie ein Bettelmönch«, beschwerte sich Filiberta.
»Ja, ich weiß. Aber war soll ich mit ihr machen?«, seufzte Matthäa.
»Verkauft sie.«
Matthäa lächelte. »Ich könnte sie genauso wenig verkaufen wie dich, das weißt du«, sagte sie. »Ihr seid doch die Einzigen, die ich aus meines Vaters Haus mit in dieses genommen habe.«
»Dann helfen vielleicht Prügel«, schlug Filiberta vor.
Matthäa zuckte mit den Schultern. Laut sagte sie: »Bewege dich, Hildrun. Da fehlt noch Bier auf dem Tisch und der Becher des Herrn.«
Hildrun, der der scharfe Tonfall ihrer Herrin nicht entgangen war, beeilte sich, ihrer Aufforderung nachzukommen, und Filiberta nickte zufrieden.
Schläfrig und wortkarg wie jeden Morgen, kam der Burggraf als Letzter in die Halle und setzte sich an das Kopfende des langen Holztisches, an dem nun Herrschaft, Hauseigene und Dienstleute Platz genommen hatten. Nachdem er ein kurzes Gebet in seinen Bart gemurmelt hatte, machte er sich schweigend über sein Essen her. Erst als Bandolf gesättigt die Schüssel beiseiteschob, die er heute mit seinem Marschalk geteilt hatte, zog ein gutgelauntes Lächeln über sein Gesicht, und er begann, seinen Leuten Anweisungen für den Tag zu erteilen.
»Was soll ich mit zwei Fuhren Mist anfangen?«, stöhnte der Burggraf.
Er war mit seinem Schreiber allein in der Halle zurückgeblieben. »Ich hatte in Dreieich ausdrücklich befohlen, dass man mir als Abgabe zu Michaeli eine Fuhre Mist, Gänse, Wein und Weizen bringt. Und jetzt schleppt man mir zwei Fuhren Mist ins Haus, aber keine einzige Gans. Mein Weib wird mir die Hölle heiß machen, wenn sie zu Michaeli ihre Gans nicht bekommt.«
Prosperius stand vor ihm, hielt seine Hände auf dem Rücken verschränkt und betrachtete angelegentlich die Darstellung des heiligen Christophorus an der Wand hinter seinem Herrn. Der Maler hatte der Bekehrung der beiden Dirnen, Nicaea und Aquilina, durch den Heiligen mit üppigen Farben und noch üppigerer Phantasie Ausdruck verliehen.
»Behaltet eine Fuhre und verkauft die andere«, schlug er mit nicht ganz sicherer Stimme vor.
Bandolf warf seinem Schreiber einen forschenden Blick zu, um zu sehen, ob Prosperius sich etwa an seinem Missgeschick weidete. Er hatte den jungen Wandermönch halb verhungert zu Petri Kettenfeier mit der Hand am Beutel eines Kaufmanns erwischt. Natürlich hatte der junge Bursche nicht die Mittel gehabt, um seine Buße zu begleichen. Aber er konnte lesen und schreiben, und so hatte der Burggraf ihn kurzerhand für die Dauer eines Jahres als seinen Schreiber in die Pflicht genommen. Dank Matthäas Kost hatte Prosperius mittlerweile wieder etwas Fleisch auf die Rippen bekommen, und die Arbeit schien ihm zu gefallen.
»Na schön«, gab Bandolf endlich nach und entließ ihn aus seiner scharfen Musterung. »Du kannst Werno sagen, dass der Mann die beiden Fuhren abladen kann und er ihm Proviant für die Rückreise mitgeben soll. Und was gibt es sonst noch?«
Augenscheinlich erleichtert zog Prosperius seine Wachstafel zurate. »Aginulf aus der Webergasse führt Klage gegen den Schankwirt von der Schwertfegergasse, weil der seine Brottunke mit Schafspisse gewürzt hätte. Der Kannengießer Jacobus beschwert sich wegen eines Zaunes vom Obstgarten des St.-Paulus-Stifts, der, wie er behauptet, auf seinem Eigen steht«, berichtete er. »Und dann gab’s noch eine Rauferei auf dem Viehmarkt zwischen Wigmar aus Köln und dem Egbert, welcher Gehilfe des Juden Adam, des Gewürzhändlers, ist.«
Bandolf strich sich nachdenklich über seinen Bart, der trotz seiner Bemühungen immer ein wenig struppig von Kinn und Wangen abstand. »Der Kannengießer soll das mit dem Propst vom St.-Paulus-Stift ausmachen. Das ist Sache der Kirche«, wies er Prosperius an. »Sag ihm, er kann sich zur Not an den Bischof um Recht wenden, wenn er für seinen Anspruch Zeugen beibringen kann und der Propst nicht mit sich reden lässt.« Er runzelte die Stirn. »Die Rauferei trägst du dem Kämmerer Pothinus vor. Wenn Belange der Juden betroffen sind, so ist es seine Aufgabe, den Streit zu schlichten. Und was nun Aginulf aus der Webergasse angeht ...«
Bandolfs Geschäfte wurden jäh unterbrochen, als ein Bote eintraf und mit wichtigtuerischer Miene die Aufforderung des Bischofs von Worms überbrachte, der Burggraf möchte sich umgehend in der Pfalz bei ihm einfinden. Der Bischof habe eine wichtige Nachricht für ihn.
»Es wundert mich, dass Bischof Adalbero so früh auf den Beinen ist«, bemerkte Prosperius, nachdem der Bote gegangen war.
»Ich bezweifle, dass der Bischof auf seinen Beinen ist«, meinte Bandolf sarkastisch.
Zu Ostern hatte Adalbero, der Bruder des Schwabenherzogs Rudolf von Rheinfelden, die Nachfolge des verstorbenen Arnold als Bischof von Worms angetreten. Noch niemals zuvor war Bandolf einem derart fettleibigen Menschen begegnet wie Adalbero von Rheinfelden, der bei seiner Ankunft zur allgemeinen Belustigung von zwei kräftigen Männern aus seiner Sänfte gehievt werden musste.
Der Burggraf rief nach seinem guten Mantel und schickte sich an zu gehen. Prosperius folgte ihm vor die Tür.
»Dann werde ich mich um die beiden Fuhren Mist kümmern, während Ihr fort seid«, meinte er, doch Bandolf hielt ihn zurück.
»Nein, mein Lieber. Du wirst mich zum Bischof begleiten. Was immer er Dringendes für mich hat, es wird nichts Gutes sein. Ich traue dem Mann nicht.«
Prosperius schluckte. »Aber ich könnte die Fuhre Mist für Euch verkaufen und Euch statt der Gans einen Pfau besorgen«, schlug er hastig vor. »Da ist ein Bauer auf dem Markt, der mir noch eine Gefälligkeit schuldig ist.«
Bandolf starrte seinen jungen Schreiber argwöhnisch an. »Gibt es einen besonderen Grund, weshalb du der Pfalz fernbleiben möchtest?«, fragte er. »Du hast doch die vierteljährliche Abrechnung mit dem Vogt des Bischofs gemacht, wie ich dir aufgetragen habe, oder?«
»Natürlich, Herr«, beeilte sich Prosperius zu versichern und blinzelte den Burggrafen unschuldig an, doch über seine Wangen breitete sich eine zarte Röte aus.
Bandolf zog die Brauen hoch. »Und?«, fragte er scharf.
Prosperius schlug die Augen nieder, und die Röte in seinem Gesicht vertiefte sich. »Nun ja, Herr – der Vogt und ich haben gemeinsam beschlossen, hie und da eine winzig kleine Änderung vorzunehmen. Versteht Ihr? Wirklich ganz unauffällig, da habt Ihr mein Wort.«
»Herr im Himmel«, stöhnte der Burggraf. »Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass ich den Leuten keine Ehrlichkeit abverlangen kann, wenn meine eigenen Leute korrupt sind?«
»Aber Herr, wer redet denn von Korruptsein?« Empört riss der junge Schreiber die Augen auf. »Wir haben doch nichts getan, was nicht jeder kluge Mann tun würde.«
»Wo hast du es?«
»Das Silber liegt in Eurer Schatulle, aber das Ferkel ist aufgegessen«, gestand Prosperius. Kleinlaut fügte er hinzu: »Eigentlich wollte ich das Ferkel aufsparen, doch dann ...« Er verstummte unter dem strengen Blick seines Herrn.
Bandolf rollte seufzend die Augen. Mönch hin, Mönch her – man hatte ganz offenkundig verabsäumt, Prosperius beizubringen, was Mein und Dein war. Es schien unmöglich, dem jungen Burschen klarzumachen, dass seine Mauscheleien nicht die Art von Zubrot waren, die Bandolf als Burggraf dulden konnte. Er hielt ihm diesbezüglich eine strenge Strafpredigt, bis sie aus dem Haus und auf der Brotgasse waren, in der sicheren Erwartung, dass seine Vorhaltungen ja doch nichts fruchten würden.
Der September neigte sich dem Ende zu, und eine warme Herbstsonne tauchte die Stadt in ein goldenes Licht. Es hatte seit Tagen nicht mehr geregnet, und so konnte man die Gassen passieren, ohne knöcheltief in verschlammtem Unrat zu versinken. Ein lauer Wind brachte aus den Gärten den Duft nach Äpfeln, Birnen und Kräutern mit sich. Je näher der Burggraf und sein Schreiber dem Marktplatz kamen, desto mehr verdrängte der Geruch von scharfen Gewürzen, Schweiß, fauligem Fleisch und jedem nur denkbaren Unrat von Mensch und Tier den zarten Duft der Obstbäume, und der Verkehr wurde turbulenter.
Am Ende der Brotgasse mussten sie eine Gänseschar passieren lassen, die ein Knecht zum Marktplatz trieb, doch als Bandolf sich anschickte weiterzugehen, bemerkte er, dass Prosperius winkend und gestikulierend stehengeblieben war.
»Was gibt es denn?«, fragte er ungeduldig.
»Ich wollte die Herrin begrüßen, aber sie hat uns wohl nicht gesehen«, antwortete Prosperius und ließ die Arme sinken.
Bandolf schaute in Richtung Brotpforte, in die sein Schreiber gezeigt hatte. Zwei Frauen, beide von Kopf bis Fuß in dunkle Umhänge gehüllt, liefen schnellen Schrittes der Stadtmauer zu. Sie kehrten dem Burggrafen den Rücken, und während die eine fest einen Korb umklammert hielt und es offenbar sehr eilig hatte, schaute sich die andere immer wieder um. Ohne Zweifel war es Hildrun, die sich so verstohlen umsah. Die andere Frau trug einen alten fleckigen Umhang, der auf keinen Fall zu Matthäas Gewändern gehörte. Ein schwerer pelzbesetzter Mantel hatte zu ihrer Mitgift gezählt, und für wärmere Tage hatte Bandolf ihr einen blau gefärbten Umhang mit breiter bestickter Borte geschenkt.
»Bist du sicher, dass du die Burggräfin erkannt hast?«, fragte Bandolf zweifelnd. Prosperius nickte, und der Burggraf kniff angestrengt die Augen zusammen. Tatsächlich. Dieser leichte, wiegende Gang war ihm vertraut. Bandolf runzelte die Stirn. Wohin, bei allen Heiligen, wollte Matthäa so eilig und in diesem schäbigen Mantel? Er überlegte noch, ob er sie rufen sollte, doch ein Heukarren bog aus der Münzergasse auf die Brotgasse und versperrte ihm die Sicht. Als der Karren endlich vorbeigerumpelt war, hatte er die beiden Frauen aus den Augen verloren.
Nicht nur Handwerker, Händler und Bauern hatte die Aussicht auf gute Geschäfte in die Stadt gelockt. Auch Pilger drängten sich in den Gassen, angezogen von den zahlreichen Reliquien, die der Dom und die anderen Stiftskirchen der Stadt beherbergten. Wanderprediger, Reliquienverkäufer, Wunderheiler, Bettler und Pantomimen mischten sich unter das Volk und nutzten die Markttage zu Michaeli, um Geschäfte zu machen oder an die Barmherzigkeit der Leute zu appellieren.
Bandolf, der schweigsam ausgeschritten war und über Matthäas merkwürdigen Aufzug nachgegrübelt hatte, blieb stehen und ließ seinen Blick über das Gewimmel schweifen. Langsam huschte ein breites Lächeln über sein Gesicht. All die Leute, die sich hier tummelten, würden seiner Stadt guten Gewinn einbringen. Da waren der Marktzins und die Standplatzgebühren, und nicht zu vergessen die Bußgelder, die diejenigen zu entrichten hatten, welche den Frieden des Königs störten. Der Bischof würde von allem zwei Drittel kassieren, während ein Drittel dem Burggrafen zustand. Bandolf rieb sich vergnügt die Hände.
«Der Jahrmarkt wird unsere Schatulle kräftig füllen«, bemerkte er. Er musste seine Stimme heben, um all den Lärm zu übertönen. »Und weiß Gott, wir haben es nötig.«
Seine Dienstleute und Torwachen trugen veraltete Waffen; das Pfauentor benötigte einen neuen Anstrich, die Stadtmauer musste dringend ausgebessert werden, und dann war da noch sein geheimer Wunsch, einen neuen Turm zwischen Martins- und Andreaspforte errichten zu lassen. Während sich die beiden Männer durch das Gedränge schoben, verfinsterte sich Bandolfs Gesicht wieder.
»Und Worms wird seinen neuen Turm auch bekommen, falls mich der fette Adalbero so lange im Amt lässt«, brummte er düster.
»Warum sollte er nicht?«, erkundigte sich Prosperius verwundert. »Es ist doch kaum eine Woche her, dass König Heinrich Euch erneut mit dem Blutbann für Worms belehnt hat.«
Bandolf schüttelte zweifelnd den Kopf. »Bischof Arnold war bis zu seinem Tod ein aufrechter Mann des Königs«, sagte er. »Er hat mich zu seinem Burggrafen ernannt, weil er wusste, dass meine Familie stets treu zum salischen Königshaus gestanden hat.«
Er wich einem Pferdeapfel aus und verzog angewidert das Gesicht, als er stattdessen in eine schlierige Pfütze trat. An einem Grasbüschel wischte er seinen Stiefel notdürftig sauber.
»Mit dem neuen Bischof verhält es sich anders. Adalbero ist der Bruder des Herzogs von Schwaben, und die Fürsten kochen ihr eigenes Süppchen. Sie nutzen die Jugend des Königs aus, und Heinrich sitzt noch lange nicht fest genug im Sattel, um sich dagegen wehren zu können.« Wieder schüttelte er grimmig den Kopf. »Nein, Prosperius. Der neue Bischof ist kein Königsmann. Und ganz bestimmt hatte er auch niemals die Absicht, einen Königsgetreuen wie mich zum Burggrafen zu ernennen. Ich wurde ihm aufgedrängt, und das lässt er mich spüren. Er würde liebend gerne einen Vorwand finden, um mich loszuwerden.«
Prosperius nagte auf seiner Unterlippe und schaute unglücklich drein. Die Welt des Hofes mit seinen tausend Gesichtern und Winkelzügen, den Intrigen und geheimen Absprachen war ihm offenbar nicht geheuer.
Bandolf schlug ihm aufmunternd auf die Schulter. »Dennoch kein Grund, Trübsal zu blasen. Du glaubst doch nicht, dass ich mir von einem Rheinfeldener Pfaffen den Braten vom Brot nehmen lasse?«
Prosperius, um gut einen Kopf kleiner als sein Herr und lange nicht so kräftig, stolperte keuchend vorwärts, und Bandolf lachte.
Sie bogen in die Diebsgasse ein und stiegen den Hang hinauf zum Pfalzhof. Die Morgensonne fiel auf die Osttürme des Doms und auf die Silberkammer, die sich an den Ostchor schmiegte. Die Nordfassade des Doms lag noch im Schatten. Immer wieder aufs Neue beeindruckt von dem gewaltigen Bauwerk zu Ehren des Herrn, blieb Bandolf stehen und bewunderte den herrlichen Anblick, den der Dom, in Licht gebadet, bot.
»Damit kann sich nicht einmal Speyer messen«, behauptete er stolz.
Prosperius, dessen Gedanken wohl immer noch bei den Stolperfallen der Hofpolitik weilten, hatte anscheinend für architektonische Betrachtungen nichts übrig. »Was kann der Bischof denn bloß von Euch wollen?«, grübelte er laut. »Ihr denkt doch nicht, er hat etwa Wind bekommen von meiner kleinen Absprache mit dem Vogt?«
Sein offenkundiges Unbehagen entlockte Bandolf ein Lächeln. »Wir werden es bald erfahren. Ich hoffe aber, es ist nicht das, was ich befürchte«, sagte er und dachte an den Vorfall der vergangenen Nacht.
Prosperius seufzte. »Ich auch.«
Sie überquerten den Pfalzhof und schritten durch den Torbogen, der zwischen Aula Major und Aula Minor, der großen und der kleinen Halle des bischöflichen Wohnsitzes, auf den rückwärtigen Domplatz führte. In der Aula Minor hatten sich schon einige Gruppen von Menschen versammelt. Priester, Ordensbrüder, Höflinge, Kaufleute und Bauern warteten darauf, dass der Bischof sie empfangen und sich um ihre Anliegen kümmern würde. Bandolf, keinesfalls gewillt, sich in der Halle stundenlang die Beine in den Bauch zu stehen, nachdem man ihn so dringend hierherbeordert hatte, begrüßte hier und dort ein bekanntes Gesicht und nahm mit Prosperius im Schlepptau den direkten Weg zum Türsteher, der die Kammer des Bischofs bewachte. Zu seiner Erleichterung ließ man ihn auch gleich eintreten.
Adalbero von Rheinfelden, der Bischof von Worms, thronte auf einem reich mit Schnitzereien verzierten Stuhl, der eigens für seinen gewaltigen Umfang gezimmert worden war. Seine Robe bestand aus auserlesenen, teuren Stoffen; auf seiner ausladenden Brust prangte eine goldene Gliederkette, an der ein edelsteinbesetztes Kreuz baumelte, und jeder einzelne seiner dicken Finger war mit einem Ring geschmückt. Sein massiger Leib drückte über die Armlehnen des Stuhls und quoll, durch die faltenreiche Dalmatika nur mangelhaft kaschiert, über seine fetten Oberschenkel. Neben seinem Stuhl stand ein kleiner Tisch mit Wein und Spezereien, und dahinter wartete ein Höriger auf den Wink des Bischofs. So gewandet und beringt, die Füße auf einem Schemel ruhend und in der Hand einen silbernen Becher haltend, nahm sich Adalbero aus wie ein morgenländischer Potentat, der sich versehentlich in eine christliche Pfalz verirrt hatte, und Bandolf ertappte sich dabei, wie er nach tanzenden Heidenmädchen Ausschau hielt. Außer dem Bischof und seinem Diener war jedoch nur noch ein Schreiber anwesend, der im Hintergrund an seinem Pult stand und gelangweilt an einer Feder kaute.
Prosperius machte seine Referenz und verschwand dann in einer Ecke der Kammer, wo er versuchte, sich unsichtbar zu machen. Bandolf verscheuchte seine lästerlichen Gedanken an halbnackte Mädchenkörper, beugte ein Knie und küsste die Luft zwischen seinen Lippen und Adalberos juwelenschwerer Hand.
»Wie erfreulich, dass Ihr meiner Bitte so rasch entsprochen habt, Burggraf«, sagte der Bischof und verzog seinen kleinen Mund zu einem angedeuteten Lächeln, das in den Wülsten seiner Wangen verschwand.
»Euer Bote vermittelte den Eindruck, dass es dringend sei, Eminenz«, erwiderte Bandolf.
»Dringend? Nun ja, wahrhaftig, das könnte man sagen.« Adalbero hob träge den Becher in seiner Hand und nickte seinem Diener zu.
»Bring uns Wein.«
»Gönnt Euch doch auch einen Schluck, Burggraf«, bot er an. »Das ist ein feiner, weißer Mosler, den ich mir eigens aus Trier kommen lasse.«
Ungeduldig zog Bandolf seinen Zinnbecher aus der Tasche seines Mantels und ließ sich einschenken, während er sich fragte, welchen Knüppel der Bischof ihm dieses Mal zwischen die Beine werfen würde. Adalbero ließ ihn zappeln.
»Ich hatte nach Euch schicken lassen, nicht nach Eurem Schreiber«, bemerkte der Bischof, und seine flinken Augen, mit denen er Bandolf taxierte, straften seine müde Stimme Lügen.
»Vier Augen und Ohren mögen Euch besser dienen als nur zwei.« Bandolf lächelte kalt und trank einen Schluck aus seinem Becher. In der Tat schmeckte der Wein vorzüglich.
»Wie Ihr meint.« Adalbero griff nach einem der gelben Küchlein, die zu seiner Erfrischung auf dem Tisch standen, und betrachtete es wohlgefällig, bevor er es in den Mund schob. Während er sich schmatzend die Finger ableckte, sagte er beiläufig:
»Ich erwarte morgen meinen Archidiakon in Worms. Es wird doch keine Schwierigkeiten an der Rheinfähre für ihn geben?«
»Was für Schwierigkeiten?«
»Nun mein Lieber, ich möchte nicht, dass die Fährleute die Hand aufhalten, wenn sie einen Mann der Kirche übersetzen«, meinte der Bischof glatt und schielte nach einem weiteren Kuchen.
Bandolf, der genau wusste, worauf Adalbero hinauswollte, kniff die Augen zusammen. »Dann soll ich also die Fahrt Euch in Rechnung stellen lassen?«, fragte er.
»Aber mein lieber, guter Graf«, schalt Adalbero. »Ihr wisst doch, was ich meine.«
»Der Fährdienst ist ein Privileg der Stadt, nicht der Kirche. Euer Archidiakon wird bezahlen müssen, wie jeder andere auch«, brummte Bandolf verärgert und fragte sich, ob die Fährleute um ihren Lohn zu prellen alles war, was der Bischof von ihm wollte. Adalbero schüttelte den Kopf, als hätte er ein ungezogenes Kind vor sich, das die elementarsten Dinge des Lebens nicht begreifen wollte. »Wenn dem also so ist ...«, seufzte er. Fragend sah er den Burggrafen an. Nachdem aber Bandolf hartnäckig schwieg, nahm sich der Bischof noch ein Stück Kuchen und kam dann endlich zur Sache.
»Da ist noch eine andere Angelegenheit, die Eurer Aufmerksamkeit bedarf«, sagte er und räusperte sich. »Wie Ihr wisst, wurde Seine Eminenz, Adalbert von Bremen, heute Nacht überfallen. Der König ist über alle Maßen empört und verlangt, dass der Dieb, der Seine Eminenz berauben wollte, unverzüglich gefasst werde. Und er besteht darauf, Euch mit dieser Aufgabe zu betrauen.« In seiner Stimme klang unverhohlener Ärger.
Das hat mir noch gefehlt, dachte Bandolf und unterdrückte ein Stöhnen. Laut sagte er: »Und wenn es nun kein Dieb war, sondern jemand, der einen persönlichen Groll gegen Adalbert von Bremen hegt?«
»Unsinn. Natürlich war es ein Dieb.« Adalbero ließ den Wein in seinem Becher kreisen. Dann starrte er Bandolf durchdringend an. »Haltet Euch an das Offensichtliche, Burggraf, und bringt mir den Dieb.«
Er krümmte den Zeigefinger, und der Schreiber brachte ihm ein versiegeltes Pergament, das der Bischof an Bandolf weiterreichte. »Das ist ein Schriftstück, das Euch weiterhelfen sollte«, bemerkte Adalbero. »Vom König persönlich geschrieben und gesiegelt. Falls Ihr nicht lesen könnt, lasst es übersetzen.«
Mit einem Zug trank Bandolf seinen Becher leer, verstaute ihn in seiner Manteltasche und wandte sich mit einer Verbeugung und einem Wink in Prosperius’ Richtung zum Gehen. Der Stuhl des Bischofs ächzte, als Adalbero seine Leibesmasse darin aufrichtete. »Ich erwarte ein schnelles Ergebnis, Burggraf«, sagte er leise. »Denkt daran, der König ist kein geduldiger Mensch.« Dann entließ er Bandolf und seinen Schreiber mit einem in die Luft gewedelten Segen.
Als die beiden Männer die Aula Minor verlassen hatten, brach Bandolf das Siegel auf und studierte den Inhalt des Schreibens. »Falls Ihr nicht lesen könnt, lasst es übersetzen«, äffte er den Bischof nach. »Ich wette um das Euter meiner besten Milchkuh, dass dieser Rheinfeldener Prahlhans mein Curriculum Vitae genau studiert hat, als er hierhergekommen ist. Mit Sicherheit ist ihm bekannt, dass ich meine Buchstaben gelernt habe.«
Prosperius räusperte sich: »Nun, Herr, der Bischof wird sich womöglich gedacht haben, dass Ihr es nicht könnt, da Ihr ja kein Mann der Kirche seid und obendrein noch einen Schreiber habt.«
Doch Bandolf ging es im Grunde gar nicht um die spitze Bemerkung des Bischofs.
»Ich stecke in Schwierigkeiten, Prosperius«, brummte er.
Sein junger Schreiber fragte erstaunt: »Warum denn, Herr? Glaubt Ihr etwa, Ihr könnt den Dieb nicht fangen?«
»Wenn es denn ein Dieb gewesen ist, dann sollte er sich schon längst aus dem Staub gemacht haben, nachdem sein Überfall auf den Erzbischof von Bremen fehlgeschlagen ist«, versetzte der Burggraf. »Aber das habe ich nicht gemeint. Allem Anschein nach ist der Bischof mehr als verärgert darüber, dass der König mich mit dieser Angelegenheit betraut und die Kirche übergangen hat. Wenn ich den Täter nun nicht fassen kann, wird er sich die fetten Hände reiben und mir mit einem hinterhältigen Lächeln einen Strick daraus drehen. Und item ...«, grübelnd strich er sich über seinen Bart, »... item hat er sehr nachdrücklich darauf bestanden, dass es ein Dieb gewesen sein muss. Warum?«
»Wer soll es denn sonst gewesen sein?«, fragte Prosperius sorglos.
»Wie man so hört, hat Adalbert von Bremen hochgesteckte Ziele, und ein solcher Mann hat nicht nur Freunde«, entgegnete Bandolf, faltete das Pergament wieder zusammen und verstaute es in seiner Manteltasche.
»Was steht denn nun in dem Papier?«, erkundigte sich Prosperius neugierig.
»Der König schreibt darin, dass ich in seinem persönlichen Auftrag handle«, gab Bandolf mit düsterem Gesicht zur Antwort. »Er hat es bestimmt gut gemeint, aber ich bezweifle, dass das Schreiben die Zungen lockern wird, wenn die Leute lieber schweigen wollen.« Er zuckte mit den Schultern und seufzte. »Na schön, dann lass uns den Ort des Überfalls noch einmal in Augenschein nehmen.«
Auch wenn der Pfalzhof längst nicht so übervölkert war wie der Marktplatz, herrschte hier am Tag reger Durchgangsverkehr. Boten und Dienstleute eilten zwischen der Pfalz und ihren Quartieren hin und her. Gefolgsleute des Königs standen in Grüppchen zusammen, um den neuesten Klatsch auszutauschen und kleine Intrigen zu schmieden. Pferde wurden an die Tränke geführt, und Eigenleute des Bischofs schöpften Wasser aus dem Brunnen. Einige Brüder des Domstifts gingen gemessenen Schritts über den Platz, und Mägde folgten mit schweren Körben ihren Damen, die auf dem Markt eingekauft hatten.
Aus der Hohlgasse schoss ein kleiner Mann in der Robe der Domherren auf den Platz. Seine ganze Aufmerksamkeit galt einem mit einem Tuch verhüllten, kastenförmigen Gegenstand, den er auf den Armen trug. Er schien so darauf bedacht, ihn ja nicht fallen zu lassen, und hatte es dabei so eilig, dass er direkt in den Burggrafen hineinstolperte.
»Aufgepasst!«, rief Bandolf, und Prosperius griff geistesgegenwärtig nach dem Arm des schon älteren Domherrn, bevor er fallen konnte.
»Ihr rennt ja, als wären die apokalyptischen Reiter hinter Euch her, Bruder Arbogast«, sagte Bandolf, als er den Sakristan, Hüter der Reliquien und Schätze des Domstifts, erkannte.
»Burggraf? Ich habe Euch gar nicht gesehen.« Verträumte blaue Augen richteten sich auf Bandolf und seinen Schreiber, und der kleine, rundliche Sakristan blinzelte. »Die apokalyptischen Reiter? Der Herrgott bewahre mich.« Er versuchte, ein Kreuz zu schlagen, was angesichts seiner Last kläglich misslang. »Nein, nein. Niemand ist hinter mir her. Ich will nur die heilige Afra schnell wieder an ihren Platz zurückbringen.« Mit dem Lächeln eines Verliebten lüftete er das Tuch und zeigte dem Burggrafen stolz ein Elfenbeinkästchen. Es war rechteckig, mit Blattgold verziert, und um den Deckel führte eine Borte mit schön geschnitzten Tannenzapfen. »Seht nur. Einer der Zapfen war beschädigt. Ich habe es reparieren lassen, und nun ist die Schlafstatt der heiligen Afra wieder ganz.«
Prosperius bestaunte den kostbaren Reliquienschrein mit glänzenden Augen und bekreuzigte sich ehrfürchtig. Auch Bandolf schlug ein Kreuz. »Ihr habt doch nicht den Knochensplitter der heiligen Afra aus der Hand gegeben?«, fragte er mit einem Zwinkern, doch Ironie war an den Sakristan verschwendet.
»Aber nein, wo denkt Ihr hin?«, rief Arbogast entrüstet. »Sie ruhte selbstverständlich vorübergehend in einem anderen Schrein. Aber jetzt bekommt sie wieder ihren eigenen.«
»Wenn er könnte, würde er seine Heiligen nachts in den Schlaf singen«, bemerkte Bandolf, als er dem eiligen Sakristan hinterherschaute. Prosperius, dessen Glaube an Reliquien schon in frühester Jugend durch reichlich abenteuerliche Geschichten seines fantasiebegabten Novizenmeisters gewürzt worden war, warf seinem Herrn einen schockierten Blick zu.
Die Stelle, an der Adalbert von Bremen überfallen worden war, wies keinerlei brauchbare Spuren auf. Der Burggraf stand breitbeinig über dem niedergedrückten Gras und ließ seine Augen aufmerksam über den Boden und die nähere Umgebung schweifen. Sein Gesicht verfinsterte sich von Minute zu Minute. »Der Teufel soll den Bischof holen«, knurrte er. »Hier gibt es nicht den geringsten Hinweis auf einen Dieb oder auf sonst jemanden.« Er drehte sich um und starrte mit zusammengekniffenen Augen auf die Behausungen der Eigenleute des Bischofs und die Häuser der Handwerker, die sich an den Rand des Marktplatzes schmiegten.
»Wenn der Angreifer nicht zufällig hier vorbeigekommen ist, dann muss er durch die Diebsgasse oder durch die Hohlgasse gekommen sein und sich hinter den Quartieren der Hörigen auf die Lauer gelegt haben.«
»Oder er kam über die Mauer vom Kirchhof«, warf Prosperius ein. »Ihr wisst doch, was für ein Gesindel sich nachts dort zuweilen trifft.«
Bandolf nickte. »Ja«, sagte er grübelnd. »Einer dieser Halunken könnte vom Friedhof aus über die Mauer geklettert und von dort aus zwischen dem Ostchor und den Häusern auf den Platz gelangt sein. Und was dann? Dann hat er Adalbert von Bremen über den Platz spazieren sehen und sich gedacht, ein Erzbischof gäbe wohl eine fette Beute ab?« Der Burggraf schnaubte. »Wenn es sich so verhalten hat und ich erwische den Kerl, dann lasse ich ihn zweimal baumeln. Einmal für seine Unverfrorenheit und ein zweites Mal wegen seiner Dummheit.«
Prosperius grinste. »Wieso nicht auch ein drittes Mal wegen des Ärgers, den er Euch macht?«
»Na schön«, sagte Bandolf ohne große Hoffnung. »Dann lass uns bis zur Friedhofsmauer gehen und sehen, ob es dort einen Hinweis gibt.«
Doch außer einer fliegenumsummten Pfütze mit Erbrochenem, in die Prosperius beinahe hineingetreten wäre, gab es auch dort nichts Auffälliges zu sehen. Die steinerne Mauer begrenzte von den beiden Osttürmen des Doms bis zur Andreasgasse hinunter den Kirchhof der Taufkirche St. Johannes. Zur Andreasgasse hin gab es eine Pforte, die nachts verschlossen wurde. Dicht an die Südfassade des Doms geschmiegt, konnte man das noch nicht ganz fertig gestellte, zehneckige Baptisterium mit seinem hohen Glockenturm sehen. Bandolf überlegte, ob es sich lohnen würde, den Kirchhof selbst zu begutachten, entschied sich aber dagegen. Vielleicht würde er zwischen den Holzkreuzen und Steinplatten der Gräber noch Spuren eines nächtlichen Gelages vorfinden, aber er bezweifelte, dass sie ihm Aufschluss über die Person liefern würden, die den Erzbischof von Bremen überfallen hatte.
»So hat das keinen Sinn«, rief er plötzlich ungehalten und schlug mit der Faust gegen den rotbraunen Backstein der Mauer. »Hier kommen wir nicht weiter, und ich muss auf dem Markt nach dem Rechten sehen. Nur weil ein Rheinfeldener Pfaffe meinen Kopf gerne auf einem Silbertablett serviert bekommen würde, kann ich nicht alle meine Pflichten vernachlässigen.«
Mittlerweile war der halbe Vormittag vorbei, und ihm knurrte der Magen. Wenn er Hunger hatte, wurde er übellaunig, und wenn er übellaunig war, konnte er nicht denken.
»Zeit, sich den Magen zu füllen, Prosperius«, verkündete er, und die Züge seines jungen, stets hungrigen Schreibers hellten sich auf.
»Geh nach Hause, und sag meinem Weib, dass ich beim Wirt am Markt speisen werde. Danach will ich Bruder Goswin im Kapitelhaus einen Besuch abstatten. Der Scholasticus kann mir vielleicht das eine oder andere über den Erzbischof von Bremen berichten. Vielleicht sehe ich dann klarer.« In Vorfreude auf eine dicke Scheibe weißen Brots mit Braten und dunkler, würziger Tunke und einen ordentlichen Schluck Bier rieb er sich den Bauch.
Prosperius, offenbar ebenfalls beflügelt vom Gedanken an eine große Schüssel Brei, die er der sonst so strengen Filiberta stets mühelos abschwatzen konnte, wandte sich zum Gehen. Aber Bandolf war mit seinen Anweisungen noch nicht fertig. »Nimm den Weg über die Hohlgasse zum Markt«, befahl er. »Beim Marktkreuz findest du einen Bauern mit Namen Boso. Ich habe ihn heute Nacht mit einem Knüppel in der Hand erwischt.«
»Dann nehme ich einen Büttel mit, der ihn zum Marktgericht bringt«, nickte Prosperius, doch der Burggraf winkte ab.
»Er soll mir einen Pfennig geben, und damit lass es gut sein.« Prosperius runzelte unzufrieden die Stirn, und Bandolf sah ihm an, dass er gerne widersprochen hätte, aber er ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Zuhause kannst du dich mit Werno der Leute annehmen, die heute schon ihren Michaelipfennig bringen. Und vergiss nicht, ein paar meiner Büttel zu den Stadttoren zu schicken. Besonders den Zöllnern an der Pfauenpforte und am Rheintor sollen sie auf die Finger schauen.« Er schüttelte den Kopf. »Nein, besser ist, wenn du selbst nach dem Rechten schaust. Letztes Jahr zu Michaeli haben sich die Zöllner fettgefressen von allem, was man ihnen heimlich zugesteckt hat.«
Über das Gesicht des jungen Schreibers huschte ein vergnügtes Lächeln und veranlasste Bandolf, streng hinzuzufügen: »Und dass du auch deine Finger bei dir lässt, hörst du? Ich will kein Zubrot in deinem Beutel finden.«
Prosperius versprach hoch und heilig, dass er gewiss nicht im Sinn hätte, arme Leute zu schröpfen. Bandolf gab sich damit zufrieden, und erst, als er Prosperius beschwingt die Hohlgasse hinunterstreben sah, kam ihm der ernsthafte Augenaufschlag seines jungen Schreibers verdächtig vor.
Hoffentlich hat er nun nicht im Sinn, die Reichen zu schröpfen, dachte er bei sich und seufzte.
Penelope, die Domkatze, rekelte sich im Gras hinter dem Kapitelhaus und streckte ihren wohlgefüllten Bauch der Herbstsonne entgegen. Markttage waren für die Katzen von Worms ebenso ergiebig wie für den Bischof oder den Burggrafen. Ratten und Mäuse tummelten sich zuhauf zwischen den Getreidesäcken der Bauern, und bei den Ständen mit Fleisch, Geflügel und Fisch lag immer ein unbewachtes Stück Leckerei herum, an dem eine flinke Katze sich laben konnte.
Weiter hinten bei den Gärten des Domstifts waren einige Brüder mit der Apfelernte beschäftigt. Ein paar arbeiteten auch im Kräutergarten, und der Wind trug ihr müßiges Geplauder, ihre Rufe und ihren Gesang bis zum Kapitelhaus herüber. Die Luft roch nach späten Wiesenblumen, aufgeworfener Erde und Obst. Dann wurde der Duft plötzlich von Schweiß und Weihrauch, Wein, scharfem Gewürz und gebratenem Fleisch überlagert.
Pothinus, der Kämmerer, und Osbert, der Cellerar des Domstifts, schlenderten über den Pfad auf den Grasflecken der Katze zu. Der Tonfall ihrer Stimmen schien Penelope zu missfallen, denn sie rollte sich flink herum und reckte mit angelegten Ohren den Kopf.
»Ihr braucht Eure Übellaunigkeit nicht an mir auszulassen, Bruder Kämmerer«, sagte Osbert mit weinseliger Stimme.
Pothinus rief erbost: »Meine Stimmung hat nicht das Geringste mit der Tatsache zu tun, dass aus dem Fass Mosler für den Bischof schon wieder ein Gutteil fehlt.«
»Wollt Ihr mir vielleicht unterstellen, ich hätte den Wein des Bischofs gestohlen?« Bruder Osbert reckte sich so hoch, wie es seine kurzen Beine erlaubten.
»Wer hat denn sonst noch Schlüssel zur Kellerei außer Euch und Propst Eginhard?«, fragte Pothinus spitz. »Und Eure Vorliebe für Wein stinkt geradezu zum Himmel.«
»Das ist eine infame Unterstellung. Und überhaupt: Was habt denn Ihr in meiner Kellerei zu suchen?«, schrie Osbert. »Noch seid Ihr nicht Dompropst.«
»Aber das könnte sich bald ändern«, sagte Pothinus mit Würde.
»Was Ihr nicht sagt. Seit bekannt ist, dass Bruder Eginhard nach Magdeburg geht, kriecht Ihr dem Bischof in den Hintern, damit er Euch das Amt des Propstes überträgt. Aber denkt daran, Kämmerer, wir anderen haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden.«
»Ich habe es nicht nötig, mich bei Bischof Adalbero einzuschmeicheln. Seine Eminenz ist ein Mann, der weiß, auf wen er sich verlassen kann. Er kennt meine Fähigkeiten und weiß sie zu schätzen. Vielleicht solltet Ihr das auch tun, wenn Ihr klug seid.«
»Oho«, höhnte der Cellerar. »Der Bischof weiß Eure Fähigkeiten so sehr zu schätzen, dass er es dem Burggrafen überlässt, den Überfall auf Adalbert von Bremen zu klären, anstatt die Sache Euch zu überlassen – dem Kämmerer.«
»Dann lasst Euch gesagt sein, Bruder Cellerar, dass es sehr wohl die Absicht des Bischofs gewesen ist, die Angelegenheit in meine Hände zu legen. Nur der König hat es anders bestimmt«, gab Pothinus zurück.
Osbert brach in Gelächter aus. »So ist das also«, gluckste er. »Da hat Euch der König einen Strich durch die Rechnung gemacht« – er versuchte sich an einem mitleidigen Lächeln –, »dabei wäre es Euch doch sicher zupassgekommen, wenn Ihr Euch gerade jetzt mit einem gefassten Beutelschneider vor dem Hof hättet großtun können.« Er lachte, bis ihm die Tränen kamen.
»Ihr wisst doch gar nicht, was Ihr da schwatzt«, erklärte Pothinus, raffte seine Robe und seine Würde zusammen, drehte sich um und stapfte mit hochgerecktem Rücken zum Kapitelhaus.
Osbert wischte sich die Lachtränen aus den Augen und blickte dem Kämmerer vergnügt hinterher. »Hochmut kommt vor dem Fall«, murmelte er.
Penelopes Nase zuckte, als er beschwingt an ihr vorbeiging, und sie folgte seiner bratenduftenden Robe auf leisen Pfoten.