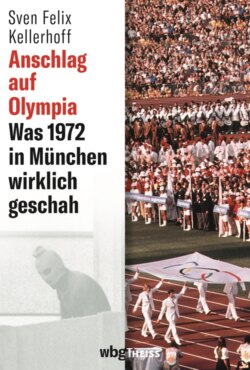Читать книгу Anschlag auf Olympia - Sven Felix Kellerhoff - Страница 10
1970 bis 1972 Sicherheit
ОглавлениеWährend die meisten Veranstaltungsorte der künftigen Spiele bereits im Rohbau waren, begannen sich die bayerischen Behörden Gedanken um die Sicherheit zu machen. Im Dezember 1969 erhielten die deutschen Botschaften in Rom, Tokio und Mexiko City den Auftrag, die Ausrichter der vergangenen drei Olympischen Sommerspiele um polizeiliche Erfahrungen zu bitten. Der Rücklauf war jedoch enttäuschend. Aus Rom meldete zunächst ein Diplomat eher allgemeine Erkenntnisse. Ihnen zufolge hatten Soldaten der italienischen Armee 1960 den Schutz der Olympia-Stätten übernommen, allerdings – damit es nicht zu martialisch wirkte – nicht in normalen Uniformen, sondern in spezieller Kleidung des Organisationskomitees. Das bestätigte ein nachgereichter Bericht der römischen Polizei.1 In Mexiko City hatte es 1968 derartige Zurückhaltung nicht gegeben, sondern im Gegenteil eine starke Militärpräsenz; nur zehn Tage vor Eröffnung der Spiele hatte das mexikanische Militär eine Demonstration linksgerichteter Studenten gewaltsam aufgelöst und dabei mindestens 25, nach anderen Angaben auch bis zu 300 Menschen getötet.2 Die umfangreichste Hilfe leistete die Polizei in Tokio, die der deutschen Botschaft einen Bericht übergab. Demnach waren die Sicherheitsmaßnahmen für die Spiele 1964 bereits vier Jahre vor Eröffnung geplant worden, sogar noch vor den Spielen in Rom. Es war eine eigene Behörde eingerichtet worden, die den Schutz organisiert hatte, freilich unter Leitung des Polizeipräsidenten, um Kompetenzkonflikte zu vermeiden. Insgesamt hatten während der Spiele in Tokio täglich rund 11 000 Polizisten in einem festen Dreischichtsystem Dienst, zuzüglich einer nicht genau bezifferten Zahl von Soldaten, die für die Sicherheit im Olympischen Dorf sorgten; die reguläre Polizei hatte dort nur in Ausnahmefällen Zutritt.3
Die bayerischen Behörden zogen aus den Erfahrungen der drei vorangegangenen Austragungsorte mehrere Schlüsse: Erstens war nun für die Vorbereitung – Polizeiangelegenheiten gehören laut Grundgesetz zu den Obliegenheiten der einzelnen Bundesländer – ein Sicherheitsbeauftragter im bayerischen Staatsministerium des Inneren zuständig, während der eigentliche Verantwortliche für die Sicherheit der Olympia-Stätten der Münchner Polizeipräsident als assoziiertes Mitglied des Organisationskomitees sein sollte. Die reguläre Polizei sollte im Olympischen Dorf lediglich in Form einer Kriminalwache mit Zivilbeamten präsent sein und sich um die Aufklärung der zu erwartenden kleineren Delikte kümmern. Um Erinnerungen an die von Hitler-Deutschland martialisch inszenierten und propagandistisch genutzten Spiele in Berlin 1936 zu vermeiden, würden Soldaten der Bundeswehr als Sicherheitskräfte keine Rolle spielen – sie waren lediglich als klar gekennzeichnete Fahrer, Helfer und Streckenposten vorgesehen.4
Zweitens sollten auch für den Schutz der Veranstaltungsorte und des Dorfes nicht uniformierte Polizeibeamte zuständig sein, sondern ein eigens gegründeter Ordnungsdienst, der im Auftrag des Organisationskomitees das Hausrecht auf dem Olympia-Gelände wahrnehmen sollte. Der Dienst sollte aus erfahrenen Polizisten bestehen, vor allem Polizeisportlern, denen man am meisten Verständnis für die Bedürfnisse der Athleten zutraute. Die Freiwilligen aus allen Bundesländern sollten in einem überlappenden Dreischichtsystem organisiert werden: Die eine Hälfte der Tagschicht arbeitete von sieben Uhr morgens bis 19 Uhr abends, die andere von acht bis 20 Uhr. Die Nachtschicht war von 19 oder 20 Uhr bis sieben oder acht Uhr im Dienst; nach jeweils zwölf Stunden Einsatz folgten 24 Stunden Ruhe.5 Dieses Modell, das vier Tage vor der Eröffnungsfeier beginnen und drei Tage nach der Schlussfeier enden, also insgesamt gut drei Wochen dauern sollte, führte zwar zu einer großen Zahl an Überstunden, hielt aber dennoch die Belastung der Ordner in erträglichen Grenzen, zumal die Mitglieder des Ordnungsdienstes zum großen Teil am Rande des Olympischen Dorfes untergebracht werden würden. Da in München anders als in Tokio die meisten Anlagen nahe beieinander lagen, schienen knapp 2000 Mann und 40 Frauen für die Sicherheit der Athletinnen als Stärke des Ordnerdienstes ausreichend.6
Drittens setzte das Organisationskomitee auf maximale Deeskalation. Die Mitglieder des Ordnungsdienstes sollten grundsätzlich unbewaffnet sein und möglichst fröhlich wirken, weshalb sie eigens entworfene Uniformen in hellblau mit weißen Hemden und Mützen erhielten. Ferner übten sie polizeiuntypische Taktiken: potenzielle Störer durch Klamauk verunsichern, mit Süßigkeiten beschießen oder sie im Falle eines Falles umringen und sanft abdrängen.7
Während Bayerns Behörden dieses Konzept erarbeiteten, änderte sich die Sicherheitslage jedoch erheblich. 1968/69 hatte es erstmals zwei Flugzeug-Entführungen durch palästinensische Terroristen gegeben; beide waren vom Flughafen Rom ausgegangen. Am 10. Februar 1970 kam diese Form politischer Kriminalität in Deutschland an: Während der Zwischenlandung einer Linienmaschine der israelischen Gesellschaft El Al in München-Riem auf dem Flug nach London versuchten drei bewaffnete Palästinenser, im Transitraum und im Zubringerbus Passagiere in ihre Gewalt zu bringen. Doch der Pilot, ein Hüne von 1,98 Meter, wehrte sich, und auch andere Israelis verwickelten die Angreifer in einen Kampf. Bevor die Attentäter festgenommen wurden, warfen sie noch mehrere Handgranaten. Eine davon, die einer der Entführer in den gefüllten Flughafenbus schleuderte, tötete einen 32-jährigen Mann, der sich auf sie geworfen hatte, um seine Mitreisenden zu retten. Eine weitere verwundete den Flugkapitän sowie eine Passagierin schwer.8 Insgesamt gab es elf Verletzte; die drei Täter konnten von Beamten der bayerischen Grenzpolizei, die auf dem Flughafen zuständig waren, überwältigt werden. Die Presse schrieb von der „ersten Schlacht des Nahostkrieges auf deutschem Boden“ und dass „die Guerillas (…) ihren Krieg gegen Israel sogar bis nach Europa getragen“ hätten.9
Eine Woche später wurden ebenfalls in Riem drei Araber festgenommen, bevor sie bewaffnet in den Transitraum gelangen konnten; dort befanden sich abermals Passagiere der Linienmaschine von Tel Aviv nach London. Diese drei hatten einen Zettel mit dem Befehl bei sich: „Wir verlangen sofortige Startfreiheit, oder wir jagen das Flugzeug mit Handgranaten in die Luft.“10 Für beide Anschläge, den versuchten und den rechtzeitig verhinderten, übernahm eine Gruppe namens „Aktionsgemeinschaft zur Befreiung Palästinas“ die Verantwortung.
Die Anschlagswelle ging weiter. Gleich 47 Tote forderte die Explosion einer Bombe im Laderaum eines Swissair-Jets am 21. Februar 1970; eine zweite, fast zeitgleiche Explosion an Bord einer Austrian-Airlines-Maschine ging glücklicherweise ohne Opfer ab. Die Bomben hatten sich in Luftpostpaketen nach Israel befunden und waren in Frankfurt und Zürich versehentlich nicht wie geplant in El-Al-Maschinen, sondern in Jets aus Österreich und der Schweiz geladen worden. Verantwortlich war abermals eine Zelle palästinensischer Terroristen in Deutschland; offiziell bekannte sich das „PFLP-Generalkommando“ zu den Anschlägen.11
Das Bundesamt für Verfassungsschutz schloss in seinem Bericht über das Jahr 1971: „Die radikalsten palästinensischen Widerstandsgruppen versuchen nach wie vor, sich durch Terroranschläge außerhalb des nahöstlichen Krisengebietes neue Publizität zu verschaffen und ihren zum Teil verloren gegangenen Einfluss bei den Palästinensern wieder zurückzugewinnen.“ Es gebe auch, nach einem zeitweiligen Rückgang, „Anzeichen für eine Reaktivierung des palästinensischen Widerstandes im Bundesgebiet“.12
Die intensive Aktivität antiisraelischer Gewalttäter in Mitteleuropa war nicht die einzige neue Entwicklung parallel zu der Vorbereitung der Münchner Sommerspiele. Mitte Mai 1970 wurde in West-Berlin der Linksextremist Andreas Baader gewaltsam aus der Haft befreit; wenige Wochen später setzte er sich zusammen mit Gesinnungsgenossen in den Nahen Osten ab, und Ende September 1970 zeigten drei gleichzeitige Banküberfälle wieder in der geteilten Stadt, dass nun auch mit einem potenziell mörderischen Terrorismus deutscher Provenienz zu rechnen war. Unter dem selbst gewählten Namen „Rote Armee Fraktion“ überzogen diese Aktivisten die Bundesrepublik fortan mit Straftaten.
Nicht nur vermeintlich politisch motivierte Gewalt, sondern ebenso rein kriminelle Täter setzten die Polizei unter Druck. Am 4. August 1971 stürmten kurz vor 16 Uhr zwei maskierte Bewaffnete die Filiale der Deutschen Bank in der Prinzregentenstraße 70 im Münchner Stadtteil Steinhausen und nahmen Bankangestellte wie Kunden als Geiseln.13 Sie nannten sich „Rote Front“, was die Polizei aber nur verwirren sollte, forderten zwei Millionen Mark Lösegeld bis 22 Uhr und drohten, andernfalls die Bank mit den Geiseln zu sprengen. Die Polizei sperrte die direkte Umgebung ab, besorgte das verlangte Lösegeld und einen Fluchtwagen.
Die Einsatzleitung vor Ort zog, obwohl Polizeipräsident Schreiber und sein Vize Georg Wolf anwesend waren, ein forscher Oberstaatsanwalt an sich; er setzte darauf, die Täter beim Verlassen der Bank ausschalten zu lassen. Doch die Münchner Polizei verfügte nicht über entsprechend ausgebildetes Personal. Also wurden mehrere als Jäger bekannte Beamte in eine Kiesgrube beordert und übten dort mit den im Präsidium vorhandenen Sturmgewehren des Bundeswehr-Typs G-3, für die sie immerhin Zielfernrohre hatten.14 Am späten Abend lagen sechs derartig fortgebildete Beamte auf Positionen rund um die Bank bereit. Kurz vor Mitternacht erschien einer der beiden Täter, prüfte das Lösegeld und ging auf den Fluchtwagen zu, in dem bereits eine junge Frau als Geisel saß.
Der Plan hatte vorgesehen, ihn dabei kampfunfähig zu schießen und unmittelbar danach die Bank gleichzeitig von vorne und von hinten zu stürmen, um den zweiten Geiselnehmer zu überwältigen. Doch das Blitzlichtgewitter der anwesenden Fotografen (die Absperrung betraf nur die beiden nächstgelegenen Nebenstraßen; auch waren die Häuser gegenüber der Bank nicht evakuiert worden) blendete die Schützen, die zudem keinen Funkkontakt untereinander hatten und deshalb wenige Sekunden lang orientierungslos waren. Erst als der Täter an der Autotür stand, fiel ein Schuss, und er ließ sich getroffen auf den Sitz fallen. Daraufhin begann eine wilde Schießerei auf den Wagen, während der fast 200 Patronen abgefeuert wurden. Der Täter und die Geisel erlitten dabei so schwere Verletzungen, dass sie wenig später starben.15
Auch der Sturm auf die Bank geriet zu einem Fiasko: Das Kommando im Hof brauchte mehrere Minuten, um die Tür zur Bank aufzubrechen, und für die Männer auf der Prinzregentenstraße erwies sich die stabile Scheibe der Filiale als fast unüberwindlich. Glücklicherweise nutzte der zweite Täter in der Bank die Gelegenheit nicht, auf die noch in seiner Gewalt verbliebenen Geiseln zu schießen.16
Aus dem Desaster bei diesem ersten Banküberfall mit Geiselnahme in der Bundesrepublik zog das Polizeipräsidium München die Konsequenz, einigen als gute Schützen bekannten Beamten eine rudimentäre Ausbildung an den Sturmgewehren im Arsenal zu genehmigen; sie galten fortan intern als Präzisionsschützen. Weiteres folgte jedoch nicht, weder die Aufstellung einer speziellen Einheit für solche Situationen – Polizeipräsident Schreiber war gegen eine derartige Truppe, „denn die würde ja das ganze Jahr über Schafkopf spielen“ – noch die Anschaffung geeigneter Funktechnik für die Schützen.17 Allerdings bemühte sich auch kein anderes Land der Bundesrepublik als Schlussfolgerung aus den Münchner Ereignissen darum, Polizisten in Taktiken zur gewaltsamen Geiselbefreiung auszubilden, ebenso wenig der Bundesgrenzschutz.18
Als das Jahr der Spiele begann, veröffentlichten das Zeit-Magazin und der Spiegel, beide in Hamburg ansässig, sehr ähnlich gestimmte Polemiken gegen das Projekt Olympia. Der ehemalige Münchner Lokalreporter Peter Schille schrieb sich in der Ausgabe des Zeit-Magazins vom 7. Januar 1972 offenbar enormen Frust über die Veränderungen in seiner früheren Heimat von der Seele: München sei „unheimlich“ geworden, die „Faszination der Stadt, der einst Thomas Mann bescheinigte, dass sie leuchte“, sei „erloschen“. Vielmehr handele es sich um „Deutschlands dreckigste Metropole, schmutziger als Bochum und lauter als Berlin. Mediziner, Statistiker und Beerdigungsunternehmer wissen: Wer in München lebt, stirbt früher.“ Für die Sommerspiele wolle sich die Stadt „noch einmal als Glamour-City zur Schau stellen“, jedoch werde „unter all dem Glanz und Glimmer sichtbar werden, dass München seinen Charme verkauft und seine Atmosphäre vergiftet“ habe: „Die Weltstadt mit Herz ist eine Allerweltsstadt geworden.“ In selben Stil ging es weiter, zehn Magazinseiten mit großformatigen und erschreckend scheußlichen Fotos lang. Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel habe ungefähr alles falsch gemacht, was falsch zu machen war: Die U-Bahn sei ein „Riesenspielzeug“, das Innenstadtquartier Maxvorstadt „entvölkert“ und der Boulevard Maximilianstraße „ruiniert, um den Autos Platz zu schaffen“. Über das Olympiagelände schrieb Schille: „Im Zeichen der Olympischen Ringe wurde ein monströser Bauboom entfesselt. Die meisten Apartments beim Oberwiesenfeld können sich nur Reiche leisten.“19
Nicht ganz so grotesk verzeichnet, aber immer noch ausschließlich negativ gestimmt schrieb der Spiegel in seiner zeitgleich mit der „Reportage“ des Zeit-Magazins entstandenen Titelgeschichte am 9. Januar 1972: „Die Isar-Metropole erhoffte sich von diesem Milliarden-Schub einen kommunalen ,Investitionssprung von zwanzig Jahren‘ – doch schon jetzt wird sichtbar, dass der Vor-Sprung die Plagen von heute nicht beseitigt: Verkehrschaos, Luftverpestung, City-Verödung.“ Der Artikel, nach damaliger Praxis im Spiegel nicht namentlich gezeichnet, malte die Hoffnungen der Verantwortlichen aus: „Allzu verlockend schien die Chance, dass mit der aufwendigen Inszenierung der Spiele in wenigen Jahren für die Stadt bewerkstelligt werden könne, wozu man sonst Jahrzehnte benötigt haben würde: städtebauliche Sanierung alter City-Viertel, Finanzierung neuer städtischer Schnellstraßensysteme, beschleunigter Bau einer U- und S-Bahn, Errichtung längst notwendiger städtischer Sportstätten und einer citynahen Musterstadt mit Kirche und Kegelbahn, Facharzt-Zentrum und Fernsehturm.“ Allerdings seien diese Hoffnungen enttäuscht worden: „Längst ist erkennbar, dass der unmittelbare kommunale Zugewinn für München wesentlich bescheidener ist, als die Olympia-Funktionäre weismachen möchten.“ Stattdessen habe sich „der Verdacht verdichtet, dass der von Olympia-Optimisten verheißene Vor-Sprung ins nächste Jahrzehnt und die Milliarden-Reklame der Spiele München nur noch schaden können“. Die Metropole sei „verpestet“, habe die höchste Krebssterblichkeit in der Bundesrepublik und könnte dennoch bis 1990 zur „Megalopolis von fast drei Millionen Menschen“ werden. Der Widerspruch von vermeintlich besonders schlechten Lebensbedingungen und der gleichzeitig angeblich extremen Anziehungskraft störte die Spiegel-Autoren nicht.20 Oberbürgermeister Vogel schon; er nannte den Artikel in einem Leserbrief treffend und noch moderat ein „Zerrbild“, das den „Kampf um reale Reformen zumindest nicht erleichtert wird“.21
Ungeachtet solcher publizistischen Attacken gingen die Vorbereitungen weiter. Im Februar 1972 stellte der Polizeipsychologe Georg Sieber dem Ordnungsreferat des Organisationskomitees mehrere fiktive „Lagen“ vor, auf die sich der Ordnungsdienst während der Spiele vorbereiten solle. Sie orientierten sich an polizeilichen Problemen, die in den vergangenen Jahren tatsächlich aufgetreten waren, zum Beispiel Sitzblockaden, die den Verkehr aufhielten und zu Schlägereien von Autofahrern mit Demonstranten eskalierten, oder dem Absturz eines Passagierflugzeuges in der Innenstadt; beides war tatsächlich in den vorangegangenen Jahren in München geschehen.22
Späteren Aussagen Siebers zufolge zählte zu den geschilderten Szenarien auch die „Lage 21“, ein Überfall palästinensischer Terroristen auf das Olympische Dorf vor Tagesanbruch, die Geiseln nehmen würden, um Gefangene freizupressen. Mit Verhandlungen käme man da nicht weiter. Nach Darstellung des Psychologen kanzelte Schreiber dieses Szenario etwa mit den Worten ab: „Das steht jetzt hier nicht auf der Agenda. Das brauchen wir nicht.“23 Stadionsprecher Joachim Fuchsberger berichtete von drastischeren Worten; demnach habe der Polizeipräsident gesagt: „Polizeipsychologen sind dazu da, dass man sie erschlägt“ und Gelächter geerntet.24 Angeblich sei dieser „Plan 21“ nach dem 5. September 1972 von der Münchner Polizei beschlagnahmt worden und danach spurlos verschwunden.25 In Wirklichkeit wurde diese „Lage“ dem Ordnungsreferat offenbar gar nicht vorgestellt, sondern lediglich im Rahmen von Siebers eigener Runde, der „Poko-Studiengruppe“, als „Modell erwogen“. Es sei jedoch „nach Diskussion von allen Beteiligten in der Poko nicht weiter verfolgt“ worden.26
Offenbar hatte Sieber als Gegenmaßnahme vorgeschlagen, die Täter psychologisch zu verwirren: „Verfremdung der Tatortumgebung durch auffällig kostümierte Frauen, Vernebelung oder starke Berieselung des Tatorts, Abdecken des überfallenen Hauses durch Tarnnetze“. Den Terroristen müssten für jede Aktion rationale, plausible Erklärungen geliefert werden, etwa: „Ein großes Folklorefest im Dorf habe nicht mehr abgesagt werden können, im belagerten Haus bestehe Brandgefahr, oder: Die Israelis hätten eine Gegenaktion angekündigt.“27 Laut einer anderen Quelle habe Sieber vorgesehen, „den Attentätern zu erklären, dass aufgebrachte Menschenmassen versuchten, das Haus zu stürmen. Man hätte dann den Tätern erklären sollen, dass es zu ihrem eigenen Schutz eingenebelt werden müsse. In dieser Situation wäre die Befreiung möglich gewesen“.28
Was immer es genau mit Siebers angeblichem „Plan 21“ auf sich hatte: In die konkrete Vorbereitung des Ordnungsdienstes wurde ein möglicher Guerillaangriff auf ein Mannschaftsquartier im Olympischen Dorf nicht aufgenommen. Sehr wohl hingegen machte man sich Gedanken über Anschläge auf „Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens“, die „aufgrund ihrer politischen oder gesellschaftlichen Stellung bzw. der Lage in ihrem Heimatland als Angriffsziele für Attentate oder Attentatsversuche infrage kommen könnten“. In einem solchen Falle sei es „oberste Aufgabe der Kräfte (…), Leben und Gesundheit der gefährdeten Personen zu schützen bzw. zu retten.“29
Nicht einmal, als die RAF im Mai 1972 sechs Bombenanschläge beging, die vier Menschen töteten, mehr als 50 teilweise lebensgefährlich verwundeten und die Bundesrepublik in helle Aufregung versetzten, wich die Münchner Polizei von der Erwartung ab, Attentate drohten vor allem bestimmten Zielpersonen.30 Dabei detonierte auch vor dem Landeskriminalamt in München so eine Ladung und verletzte sieben Menschen schwer, darunter einen zehnjährigen Jungen. Im Bekennerschreiben hieß es: „Die Taktik und die Mittel, die wir anwenden, sind die Taktik und die Mittel des Guerilla-Kampfes.“31 Möglicherweise hielt man diese Bedrohung für erledigt, denn im Juni 1972 konnte die Polizei die gesamte Führung der RAF festnehmen; gefahndet wurde danach lediglich noch nach Randfiguren. Doch der Schluss der Sonderkommission Baader-Meinhof des BKA war allzu optimistisch: „Es bleibt zu hoffen, dass bewaffnete Gewalt und Terror sich als Mittel der politischen Auseinandersetzung in unserem Lande nicht wiederholen.“32
Die RAF hatte nie direkt mit Anschlägen gegen die Sommerspiele gedroht, doch in linksradikalen Kreisen der Bundesrepublik galt Olympia 1972 als Feindbild. Ein „Antiolympisches Komitee“ in Frankfurt kritisierte, es handele sich bei den Sommerspielen um eine Veranstaltung, „die das System erhält und die Menschen kaputt macht“.33 Die Splittergruppe Kommunistischer Bund agitierte: „Unter dem Vorwand, ein reibungsloses Ablaufen der Sommerspiele gewährleisten zu müssen, bietet sich den Bonner Machthabern sogleich die Gelegenheit, ein weiteres Mal den Notstand zu proben.“34 Der maoistische Kommunistische Jugendverband Deutschlands brachte ein Extrablatt heraus, in dem es hieß: „Der westdeutsche Kriegstreiberstaat ruft die Jugend der Welt und spielt sich als friedliebender Völkerfreund auf. Nach München kommt alles, was Rang und Namen hat in den Reihen der internationalen Konterrevolution.“35 Münchens Polizei rechnete angesichts solcher meist als Flugblätter verbreiteter Parolen mit Verstößen gegen das während der Spiele geltende Demonstrationsverbot, aber nicht mit bewaffneten Angriffen auf das Olympische Dorf oder auf Sportler.
Zumal die Kritiker bemerkenswert schlecht informiert waren. So kritisierte drei Wochen vor der Eröffnung der Spiele die Rote Fahne, ein Blatt der ebenfalls maoistischen Kleinpartei KPD/ML-ZB aus Bochum, die Spiele würden außer von der Bundeswehr „von 5000 Mann Polizei aus allen Bundesländern, von tausend Mann Bundesgrenzschutz und weiteren Spezialeinheiten bewacht“.36 In Wirklichkeit gab es jedoch gerade keine „Spezialeinheiten“, sondern einen bewusst unbewaffneten Ordnungsdienst.
Bei den Behörden gingen im Vorfeld der Spiele „eine Vielzahl von Mitteilungen ein, in denen die verschiedensten Störungen und Aktionen mit politischem Hintergrund in einem ausdrücklichen, zu vermutenden oder doch nicht auszuschließenden Zusammenhang mit den Olympischen Spielen, seinen Teilnehmern und Besuchern angekündigt waren“, berichtete das bayerische Innenministerium: „Die überwiegende Menge der Informationen kündigte Aktionen von links- und rechtsextremen deutschen Gruppen oder namentlich genannten Einzeltätern an, vereinzelt wurden auch Ausländerorganisationen als mögliche Störer genannt.“ Doch die allermeisten dieser Warnungen enthielten keine konkreten Angaben; lediglich bei 15 Hinweisen ließen sich die vorgesehene Tatzeit (z. B. während der Eröffnungsfeier) und bei fünf das mögliche Zielobjekt (z. B. das Stadion) einigermaßen eingrenzen: „Keine Information enthielt einen spezifischen Hinweis auf eine Gefährdung israelischer Sportler oder israelischer Einrichtungen im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen.“ Die für die Mannschaft aus Israel vorgesehenen Quartiere in der Connollystraße waren einem „israelischen Sicherheitsattaché“ am 9. August 1972 gezeigt worden: „Die Gesprächspartner waren sich einig, dass keinerlei konkrete Hinweise auf Störungen oder Attentatsabsichten gegenüber israelischen Sportlern oder Besuchern vorlagen. Unzufriedenheit des israelischen Sicherheitsbeauftragten mit dem Umfang der vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen war nicht erkennbar.“37
Irgendwann im Frühjahr 1972 entstand im Nahen Osten, mutmaßlich in Beirut oder auch in Tunis, jedoch eine wirkliche Bedrohung für die Spiele. Die nach ihrer blutigen Vertreibung aus Jordanien im September 1970 hauptsächlich in diesen beiden Hauptstädten ansässige PLO verlangte in Briefen an das IOC angeblich, eine Mannschaft Palästinas zu den Sommerspielen in München einzuladen. Das jedenfalls berichteten zwei führende Funktionäre, der PLO-Geheimdienstchef Abu Iyad und Abu Daoud, ein ehemaliger Lehrer, der im Auftrag von PLO-Chef Jassir Arafat Terroranschläge organisierte.38 Da dieses Begehren schon wegen der Nichtexistenz eines palästinensischen Nationalen Olympischen Komitees irreal war, wurde es offenbar (falls es denn überhaupt wirklich gestellt wurde) nicht ernst genommen und hinterließ jedenfalls keine Spuren im IOC-Archiv in Lausanne und in der internationalen Presse.39
Abu Iyad und Abu Daoud holten sich Arafats Einverständnis für einen spektakulären Anschlag in München und begannen Ende Juni 1972 mit den Vorbereitungen. Den Leiter des Terrorkommandos und einen Stellvertreter hatten die beiden PLO-Funktionäre bereits ausgewählt: Beide sprachen Deutsch und hatten mehrere Jahre lang in der Bundesrepublik oder West-Berlin gelebt, als Studenten; beide waren Ende zwanzig.40 Hinzu kommen sollten sechs Kämpfer – fanatische junge Palästinenser aus den Flüchtlingslagern als reine Befehlsempfänger. Wahrscheinlich erhielten sie ihre Ausbildung in Terrorcamps in Libyen.41
Als Helfer in der Bundesrepublik gewannen die PLO-Funktionäre einen Deutschen aus dem Umfeld des Antisemiten und propalästinensischen Rechtsextremisten Udo Albrecht: Willi Pohl. Anfang Juli 1972 traf sich Abu Daoud in Dortmund das erste Mal mit Pohl; dieser Kontakt wurde deutschen Polizeibehörden spätestens am 12. Juli 1972 bekannt.42 Der 28-jährige Kriminelle reiste nach Beirut, verpflichtete sich der PLO und kehrte angeblich im Ehrenrang eines „Obersten“ nach Deutschland zurück. Hier stellte er den Kontakt zu einem geübten Passfälscher her und beschaffte drei Autos. Abu Daoud ließ sich von ihm nach Frankfurt und Köln chauffieren, wo der PLO-Mann andere Araber traf; Pohl saß dabei, verstand aber kein Wort. In Köln waren es „elegante Leute“, sodass er vermutete, es könnte sich um Diplomaten der libyschen Botschaft in Bonn gehandelt haben. Pohl begleitete aber nicht nur Abu Daoud, er erledigte auch selbstständig Botengänge, fuhr zum Beispiel nach Paris und überbrachte einem Palästinenser eine in arabischer Sprache verfasste Nachricht; wahrscheinlich handelte es sich um den späteren Anführer des Terrorkommandos.43 Vermutlich transportierte Pohl auch die Waffen für den Überfall, etwa ein Dutzend Kalaschnikow-Sturmgewehre und anderthalb Dutzend Handgranaten.44 Sie kamen wenige Tage vor der Eröffnung der XX. Sommerspiele in München an.
Derweil war ein Hinweis beim Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz eingegangen: Palästinensische Terroristen könnten während der Spiele einen „Zwischenfall“ inszenieren. Das sei „im Ausland“ in Erfahrung gebracht worden, hieß es weiter. Bei der Quelle handelte es sich um einen Journalisten in Beirut. Ein deutscher Beamter, entweder beim Bayerischen oder beim Bundesamt für Verfassungsschutz, fügte hinzu, solche öffentlichkeitswirksamen Aktionen passten zum Profil palästinensischer Terrorgruppen.45 Allerdings wurde diese Mitteilung offenbar nicht an das Münchner Polizeipräsidium weitergegeben.
Jedenfalls war Manfred Schreiber und Georg Wolf davon nichts bekannt, als es am 24. und 25. August 1972 noch einmal Erörterungen der Sicherheitslage mit Vertretern Israels gab – obwohl ein Vertreter des Verfassungsschutzes anwesend war. Zu den Besprechungen gehörte auch eine erneute Ortsbesichtigung in der Connollystraße; diskutiert wurden ferner der Schutz der Israelis im Jugendlager, die Sicherheit israelischer Journalisten und des ihnen zugewiesenen Studios 4 im DOZ sowie die Organisation des geplanten Gottesdienstes zum jüdischen Neujahrsfest am 8. September im religiösen Zentrum des Olympischen Dorfes.46 Unzufriedenheit mit den Vorbereitungen oder besondere Wünsche der Vertreter Israels wurden nicht protokolliert.