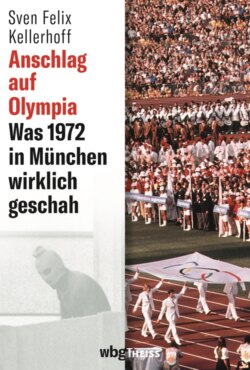Читать книгу Anschlag auf Olympia - Sven Felix Kellerhoff - Страница 9
1965 bis 1970 Hoffnung
ОглавлениеDer Termin war ganz kurzfristig verabredet worden. Durchaus unüblich hatte Willi Daume, seit 1961 Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Deutschlands, telefonisch um ein baldiges Treffen mit Hans-Jochen Vogel gebeten, dem sozialdemokratischen Oberbürgermeister von München. Am 28. Oktober 1965 kam der Besucher ins Münchner Rathaus, um das Stadtoberhaupt für seinen Plan zu gewinnen: Die bayerische Metropole solle sich um die Austragung der Sommerspiele 1972 bewerben. Vogel, der in den gut fünfeinhalb Jahren seiner bisherigen Amtszeit eine Modernisierung der Stadt wie nie zuvor eingeleitet hatte, „verschlug es zunächst einmal den Atem“. Dann fragte er Daume, ob dieser nicht wisse, „dass in München im Grunde keine einzige der Einrichtungen vorhanden sei, die man für Spiele brauche“? Dem IOC sei der Bau neuer Anlagen ohnehin lieber als die Modernisierung bestehender Stadien, lautete die entwaffnende Antwort.1
Doch die notwendigen Gebäude waren keineswegs das einzige Problem: Gerade erst drei Wochen zuvor hatte das IOC auf seiner Sitzung in Madrid beschlossen, dass es künftig zwei Nationale Olympische Komitees in Deutschland geben dürfe, das bisherige NOK und zusätzlich ein „Ostdeutsches NOK“. Der politische Druck des Ostblocks, die politische Realität zweier verschiedener Staaten auf deutschem Boden anzuerkennen, war zu groß geworden. Der gleichzeitige Beschluss, dass zwar zwei deutsche Teams an den nächsten Olympischen Spielen in Mexiko 1968 teilnehmen sollten, jedoch unter einer gemeinsamen Flagge in Schwarz-Rot-Gold mit den fünf olympischen Ringen und mit Beethovens „Ode an die Freude“ als Hymne, enttarnte den Kompromiss, der dahintersteckte.2
In der Bundesrepublik, die zu dieser Zeit noch den Anspruch erhob, international für ganz Deutschland zu sprechen, war diese Entscheidung als Niederlage empfunden worden; im Vorfeld war sogar für den Fall einer Anerkennung der DDR über einen Boykott der Spiele 1968 durch bundesdeutsche Sportler nachgedacht worden.3 Das konnte durch den Kompromiss immerhin vermieden werden. Daume hatte seine Niederlage offen eingestanden und den Blick gleich wieder nach vorne gerichtet: „Es gibt Wichtigeres als die gesamtdeutsche Olympia-Mannschaft, zum Beispiel den gesamtdeutschen Sportverkehr für alle“, hatte er noch in Madrid gesagt.4 Doch er hatte noch mehr vor: Der NOK-Präsident wollte den Ärger der Unterstützer seiner Position nutzen, um die Sommerspiele 1972 in die Bundesrepublik zu holen. Westdeutschland habe im IOC viele Freunde, gerade nach der Niederlage in Madrid. Sie wollten etwas für das Land tun. Und zudem läge auch sonst keine ernsthafte Bewerbung vor.
Seinen Gesprächspartner Vogel überraschte Daumes Sicht; er bezweifelte, dass „auch nur die geringste Aussicht bestehe, die Spiele in die Bundesrepublik – und dazu noch in die ehemalige ,Hauptstadt der Bewegung‘ zu bekommen“.5 München vom Stigma zu befreien, Gründungsort und bis 1945 Sitz der Zentrale der NSDAP gewesen zu sein, gehörte zu den international herausforderndsten Aufgaben des mit gerade einmal 39 Jahren noch jungen Oberbürgermeisters. Schon 1962 hatte er deshalb mittels eines Bürgerwettbewerbs einen Image-Slogan suchen und finden lassen: „München – Weltstadt mit Herz“.6 Vogel glaubte auch nicht an einen Erfolg, weil die Entscheidung des IOC bereits bei der nächsten Sitzung in Rom Ende April 1966 anstand; die Frist für die Abgabe von Bewerbungen endete sogar schon am 30. Dezember 1965. Das hieß: Gerade einmal 63 Tage, um ein Konzept zu entwickeln und politische Unterstützung zu organisieren.
Weil dem Juristen Vogel jedoch die für viele Absolventen seines Studienfachs typische Neigung zur Bedenkenträgerei völlig abging, machte er sich ans Werk. Mit Daume hatte er vereinbart, nur möglichst wenige Menschen von dem Vorhaben zu informieren, um ein vorzeitiges Zerreden des Planes durch Presse und Fernsehen zu vermeiden. Am folgenden Tag beriet er sich mit den wichtigsten Mitgliedern der Stadtregierung und erhielt das „Münchner Jawort“.7 Anschließend flog Vogel nach Berlin, um mit dem Regierenden Bürgermeister und SPD-Vorsitzenden Willy Brandt zu sprechen, denn gegen das Votum des Senates der geteilten Stadt würde es eine Bewerbung nicht geben können. Doch Brandt wusste, dass die in der Öffentlichkeit immer wieder diskutierten Pläne für eine gemeinsame Bewerbung von West- und Ost-Berlin politisch irreal waren; daher sagte er dem Besucher aus München volle Unterstützung zu. Zwei weitere Gespräche musste Vogel noch führen, bevor die Bewerbung öffentlich werden durfte: mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel und mit Bundeskanzler Ludwig Erhard. Den CSU-Politiker gewann der dynamische Oberbürgermeister schnell, und auch in Bonn zeigte man sich offen für die Idee. Am 29. November 1965, gerade einen Monat nach Daumes überraschendem Angebot, kam es zum Treffen im hochmodernen Kanzler-Bungalow. Vogel, Goppel und der NOK-Chef stellten den Plan vor, der inzwischen vertraulich im Münchner Rathaus erarbeitet worden war und Gesamtkosten von 550 Millionen Mark vorsah, die zwischen Stadt, Land und Bund gedrittelt werden sollten. Doch jetzt stieß das Vorhaben auf die Bedenken eines Juristen, denn der Kanzleramtschef wehrte sich entschieden gegen eine Olympia-Bewerbung: „Ludwig Westrick widersprach lebhaft, bezweifelte die Kostenschätzungen und erinnerte den Bundeskanzler daran, dass er in einer Stunde im Bundestag eine schwere Auseinandersetzung über die Reduzierung von Leistungen zu bestehen habe, die vor den Wahlen versprochen worden seien.“ Erhard schwankte zunächst, doch ein erneutes Plädoyer von Daume und Vogel beeindruckte ihn. Als Westrick ihn daraufhin am Ärmel zupfte und durch Gesten zu verstehen gab, der Regierungschef möge keinerlei Zusagen machen, reagierte der Kanzler unwillig auf dieses Zaudern und sagte sinngemäß, „man könne nicht immer nur Trübsal blasen und dem Volk Unerfreuliches ankündigen, es müsse auch einmal etwas Erfreuliches geschehen“.8 Deshalb sei er gerade jetzt für die Olympischen Spiele. Die Bundesregierung werde ihren Kostenanteil innerhalb von sechs Jahren wohl aufbringen können.
Am selben Abend verkündete Vogel die Bewerbung Münchens auf einer Pressekonferenz – und erntete vor allem Skepsis bis Ablehnung. Sieben Ruhrgebiets-Städte meldeten eine gemeinsame Kandidatur an, Hannover zeigte gleichfalls Interesse, und Gerhard Stöck, Leiter des Sportamtes der größten westdeutschen Stadt Hamburg, lehnte das Projekt rundheraus ab: „Die deutsche Bewerbung um die Spiele von 1972 überrascht mich sehr, mit Münchens Antrag hatte ich nie gerechnet. Für mich ist nur Berlin als einzige deutsche Stadt olympiareif.“ Dahinter steckte wohl die Sorge, dass die Hoffnung der Hansestadt auf eine eigene Bewerbung für die Sommerspiele 1976 oder 1980 unterminiert werden könnte. Ganz richtig erkannte Stöck, selbst Olympiasieger 1936 sowie bei den Spielen 1956 und 1960 Chef der gesamtdeutschen Teams, was Vogels längerfristiges Ziel war: „Ich habe allerdings auch den Verdacht, dass man sich in der bayerischen Metropole bei einer solchen Bewerbung endlich die Einrichtung repräsentativer Sportanlagen mit einem Schlag verspricht.“9
Immerhin endete diese Diskussion im Wesentlichen wenige Tage später, als Erhard seinen Sprecher klarstellen ließ, dass Bonn ausschließlich die Kandidatur der bayrischen Landeshauptstadt unterstützen werde: „Die Bundesregierung, das Land Bayern und die Stadt München sind der Auffassung, dass die Austragung der Olympischen Spiele auf deutschem Boden eine dem nationalen Prestige dienende Aktion ist, die die weite Unterstützung der Bevölkerung findet.“10
Damit war aber lediglich die erste Hürde genommen, denn nun galt es noch, das IOC von Münchens Bewerbung zu überzeugen. Die Chancen stiegen jedoch, als Wien im Januar 1966 seine in Aussicht gestellte Bewerbung zurückziehen musste – die österreichische Regierung hatte sich nicht in der Lage gesehen, das notwendige Geld zur Verfügung zu stellen.11 Damit gab es nur noch drei ernsthafte Konkurrenten: Montreal, Madrid und Detroit. In der dritten April-Woche 1966 kam es in Rom zum Showdown – und München punktete mit Vogels Vision, die „Olympische Spiele der kurzen Wege, im Grünen und der Einheit von Körper und Geist“ verhieß.12 Während Montreal bei der Präsentation seiner Pläne am Nachmittag des 25. April überzog, hielten sich der Oberbürgermeister und Daume bei ihren anschließenden Ansprachen bewusst knapp; lieber zeigten sie den Kurzfilm „München. Eine Stadt bewirbt sich“. Danach gingen die Deutschen zum gemeinsamen Abendessen – und unterwegs gabelte die „Gruppe erregt diskutierender Männer, ein paar Damen waren auch dabei“, den bekannten Filmstar Joachim Fuchsberger auf, der gerade seinen Drehtag beendet hatte und in einem römischen Straßencafé einen Espresso genoss. Der ging gern mit und fragte Vogel gleich zur Begrüßung: „Darf ich gratulieren, Herr Oberbürgermeister?“ Vogel blieb jedoch vorsichtig: „Ja und Nein. Die Präsentation hätte nicht besser ankommen können, und trotzdem werden wir die Spiele nicht bekommen.“13 Das Stadtoberhaupt rechnete mit vehementer Ablehnung seitens des Ostblocks, denn die DDR-Presse hatte umgehend eine „aggressive Kampagne“ gegen Münchens Bewerbung gestartet.14
Am 26. April 1966 stimmte das 61-köpfige IOC ab. Die Bekanntgabe des Ergebnisses war für 18 Uhr angesetzt, und vorher überschlugen sich die Gerüchte. München sei im dritten Wahlgang geschlagen worden, hieß es, und als das kanadische IOC-Mitglied den Bürgermeister von Montreal umarmte, gab Vogel das Rennen schon verloren. Doch dann verkündete IOC-Präsident Avery Brundage: „The games are awarded to Munich.“15 Tatsächlich war die Entscheidung deutlich ausgefallen: Schon im ersten Wahlgang führte München mit 21 Stimmen vor Montreal und Madrid mit je 16 und Detroit mit acht Stimmen. Im zweiten Wahlgang reichte es dann für Bayerns Landeshauptstadt mit 31 Stimmen zur absoluten Mehrheit. Die Freude war groß, doch das Hamburger Abendblatt, der deutschen Bewerbung gegenüber nach wie vor skeptisch, kommentierte: „München fehlt im Augenblick ja außer dem guten Willen und Plänen beinahe alles, was man für Olympische Spiele benötigt.“16
Das war übertrieben. Tatsächlich verfügte München mit dem früheren Exerzier- und späteren Flugplatz Oberwiesenfeld rund fünf Kilometer nordwestlich der Innenstadt über ein geeignetes Areal, das auch bereits als Stadtentwicklungsfläche ausgewiesen war. Auf dem südlichen Teil hatten Arbeiter seit 1946 einen der drei großen Trümmerschuttberge Münchens aufgeschichtet, aus rund zehn Millionen Kubikmetern nicht mehr verwertbarer Gebäudereste. Außerdem waren hier bereits ein Eissportzentrum sowie der Fernseh- und Fernmeldeturm im Bau, die beide völlig unabhängig von der Olympia-Bewerbung projektiert worden waren. Außerdem gab es Überlegungen für den Bau eines neuen Großstadions mit 75 000 Zuschauerplätzen, denn das Stadion an der Grünwalder Straße genügte als reines Fußballstadion den Erwartungen an eine moderne Sportstätte nicht mehr und war wegen umlaufender Verkehrsachsen auch nicht erweiterbar. Auf dem Oberwiesenfeld sollten ferner mehrere Tausend Wohnungen gebaut werden, ebenso auf westlich angrenzenden Grundstücken. Um die absehbar zunehmenden Verkehrsströme zu bewältigen und dem Irrweg der „autogerechten Stadt“ zu entkommen, der in den Jahren des Wiederaufbaus nach 1945 als Maßstab der Stadtentwicklung gegolten hatte, waren ein S-Bahn-Tunnel unter der Innenstadt in West-Ost-Richtung und eine U-Bahn in Nord-Süd-Richtung geplant. Das weitgehend zur Fußgängerzone umgestaltete Stadtzentrum sollte künftig ein Schnellstraßenring umschließen. All das folgte aus dem Entwicklungsplan, der bereits im Juli 1963 beschlossen worden war. Vogel stand nun vor der Aufgabe, die projektierte Bauzeit für diese Vorhaben von zwölf auf weniger als neun Jahre zu reduzieren – im Frühjahr 1972 musste alles fertig sein.
Die wichtigste Herausforderung aber war eine andere: Wie konnte Münchens Versprechen wahr werden, „Olympische Spiele der kurzen Wege, im Grünen und der Einheit von Körper und Geist“ zu realisieren?
Das Olympisches Dorf kurz vor der Fertigstellung. Die ausgedehnten Grünanlagen im Süden hin zum Stadion fehlen noch.
Der wesentliche Schritt gelang im Oktober 1967: Das Organisationskomitee (Vorsitzender: Willi Daume, Stellvertreter: Hans-Jochen Vogel) entschied gegen ein klassisches Stadion und für offene, von zeltartigen Plexiglasdächern überspannte Wettkampfstätten auf dem Oberwiesenfeld. Nach der Kür gab es natürlich Widerstand von Bedenkenträgern: Der Entwurf sei zu teuer.17
Die Bundesregierung war München in dieser Phase keine besonders große Hilfe, denn sie verfolgte zwei einander ausschließende Ziele – einerseits „in der augenblicklichen Haushaltssituation von Bund, Ländern und Gemeinden die durch die Ausrichtung der XX. Olympischen Spiele 1972 hervorgerufenen Belastungen der öffentlichen Haushalte so gering wie möglich zu halten“ und andererseits die „günstigsten Bedingungen für einen reibungslosen Verlauf der Olympischen Spiele zu schaffen“. Denn „die Sportjugend der Welt soll das demokratische und friedliebende Deutschland kennenlernen“.18
Die 1965 geschätzten Gesamtkosten von 550 Millionen Mark, das war klar, würden nicht ausreichen. Anfang 1969 wurde schon mit 992 Millionen Mark gerechnet, von denen der Steuerzahler 436 Millionen Mark tragen sollte.19 Doch auch das reichte nicht, denn das IOC und seine Fachverbände verlängerten ihre Wunschzettel immer weiter: Eine 2,2 Kilometer lange künstliche Ruderstrecke kostete wegen der Sonderwünsche statt vorgesehener zehn schließlich 69 Millionen Mark. Das Reitstadion samt Stallungen verschlang mit 51 Millionen mehr als das Zehnfache des eingeplanten Betrages; die Halle für die Volleyballwettbewerbe musste nach Baubeginn wegen einer Regeländerung um zweieinhalb Meter tiefergelegt werden, damit genügend Luftraum für hoch gespielte Bälle vorhanden war. Das Olympische Dorf sollte statt 9000 Athleten, Trainern und Funktionären nun ein Drittel mehr Menschen beherbergen können, nämlich 12 000. Ganz neu hinzu kamen eine 23 Millionen Mark teure Halle für die Basketballspiele, eine Anlage für die Sportschützen für 24 Millionen Mark und eine für die Ringer, für 25 Millionen Mark.20
Schließlich wurden die Gesamtinvestitionen für die Spiele in und um München auf 1350 Millionen Mark geschätzt, einschließlich des Stadions, des Olympischen Dorfes und der separaten Pressestadt für rund 4000 Journalisten, großer Teile der U- und S-Bahn sowie zahlreicher neuer Straßen. Für die Segelwettbewerbe vor Kiel plante man weitere 95 Millionen Mark Investitionskosten ein, vor allem für das neue Olympiazentrum Schilksee mit fast 800 Wohnungen, Hotels und einem eigenen Yachthafen. Die reinen Veranstaltungskosten an beiden Orten taxierte das Organisationskomitee auf 527 Millionen Mark. Das war jedoch eine grobe Schätzung, die wenig mit konkreten Kalkulationen zu tun hatte, sondern dazu führte, dass die Gesamtkosten sich auf den symbolischen Betrag von 1972 Millionen Mark summierten.21
Ein gutes Drittel davon, 686 Millionen Mark, sollte die öffentliche Hand aus Steuermitteln bezahlen, davon der Bund 333,40 Millionen Mark, Bayern und München je knapp 170 Millionen, Schleswig-Holstein und Kiel je gut sieben Millionen Mark. Einen deutlich größeren Teil würden eine Olympia-Lotterie (Ertrag: 250 Millionen Mark) und Sammler weltweit durch die Ausgabe spezieller Olympia-Sammelmünzen aus Silber (Überschuss: 639 Millionen Mark) tragen. Den Rest sollte das Organisationskomitee beisteuern, das von Einnahmen von 350 Millionen Mark ausging, die vor allem durch Eintrittsgelder, Übertragungsrechte und Mieten erzielt werden sollten.22 Diese Schätzung erwies sich als zu optimistisch, sodass ein gemeinnütziger Verein zur Förderung der Spiele mit Bar- und Sachspenden in Höhe von rund 40 Millionen Mark einspringen musste; auch die Stadt München schoss dem Organisationskomitee noch 24 Millionen Mark zu.23
Da 93 Millionen Mark des Bundesanteils als Investitionen für reguläre Aufgaben der Bundesförderung verbucht werden konnten, nämlich den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln und von Studentenwohnheimen, betrug die echte Mehrbelastung des Bundeshaushaltes durch die Sommerspiele 1972 vergleichsweise geringe 240 Millionen Mark.24 Dem standen schon vor Beginn der Spiele Steuermehreinnahmen in Höhe von rund 200 Millionen Mark gegenüber; hinzukommen sollten vorab schwer zu kalkulierende direkte und indirekte Steuern durch die Besuchermassen.
Den absehbaren Gewinn für seine Stadt fasste Hans-Jochen Vogel einige Monate vor der Eröffnung der Spiele zusammen: Außer den 16 festlichen Tagen, „in denen München im Mittelpunkt des Interesses der ganzen Welt stehen wird und sich eine Unzahl neuer Freunde erwerben kann“, blieben 4,2 Kilometer U-Bahn, 27,5 Hektar neue Straßen, mehr als tausend Sozial- und rund 5000 frei finanzierte Wohnungen, Quartiere für 1800 Studenten, drei neue Schulgebäude, ein Stadion, vier moderne Hallen und vieles Weitere. Er bilanzierte: „Die Anstrengungen haben sich gelohnt; München hat seine Chance genutzt.“25