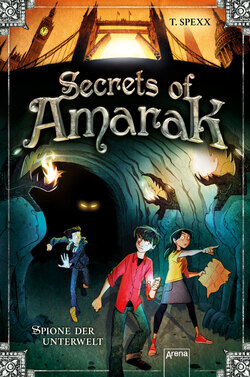Читать книгу Secrets of Amarak (1) - T. Spexx - Страница 10
ОглавлениеAm Montagmorgen war die Metro Richtung Londoner Innenstadt rappelvoll. Schüler, Geschäftsleute und Touristen drängten sich in den Waggons wie Sardinen in der Dose. Joe dachte sehnsüchtig an Bristol zurück, wo er und Rebecca immer gemütlich mit dem Fahrrad zur Schule geradelt waren. Hier in der Bahn war es warm und stickig. Zum Glück war die Fahrt zur neuen Schule nicht allzu lang.
Nachdem sie die Tower Bridge passiert hatten, erreichten die Geschwister ein paar Minuten später die Station St. Paul’s, wo sich ihre Wege trennten: Joe ging Richtung Süden zur City of London School for Boys, die direkt an der Themse lag, Rebeccas Weg führte in die entgegengesetzte Richtung zur City of London School for Girls in der Nähe des Barbican Center.
Joe hatte sich vorgenommen, den ersten Tag ganz relaxed zu sehen und erst mal in Ruhe die Lage zu checken. Doch gleich in der ersten großen Pause kam eine Clique von drei Jungs auf ihn zugeschlendert. Sie gingen in Joes Klasse und saßen in der letzten Reihe. Der große hieß Kevin und die anderen beiden Mike und Robin, wenn Joe sich richtig erinnerte.
»Ihr wohnt in Howard’s End?«, eröffnete Robin das Gespräch und betrachtete Joe ungläubig. »Ist das nicht beim alten Friedhof?«
»Ey logo«, sagte Kevin. »Howard’s End ist da, wo dieser Alex wohnt, dem die Eltern … na, ihr wisst schon.« Mike und Robin nickten stumm.
»Alex?«, fragte Joe interessiert. »Wer ist das? Und was ist mit seinen Eltern?«
»Das weißt du nicht?« Kevin verdrehte die Augen. »Alter, das weiß doch hier jeder. Dieser Alex ist früher auch auf diese Schule gegangen. Und seine Eltern sind …« Er zog den Finger über seinen Hals.
Joe stockte der Atem. »Tot?«
»Nicht nur tot, sondern umgebracht«, bestätigte Mike. »Als Alex gerade im Kino war. Mit diesem Einstein.«
»Ich hab gehört, dass er in seinem Zimmer Filme geglotzt hat«, sagte Kevin. »Während unten die Typen eingebrochen sind und kurzen Prozess mit seinen Alten gemacht haben.«
»Was denn für Typen?«, fragte Joe irritiert.
»Einbrecher«, antwortete Robin. »Die wollten wohl die Bude ausrauben.«
»Da sind die Eltern von diesem Irren dazwischengegangen und zack – ham se die umgenietet«, sagte Mike. »Mit ’ner Knarre.«
»Mit ’ner Axt«, korrigierte Kevin, aber Mike winkte ab. »Is’ doch wurscht. Jedenfalls sind sie tot. Und schuld ist ihr Sohn. Weil er so tierisch laut Filme geglotzt hat.« Er spuckte auf den Boden. »Deshalb hat er ihre Schreie nicht gehört. Sonst hätte er ja die Polizei rufen können und dann …« Er schnippte mit den Fingern. »… wären seine Eltern noch am Leben.«
Die Pausenglocke schrillte und die Jungs machten sich auf den Rückweg in ihre Klasse. Joe ging nachdenklich hinter den anderen her. Er wusste nicht, was er von dem Gespräch halten sollte.
Nach der Schule trafen sich Joe und Rebecca in der Cheapside, einer belebten Straße, die etwa auf der Hälfte des Wegs zwischen ihren Schulen lag. Neben Bürogebäuden und Einkaufsläden gab es dort auch viele Restaurants, und weil ihr Vater nicht gerne kochte, hatte er seinen Kindern kurzerhand Geld für ein Schnellrestaurant mitgegeben – das Joe und Rebecca der Schulkantine natürlich vorzogen. Sie wählten das Burger to go, das sie schon von einem früheren Besuch der St. Paul’s Cathedral her kannten, die nur einen Block entfernt lag. Joe nahm einen Chickenburger, Fritten und Limo, Rebecca zwei Singlewhopper und einen Eistee. Mit ihren Tabletts setzten sie sich ans Fenster und ließen es sich schmecken.
»Die sagen, die Eltern von diesem Alex sind umgebracht worden«, erzählte Joe zwischen zwei Bissen die Neuigkeiten, die er in der Pause aufgeschnappt hatte. »Aber sie können sich nicht darauf einigen, wie.«
»Ich hab gehört, es ging um Gold«, erwiderte Rebecca.
»Was? Reden die bei dir etwa auch davon? Muss ja echt eine große Sache gewesen sein, wenn die halbe Stadt davon spricht.«
»Na ja, diese Cathy in meiner Klasse hat wohl einen Bruder auf deiner Schule und der hat ihr das alles erzählt, behauptet sie.«
»O.k., und wieso ging es um Gold?«
»Die Eltern waren wohl so was wie Goldschürfer und haben einen ziemlichen Batzen davon zusammengekratzt. Wie sonst hätten sie sich auch so ein Riesenhaus leisten können. Jedenfalls hat die Polizei später nichts von dem Gold gefunden. Das haben die Einbrecher mitgenommen. Und geholfen hat ihnen sehr wahrscheinlich der Diener.«
»Was für ein Diener?«, fragte Joe.
»Einstein oder so.« Rebecca nahm einen Schluck von ihrem Eistee. »Der hat für die Familie gearbeitet. Und es wird auch gemunkelt, dass er die Diebe ins Haus gelassen hat. Er ist also für den Tod von Alex’ Eltern verantwortlich.«
»Und wo ist er jetzt?«, fragte Joe und angelte sich ein paar Fritten.
»Alexander?«
»Der Diener.«
»Wohnt immer noch im Haus.« Rebeccas Stimme nahm einen unheilvollen Klang an. »Zusammen mit Alexander.«
Joe zog die Stirn kraus. »Wieso ist er nicht im Gefängnis?«
»Weil man ihm nichts nachweisen kann. Und er hält Alexander in dem Haus gefangen. Der darf nämlich nicht zur Schule gehen.«
»Nicht zur Schule?«
Rebecca schüttelte den Kopf. »Der darf das Haus sowieso fast nie verlassen.«
»Wieso greift da niemand ein?«, wunderte sich Joe. »Die Polizei oder die Schule selbst? Ich dachte immer, jeder muss zur Schule gehen, notfalls mit Gewalt.«
Rebecca zuckte mit den Achseln. »Wahrscheinlich hat dieser Diener das alles so gedeichselt. Was weiß ich.«
»Klingt alles nach einer echt merkwürdigen Story.« Joe starrte nachdenklich vor sich hin. Dann widmete er sich wieder seinem Burger. Genussvoll biss er ab und fragte dann mit vollem Mund: »Erinnerst du dich noch an letzte Nacht?«
»Was war denn letzte Nacht?«, fragte Rebecca.
»Du hast geschlafwandelt.«
»Bin ich nicht.«
Joe schob den letzten Rest des Burgers in seinen Mund und leckte sich die Finger ab. »Und dabei hast du komisches Zeug geredet: Er kommt zurück, der ewig war, und so. Was bedeutet das?«
»Keine Ahnung«, sagte Rebecca und schlürfte ihren Eistee.
Aber Joe ließ nicht locker. »Erinnerst du dich denn an gar nichts mehr?«
Seine Schwester ließ sich seufzend in ihren Sitz zurückfallen. »Nein, tu ich nicht. Vielleicht hast du das ja bloß geträumt.«
»Ne, ganz bestimmt nicht«, widersprach Joe und stand auf. »Ich hol mir noch ’nen Burger.« Er schlenderte zum Verkaufstresen und gab seine Bestellung auf. Während er darauf wartete, dass der Burger in der Küche zubereitet wurde, sah er, wie zwei Männer das Restaurant betraten. Sie waren breitschultrig und komplett in Schwarz gekleidet. Der größere der beiden trug einen langen, schmalen Bart am Kinn, der Joe an einen Ziegenbart erinnerte. Der kleinere grinste so breit, dass man seine schiefen Zähne sehen konnte. Sie trugen Sonnenbrillen und sahen aus, als kämen sie direkt aus einem Mafiafilm. Joe wich unweigerlich ein wenig zurück, als sie sich an die Kasse neben ihm stellten.
»Logisch ist da Parkverbot«, schnarrte der kleine mit einer seltsam hohen Stimme. »Und wenn wir abgeschleppt werden, ist das verdammt noch mal deine Schuld.«
»Halt endlich die Klappe«, herrschte ihn der große an und widmete sich dem Angebot auf der elektronischen Anzeige über dem Tresen.
Eine Bedienung kam lächelnd näher. »Was darf’s sein?«
»Haben Sie auch Tripleburger?«, fragte der Mann mit dem Ziegenbart.
Die junge Frau in der braunen Restaurant-Uniform schüttelte den Kopf. »Wir haben nur Single und Double, tut mir leid.«
»Dann nehme ich zwei Singles und zwei Doubles und mach mir die Triple selber«, brummte der Ziegenbart und drehte sich zu seinem Kumpel. »Und du?«
»Riesenpommes und 12er-Chickenwings«, schnarrte der. »Und für den Meister einen Salat und ’ne Diät-Cola.«
»Bist du irre?«, fuhr ihn der Ziegenbart unvermittelt an. »Tickst du nicht mehr richtig?« Dann drehte er sich um und entdeckte Joe am Tresen neben sich.
»Was glotzt du so?«, herrschte er ihn an.
Joe schüttelte rasch den Kopf. »Nichts«, murmelte er. In diesem Augenblick kam eine weitere Bedienung und reichte ihm seinen Burger. Joe nahm ihn entgegen und wandte sich schnell ab. Er konnte gerade noch hören, wie der Ziegenbart seinem Kollegen drohte: »Wenn du noch einmal in der Öffentlichkeit den Chef erwähnst, stopf ich dir dein verdammtes Maul, kapiert?«
Joe hatte ein ziemlich mulmiges Gefühl, als er zu Rebecca an den Tisch kam. »Lass uns gehen«, sagte er.
»Willst du nicht erst deinen Burger essen?«, fragte seine Schwester überrascht.
»Mir ist der Appetit vergangen«, erwiderte Joe und nahm seinen Rucksack. Mit großen Schritten hastete er Richtung Ausgang. Rebecca folgte ihm verwundert. Als Joe die Tür öffnete, schielte er noch einmal zu den beiden Männern am Tresen. Der Mann mit dem Ziegenbart fixierte ihn und Rebecca und schien nur darauf zu warten, dass die beiden das Restaurant verließen. Hastig schlug Joe die Tür hinter ihnen zu.
»Was war denn los?«, fragte Rebecca, als sie und ihr Bruder die Cheapside entlang Richtung St. Paul’s gingen.
»Diese beiden Typen«, erwiderte Joe. »Die waren irgendwie unheimlich. Und der eine hat was von einem Meister gefaselt.«
»Meister?«, fragte Rebecca. »Was für ein Meister?«
»Ich glaube, er meinte seinen Chef«, antwortete Joe. »Und dem anderen war es gar nicht recht, dass ich das mitbekommen habe.« Er seufzte. »Jedenfalls bin ich froh, dass wir raus sind. Lass uns nach Hause fahren. Für heute habe ich genug von der City.«
»Ja, lass uns dahin fahren, wo wir hingehören«, sagte Rebecca und fügte mit Grabesstimme hinzu: »Ins Haus neben dem Friedhof.« Und dann mussten beide lachen.
Auf dem Weg zurück war die Metro viel leerer als auf dem Hinweg. Ein paar Schüler, die Joe vom Pausenhof wiedererkannte, saßen in einer Ecke und scrollten auf ihren Smartphones herum. Eine junge Frau mit übergroßen Kopfhörern hörte Musik und ein Bettler schlurfte mit einem Pappbecher von einem zum anderen und fragte nach Kleingeld. Joe und Rebecca waren froh, Sitzplätze zu haben, denn der erste Schultag hatte sie mehr geschafft, als sie erwartet hatten. An der Station Canada Water stiegen die beiden aus und gingen zu Fuß nach Howard’s End, das nur ein paar Minuten entfernt lag.
»Meinst du, Dad ist zu Hause?«, fragte Rebecca, als sie in die Sackgasse einbogen.
»Keine Ahnung«, erwiderte Joe. »Wieso fragst du?«
»Wenn er nicht da ist, können wir nach dem Schlüssel suchen«, sagte Rebecca. »Ich will unbedingt rauskriegen, was sich hinter dieser Tür verbirgt und wer der Kerl war, der durchs Schlüsselloch geguckt …«
Joe blieb abrupt stehen.
»Was ist?«, fragte Rebecca.
Joe zeigte stumm zu ihrem neuen Haus, das nur noch knapp fünfzig Meter entfernt war. An der Haustür stand ein Mann mit grauer Jacke und betätigte die Klingel.
»Wer ist das?«, fragte Rebecca.
»Keine Ahnung«, erwiderte Joe. »Macht aber keinen besonders freundlichen Eindruck, der Typ. Sieh dir das an!«
Der Mann auf der Veranda klingelte erneut, packte dann den Türklopfer und hämmerte damit gegen die Tür.
»Was will der von uns?«, murmelte Rebecca. In diesem Augenblick sah sich der Fremde suchend um. Joe zog Rebecca schnell hinter eine dicke Eiche – gerade noch rechtzeitig, bevor der Mann in ihre Richtung sah.
»Mann, was ist hier eigentlich los«, schimpfte Joe leise. »Erst das Werwolf-Geheule letzte Nacht, dann die finsteren Typen im Restaurant und jetzt auch noch dieser komische Kauz.«
»Was für ein Werwolf?«, fragte Rebecca.
Aber Joe antwortete nicht, sondern beobachtete das Geschehen an der Haustür. Der Mann auf der Veranda klopfte und klingelte weiter, dann rief er laut: »Hallo.«
»Der will rauskriegen, ob jemand zu Hause ist«, flüsterte Joe.
»Vielleicht ist das der Kerl aus dem Tunnel«, überlegte Rebecca.
»Dann versucht er bestimmt gleich einzubrechen«, vermutete Joe. »Wahrscheinlich wird er … was macht er denn jetzt?«
Der Mann öffnete den Briefschlitz im unteren Drittel der Tür und steckte etwas hinein. Dann drehte er sich um und tänzelte die Verandatreppe herunter.
»Das darf doch nicht wahr sein«, stieß Joe aus und rannte los. Rebecca zögerte nur kurz, dann folgte sie ihm.
Der Mann verließ das Grundstück und stieg auf das Fahrrad, das am Zaun lehnte. »Hey!«, rief Joe, noch bevor er ihn erreicht hatte.
Der Mann sah ihn verwundert an. »Meinst du mich?«
»Ja«, sagte Joe, als er und Rebecca keuchend vor ihm stoppten. »Sie sind der Postbote, nicht wahr?«
Der Mann nickte. »Richtig.«
»Und wir wohnen hier«, erklärte Joe. »Haben Sie etwas für uns?«
Die Gesichtszüge des Postboten hellten sich auf. »Kann man so sagen.« Er beugte sich zu seiner Tasche, die vor ihm am Rad befestigt war, und zog einen Brief hervor.
»Das ist ein Einschreiben«, sagte er. »Das darf ich nicht einfach in den Briefkasten werfen, sondern brauche eine Unterschrift. Könnt ihr es annehmen?«
»Na klar«, antwortete Rebecca.
Der Briefträger zog ein elektronisches Gerät hervor, tippte ein paar Nummern ein, hielt Joe dann einen Plastikstift entgegen und reichte ihm das Display.
»Ich dachte schon, ich werde es heute nicht mehr los. In der ganzen Straße hat niemand aufgemacht. Und so ein Einschreiben ist ja meistens wichtig«, sagte er, während Joe unterschrieb. »Da wollte ich lieber alles versuchen, bevor ich es wieder mitnehme.«
»Für wen ist es denn?«, fragte Rebecca. »Für Mr oder Mrs Bookman?«
Der Postbote verstaute das Gerät in seiner Tasche und überreichte Joe den Brief.
»Weder noch«, sagte er. »Es ist für Mr Alexander Mercurius. Der wohnt im Haus am Ende der Straße.«