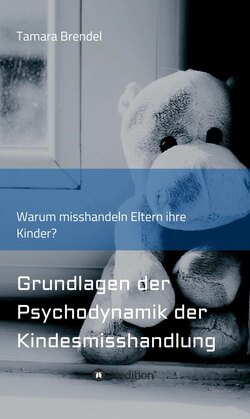Читать книгу Psychodynamik der Kindesmisshandlung - Tamara Brendel - Страница 9
Оглавление2 Was ist eine Kindeswohlgefährdung?
Bei dem Versuch, eine Kindeswohlgefährdung (KWG) genau zu definieren, wird es schwierig, da es sich bei dem Wort „Kindeswohl“ um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt. Die gesetzliche Definition zur Kindeswohlgefährdung liegt im BGB § 1666 wie folgt vor:
„Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind.“
Gesetzlich gesehen liegt eine Kindeswohlgefährdung also dann vor, wenn Eltern mit ihrem Verhalten im Widerspruch zu den körperlichen, geistigen und seelischen Bedürfnissen ihres Kindes stehen und dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erhebliche Beeinträchtigung für das Wohl des Kindes besteht (zit. n. Meysen, 2012, 23). Demnach ist das Wohl des Kindes dann gefährdet, wenn seine elementaren Bedürfnisse u. a. nach Liebe und Geborgenheit, angemessener Versorgung, Unterstützung, Unversehrtheit, Kontinuität in den Beziehungen, Möglichkeiten, sich zu binden, und Bildung (Schulbesuch) nicht berücksichtigt werden. Dies ist auch der Fall, wenn die Familie nicht in der Lage ist, das Kind zu einer gemeinschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeit zu erziehen, oder aber die Rechte des Kindes nach dem BGB und der UN-Kinderrechtskonvention missachtet (vgl. Alle, 2012, 13). In der UN-Kinderrechtskonvention ist mit dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes der Begriff „Kindeswohl“ weitgehend geregelt.
Im BGB § 1631 Abs. 2 wird festgehalten:
„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“
Im Grundgesetz Artikel 6 Abs. 2 wird das Elternrecht, aber auch die Staatsüberwachung der Erziehung des Kindes deutlich:
„Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“
Im Fall einer akuten Gefahrenmeldung greift § 8a im SGBVIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz). Dieser Paragraf wurde 2005 als Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung eingeführt.
Der § 8a SGBVII stellt eine Leitlinie bzw. einen Fahrplan für Fachkräfte im Jugendamt im Umgang mit drohender oder akuter Kindeswohlgefährdung dar. Zusätzlich wurde 2012 das Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz, kurz KKG, in Kraft gesetzt. Das KKG wirkt unterstützend u. a. bei der Umsetzung der staatlichen Mitverantwortung, bei Netzwerkstrukturen im Kinderschutz und bei der Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei KWG.
2.1 Welche Definitionen und Formen der Kindesmisshandlung gibt es?
Kindesmisshandlung kann wie folgt definiert werden:
„Eine Kindesmisshandlung liegt dann vor, wenn das Kind von seinen Eltern, zu denen es bei Gefahr und Angst schutzsuchend fliehen muß, allein gelassen oder überwältigt wird, so daß es sie als Schutzobjekt verliert und Ohnmachtsgefühlen und Todesängsten ausgeliefert ist […], wenn es mit seinen elementaren Bedürfnissen und Fähigkeiten überhaupt nicht wahrgenommen wird.“ (Nienstedt/ Westermann, 2007, 23).
Es gibt verschiedene Formen der Misshandlung, wie die psychische und physische Gewalt, die Vernachlässigung und den sexuellen Missbrauch an Kindern. In einigen Büchern wird auch das Münch-hausen-by-proxy-Syndrom (MSBP) als eine weitere Form von Kindesmisshandlung anerkannt und benannt. Auffallend ist, dass das Shaken-baby-Syndrom (SBS) in der Literatur wenig bis gar nicht als separat zu betrachtende Misshandlungsform beschrieben wird. Nicht so bei Kindler. Er listet das Schütteltrauma klar als eine eigenständige Form von Kindesmisshandlung auf (vgl. Kindler, 2006, 8-1). Eventuell liegt es daran, dass das Schütteltrauma unter die körperliche Misshandlung fällt und hier seine Beschreibung und Bedeutung wiederfindet. Es sollte allerdings als gesonderte Misshandlungsform betrachtet werden, da es sich hierbei um eine besonders gefährliche und schwerwiegende Art der Misshandlung handelt. Sie geht in bis zu 30 % der Fälle tödlich aus (vgl. Kindler, 2006, 8-1f.). Im Folgenden finden sich die Definitionen zu den einzelnen Formen von Kindesmisshandlung.
Psychische Misshandlung:
„Unter psychischer Misshandlung versteht man alle Handlungen oder Unterlassungen von Eltern oder Betreuungspersonen, die Kinder ängstigen, überfordern, ihnen das Gefühl der Wertlosigkeit vermitteln. “ (Engfer, 2016, 7)
Das bedeutet u. a. die Isolierung des Kindes von anderen Menschen (Freunden), das Ausnutzen oder Zwingen des Kindes zu sittenwidrigen oder gar zu selbstzerstörerischen Handlungen, das Terrorisieren eines Kindes mit wiederholten Drohungen, die Konfrontation mit Verlusterfahrungen, das Verweigern von emotionaler Zuwendung, Anfeindungen, das Herabsetzen, die Ablehnung oder Demütigung oder das ständige Kritisieren des Kindes (vgl. Kindler, 2006, 4-1). Aber auch die Partnergewalt innerhalb der Familie zählt zu psychischer Kindesmisshandlung (vgl. Cierpka/Cierpka, 2012, 313).
Physische Misshandlung:
„Unter körperlicher Misshandlung versteht man Schläge oder andere gewaltsame Handlungen (Stöße, Schütteln, Verbrennungen, Stiche usw.), die beim Kind zu Verletzungen führen können.“ (Engfer, 2016, 9).
Dazu zählen u. a. Handlungen, die bei dem Kind Ekel und Schmerzen auslösen, beispielsweise es Urin trinken zu lassen, es durch Wasser oder Ofen zu verbrühen/verbrennen, es zu würgen, gegen die Wand zu schleudern et cetera (zit. n. Krieger et al., 2007, 14). Hinzuzufügen ist noch, dass es sich bei Definitionen der körperlichen Misshandlung ausnahmslos um eine absichtlich herbeigeführte Schädigung des Kindes handelt.
Vernachlässigung:
„Kinder werden vernachlässigt, wenn sie von ihren Eltern oder Betreuungspersonen unzureichend ernährt, gepflegt, gefördert, gesundheitlich versorgt, beaufsichtigt und/oder vor Gefahren geschützt werden.“ (Engfer, 2016, 5).
Hier kann noch zwischen physischer und psychischer und zwischen aktiver und passiver Vernachlässigung unterschieden werden (vgl. Krieger et al., 2007, 16). Hierzu je ein Beispiel: Körperliche Vernachlässigung wäre Mangelernährung des Kindes. Seelische Vernachlässigung zeigt sich in mangelnder Zuwendung und Aufmerksamkeit dem Kind gegenüber. Aktive Vernachlässigung ist beispielsweise das „bewusste“ Unterlassen medizinischer Versorgung. Passive Vernachlässigung stellt eine „unbewusste“ Vernachlässigung dar, beispielsweise langes Alleinlassen des Kindes (vgl. Krieger et al., 2007, 16).
Sexueller Missbrauch:
„Von sexuellem Mißbrauch […], soll hier also gesprochen werden, wenn ein Kind oder Jugendliche(r) zu sexuellen Handlungen durch einen Erwachsenen gezwungen, genötigt oder verführt wird, der seine Überlegenheit oder Macht über das Kind nutzt. Dabei macht es keinen Unterschied, ob das Kind sexuelle Handlungen an seinem Körper erdulden muss oder diese Handlungen am Körper des Erwachsenen vornehmen muß. “ (Harnach-Beck, 1995, 256).
In der Literatur gibt es einige eng und weit gefasste Definitionsversuche zu sexuellem Missbrauch. Auch weniger intensive Übergriffe auf das Kind oder den Jugendlichen, wie die Konfrontation mit pornografischem Material, werden als Verletzung der Schamgrenze des Kindes mit negativen Auswirkungen auf sein Wohlergehen bzw. seine Entwicklung angesehen (vgl. Unterstaller, 2006, 6-2). Daher gibt es in der Jugendhilfe meist weite Definitionen. So auch bei Unterstaller ebd., welche darauf hinweist, Definitionen zu sexuellem Missbrauch als „sämtliche als potenziell schädlich angesehenen Handlungen zu erfassen. So werden bei ‚weiten‘ Definitionen in der Regel auch sexuelle Handlungen ohne Körperkontakte wie Exhibitionismus zum sexuellen Missbrauch gezählt“ (zit. n. Unterstaller, 2006, 6-2).
Shaken-baby-Syndrom:
„Werden Kinder in ihren ersten Lebensmonaten an den Armen bzw. am Körper gehalten und kräftig geschüttelt oder mit dem Kopf kraftvoll gegen eine weiche Oberfläche geschleudert, so kann der Kopf des Kindes Flieh- und Rotationskräften ausgesetzt sein, die so stark sind, dass sie zu verschiedenen Verletzungen führen […].“ (Kindler, 2016, 8-1).
Hierbei handelt es sich um eine besonders schwere Form der körperlichen Misshandlung mit meist sehr schwerwiegenden Folgen wie Einblutungen, lebensbedrohlichem Druckanstieg im Schädel und/oder Untergang von Gehirngewebe aufgrund von Sauerstoffmangel (vgl. Kindler, 2006, 8-1). Wenn das Baby dabei überlebt, trägt es meist schwerwiegende bleibende kognitive und auch körperliche Behinderungen davon.
Münchhausen-by-proxy-Syndrom:
„Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist eine schwere, bizarr anmutende Kombination von emotionaler und körperlicher Misshandlung. Hier simulieren die Eltern bei ihrem oft sehr kleinen Kind eine Krankheit. Manchmal handelt es sich nur um erfundene, berichtete Krankheitssymptome, manchmal werden jedoch auch körperliche Symptome herbeigeführt, um eine Krankheit vorzutäuschen.“ (Kinderschutz-Zentrum Berlin, 2009, 63)
Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom wird teilweise zwischen Pädiatrie und Psychiatrie eingeordnet und ist eine sehr bizarre und ungewöhnliche Form von Kindesmisshandlung (vgl. Kindler et al., 2006, 7-1). Weitere ungewöhnliche Formen von Kindesmisshandlung beschreibt Rosenberg in Das misshandelte Kind. Sie geht dabei u. a. auf den Verzicht von medizinischer Versorgung aufgrund von Religiosität, bizarre Ernährungsformen, psychosoziale Fettsucht im Kindesalter, Wasserentzug und Vergiftung, Kinderarbeit, Kinderpornografie, Prostitution und sexuellen Sadismus ein (vgl. ausführliche Beschreibung in Rosenberg, 2002, 643ff).
2.2 Was sind Gründe für Kindesmisshandlungen?
Es könne schon fast die Rede davon sein, dass es sich bei Kindesmisshandlung um eine Geisteskrankheit handelt, so die Autoren von Deutschland misshandelt seine Kinder.
„Man muss wohl seelisch krank sein, um ein hilfloses Kind wiederholt schlagen, quälen und demütigen zu können, anstatt es zu beschützen und für sein Wohlergehen zu sorgen.“ (Tsokos/Guddat/Gößling, 2014, 42).
Fakt ist, es gibt zahlreiche Gründe, warum Eltern ihre Kinder misshandeln. Dabei gibt es gleich mehrere Faktoren, die sich quasi vermischen und nicht nur den einen Auslöser. Bei einer schwierigen eigenen Biografie mit vielfältigen und steigenden Belastungen in einer Familie steigt das Risiko für eine Kindesmisshandlung an. In der Literatur gibt es etliche verschiedene Erklärungsversuche zum Thema Kindesmisshandlung. In diesem Buch werden die Ursachen für KM im 2. Kapitel insgesamt etwas kürzer gehalten, da im Rahmen dieses Buches der Fokus auf der psychopathologischen Erklärungshypothese liegen soll.
Die psychopathologische Erklärungshypothese besagt, dass aller Wahrscheinlichkeit nach affektive Störungen, beispielsweise Depressionen, in Kombination mit Persönlichkeitsproblemen seitens der Eltern als Auslöser für eine Misshandlung des Kindes verantwortlich sind. Psychische Erkrankungen und Persönlichkeitsprobleme sind oftmals auf eigene Gewalt- und Ablehnungserfahrungen der Eltern in ihrer Kindheit zurückzuführen. Im Mittelpunkt dieser These steht die Weitergabe der Gewalt über Generationen (vgl. Krieger et al., 2007, 35). Beispielsweise schreibt Cierpka über den Empathiemangel, der das ehemalige Opfer zum Täter werden lässt (vgl. Cierpka/Cierpka, 2012, 319). Die Gefühle des Kindes können nicht adäquat wahrgenommen werden, da in der eigenen Kindheit keine emphatische Affektspiegelung von der Bezugsperson erfahren wurde (vgl. Cierpka/Cierpka, 2012, 317). Täter, die selbst sexualisierte Gewalt in ihrer Kindheit erfahren haben, neigen dazu, dies später zu reinszenieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass in Misshandlungs- und Missbrauchsfällen aus dem Opfer später ein Täter wird, liegt schätzungsweise bei einem Drittel der Betroffenen (vgl. Engfer, 2016, 19). Die Identifikation mit dem Aggressor spielt in diesem Zusammenhang eine ganz entschiedene Rolle, welche im Kapitel 3.3.1 noch explizit erläutert wird.
Besteht nun eine generelle Gewaltbereitschaft und kommen noch Faktoren wie Stress, emotionale Verstimmungen, überhöhte Reizbarkeit, Überängstlichkeit, geringe Frustrationstoleranz und Überforderung hinzu, so steigt das Risiko weiter an, sein Kind in belastenden Momenten zu misshandeln. Auch plötzlich eintretende prekäre Lebenssituationen, wie der Tod des Partners, Scheidung und/oder Arbeitslosigkeit, können sich zusätzlich förderlich auf eine erhöhte Gewaltbereitschaft gegenüber dem Kind auswirken. Drogenprobleme, Alkoholismus, Eltern, die einen verbal aggressiven Erziehungsstil mit Anschreien oder Drohungen an den Tag legen oder körperliche Strafen generell befürworten oder aber bindungsarm, manipulativ oder impulsiv sind, stellen ein erhöhtes Risiko dar, sein Kind zu misshandeln (vgl. Krieger et al., 2007, 36). Ebenso können zu hohe und unrealistische Erwartungen an das Kind letztlich zu Gewaltanwendung führen (vgl. Deegner, 2010, 29).
Weitere begünstigende Faktoren für KM:
Finanzielle Probleme und Langzeitarbeitslosigkeit führen zu inneren Spannungen und stellen eine hohe psychische Belastung dar (vgl. Krieger et al., 2007, 37). Nicht selten kommt es hier vermehrt zu Aggressionen dem Kind gegenüber, da mit den finanziellen Ressourcen oftmals auch die Frustrationstoleranz und Impulskontrolle der Eltern abnehmen (vgl. Krieger et al., 2007, 38). Eine Legitimierung von Gewaltanwendung im Erziehungsstil aufgrund eigener Gewalterfahrungen nach dem Motto: „Ein Klaps auf den Po hat mir auch nicht geschadet“, ist ein Risikofaktor für Misshandlungen. Oder aber auch die Legitimierung aus kulturellen Hintergründen. In vielen Ländern gehören körperliche Züchtigungen zu einer „normalen“ Erziehung seiner Kinder bis heute dazu. Weitere Risiken stellen fehlende soziale Netzwerke oder wenig soziale Kontakte zu Verwandten oder Freunden dar. Umgekehrt ist dies oft der Fall, wenn vermehrt soziale Kontakte zu anderen Familien mit Gewaltpotenzial besteht (vgl. Deegener, 2010, 31). Oft ist die Rede davon, dass Kindesmisshandlung gerade in unteren Schichten besonders gehäuft vorkommt. Krieger et al. erklärt hierzu, dass dies einerseits durch eine erhöhte soziale Kontrolle zustande käme. Es lägen mehr Anzeigen wegen familiärerer Gewalt vor als in den Oberschichten. Zum anderen verfügten Familien in den unteren Schichten über weniger Kenntnisse von Unterstützungsmöglichkeiten (vgl. Krieger et al., 2007, 37). Die Rechtsmediziner Tsokos, Guddat und Gößling schreiben hierzu, dass ebenso in Villen geprügelt würde, mit dem Unterschied, dass Akademiker ihre Gewalttaten besser zu verbergen und sich im Zweifelsfall durch einen Anwalt zu helfen wüssten (vgl. Tsokos/ Guddat/Gößling, 2014, 47).
Des Weiteren reagieren Eltern gehäuft gewalttätig, wenn sie sich hilflos fühlen und nicht wissen, wie sie mit dem Verhalten des Kindes umgehen sollen, oder um dem Kind ihre Autorität und ihre Machtposition zu demonstrieren (vgl. Krieger et al., 2007, 41). Kinder können während verschiedener Entwicklungsphasen anstrengend sein, beispielsweise im Säuglingsalter (Schreikinder), während Trotzphasen, später in der Pubertät oder auch bei Beeinträchtigungen wie einer Behinderung. Solche Situationen bringen Eltern nicht selten an ihre Grenzen und können Hilflosigkeit und Ohnmachtsgefühle auslösen (vgl. Krieger et al., 2007, 49). Kommt es vor, dass ein Kind mit „schwierigem“ Temperament Eltern hat, die sowieso schon dazu neigen, impulsiv zu reagieren, so ist dieses Kind besonders gefährdet (vgl. Krieger et al., 2007, 51). Dies rechtfertigt die Taten in keinster Weise, denn das Kind trägt generell nie eine Eigenschuld an seinen Misshandlungen.
Weitere Ursachen kurz zusammengefasst:
Je jünger die Eltern bei der Geburt des Kindes sind, umso höher liegt das Misshandlungsrisiko aufgrund von unzureichender Reife, Unerfahrenheit und Unkenntnissen im Umgang mit dem Säugling. Ist die Mutter alleinerziehend und muss allen Belastungen allein standhalten, erhöht das das Risiko, aus Überforderung das Kind zu misshandeln. Ein ungewolltes Kind, mehrere Geschwisterkinder, häufige Partnerwechsel, Stiefeltern und schlechte Schulbildung stellen ebenfalls erhöhte Risikofaktoren dar, zum Misshandler zu werden (vgl. Deegener, 2010, 26).
An dieser Stelle ist kurz anzumerken, dass dies nicht heißt, dass Menschen mit den hier genannten Persönlichkeitsmerkmalen und Persönlichkeitsproblemen zwangsläufig zu misshandelnden Eltern werden müssen. Im Kontext wird allerdings deutlich, dass die Kombination aus Persönlichkeitsproblemen und eigenen Merkmalen, äußeren Belastungen sowie die eigene Gewaltbereitschaft durch Transmission von Gewalt eine zentrale Rolle spielt. Durch diese zusammenwirkenden Faktoren ist das Risiko, zum Misshandler zu werden, insgesamt betrachtet erhöht.