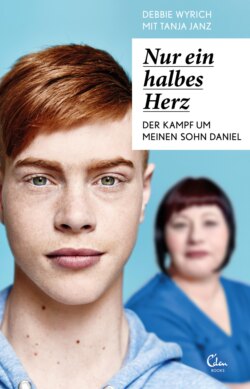Читать книгу Nur ein halbes Herz - Tanja Janz - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3
Nur ein halbes Herz
Nach der Diagnose von Dr. Williams stand ich unter Schock – und zwar richtig! Ich hatte mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass mein Kind nur ein halbes Herz hatte. Ehrlich gesagt, wusste ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass ein Lebewesen mit einem halben Herzen überhaupt existieren konnte. Diese Information war zwar bei mir angekommen, aber ich konnte einfach nicht begreifen, dass meinem armen Baby eine komplette Herzhälfte fehlte. Der Gedanke daran war für mich einfach unvorstellbar und ließ mich starr auf dem Stuhl vor Dr. Williams' Schreibtisch sitzen. Ich war weder fähig, mich zu rühren, noch zu sprechen. Ich schaute einfach nur fassungslos den Kinderkardiologen an, der mir wenige Sekunden zuvor die Hiobsbotschaft überbracht hatte, die mein ganzes Leben von einem Moment zum anderen verändert hatte. Nichts war mehr so wie vor der Untersuchung. Und es würde auch nie mehr so sein. Dessen war ich mir bewusst, und es machte mir eine höllische Angst. Wie sollte es denn jetzt weitergehen?
»Holen Sie doch bitte ein Glas Wasser für Mrs Meyer«, hörte ich den Arzt sagen. Seine Stimme schien von sehr weit her zu kommen. Ich fühlte mich wie in einem Nebelsee und nahm meine Umwelt nur stark reduziert wahr. Die Krankenschwester stellte ein Glas Wasser vor mir auf den Tisch. Als ich keine Anstalten machte, danach zu greifen, drückte sie es mir einfach in die freie Hand. »Trinken Sie etwas. Das wird Ihnen guttun«, forderte sie mich auf.
Ich tat, wie mir geheißen, und führte das Glas an den Mund, wobei meine Hand so stark zitterte, dass ich etwas von dem Wasser verschüttete. In kleinen Zügen trank ich von der kühlen Flüssigkeit und mit jedem Schluck wurde mein Kopf klarer. Schließlich stellte ich das leere Glas zurück auf den Tisch. »Noch eins, bitte«, sagte ich zu der Krankenschwester, die sogleich verschwand, um mir mehr Wasser zu bringen.
»Ich weiß, das ist ein großer Schock für Sie. Aber es ist nicht das Ende. Sie dürfen Ihr Kind jetzt nicht aufgeben. Sie müssen stark sein und um das Leben von Daniel kämpfen«, sagte Dr. Williams eindringlich zu mir.
»Ich habe nicht vor, aufzugeben, Herr Doktor. Wie könnte eine Mutter das eigene Kind aufgeben?«, antwortete ich trotz meiner Fassungslosigkeit mit fester Stimme. Im Nachhinein schiebe ich meine scheinbare Gefasstheit auf die extreme Ausnahmesituation, in der ich mich zweifelsfrei befand. Manche Menschen brechen in solchen Momenten komplett zusammen, manche funktionieren unter außerordentlichem psychischem Stress zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk. Ich gehörte anscheinend zu diesen Zahnrädern.
»Das freut mich sehr zu hören.« Dr. William nickte mir aufmunternd zu.
»Wie lange wird mein Kind leben?«, stellte ich die alles entscheidende Frage, obwohl es mir vor der Antwort graute. Was sollte ich tun, wenn Daniels Lebenserwartung bei weniger als einem Jahr lag? Wie sollte ich damit umgehen oder besser: Konnte ich damit überhaupt umgehen?
Dr. Williams fuhr sich mit einer Hand übers Kinn. »Das ist schwer zu beantworten. Im Grunde genommen kann Ihnen das niemand genau sagen«, gab er zu.
»Aber Daniel wird doch seinen ersten Geburtstag erleben?«, fragte ich angstvoll.
»Wenn unsere Behandlungen gut anschlagen, dann bestimmt«, beruhigte er mich.
»Und wenn alles gut läuft? Ich meine, im optimalen Fall? Wie alt kann mein Sohn dann werden?«
Dr. Williams schaute sich erneut die Aufnahmen von Daniels Herzen an, die vor ihm auf dem Tisch lagen. »Die höchste Lebenserwartung für Ihren Sohn würde ich auf zwanzig Jahre schätzen.«
Zwanzig Jahre, dachte ich und atmete erleichtert aus. Das hörte sich doch schon wesentlich besser an. Und wer wusste schon, was in den nächsten zwanzig Jahren alles passieren würde, wie weit die Forschung dann war? Vielleicht verdoppelte sich bis dahin die Lebenserwartung meines Babys. »Gut. Dann gehen wir die nächsten zwanzig Jahre mal an«, sagte ich gefasst.
»Ich werde gleich eine medikamentöse Therapie für Ihren Sohn anordnen.«
Als ich Daniel zur Säuglingsstation gebracht hatte, kehrte ich zurück in mein Zimmer. Doch während ich auf mein Bett zulief, fühlten sich meine Knie plötzlich weich wie Wackelpudding an. Ich ließ mich auf das Krankenbett fallen und rollte mich schluchzend zu einer Kugel ein. Meine Gefasstheit fiel ebenfalls in sich zusammen. Nun war er doch noch gekommen, der Zusammenbruch. Ich war eben auch nur ein Mensch, dachte ich. Vor allem war ich aber eins: Mutter. Ich griff zu dem Telefon, das auf dem Nachttisch stand, und rief meine Schwiegermutter an, die mich und Daniel an diesem Tag besuchen wollte. Tränenerstickt berichtete ich ihr von Daniels blauen Lippen, seinem Schwitzen und von der Untersuchung beim Kardiologen. Als ich zu der Stelle kam, an der Dr. Williams mir die Diagnose mitgeteilt hatte, brauchte ich vier Anläufe, bis ich das Untersuchungsergebnis über die Lippen brachte, ohne dass meine Stimme wegbrach.
Meine Schwiegermutter weinte ebenfalls am anderen Ende der Leitung. »Aber wie konnte das bloß passieren?«, fragte sie und brachte mich damit ins Grübeln. Als wir aufgelegt hatten, trat ich an das große Fenster des Krankenzimmers. Ich schaute hinaus, ohne irgendetwas wahrzunehmen. Meine Gedanken ratterten unaufhörlich um diese eine Frage, die mir meine Schwiegermutter gestellt hatte. Wie konnte das bloß passieren? Trug ich am Ende sogar die Verantwortung für Daniels Krankheit? Hatte ich einen Fehler gemacht?
Pauls Mutter hatte versprochen, sofort zu mir und Daniel zu kommen. Zuvor hinterließ sie meinem Mann noch eine Nachricht auf der Arbeit, dass er nach der Schicht direkt ins Krankenhaus fahren sollte. In diesen schweren Stunden war ich unendlich froh über die praktische, aber vor allem moralische Unterstützung, die ich durch meine Familie erfuhr.
Für meinen Mann Paul war die Diagnose ebenfalls ein großer Schock. Paul war ein gestandener Mann, den normalerweise nichts so schnell aus der Bahn warf. Ich hatte ihn noch nie zuvor weinen sehen. Er war kein besonders emotionaler Mensch. Doch nun heulte er wie ein Schlosshund und schämte sich seiner Tränen nicht, als ich ihm erzählte, dass unser Baby nur ein halbes Herz hatte.
»Ich werde dich und Daniel bei allem unterstützen, was auch kommen mag. Wir stehen das gemeinsam durch. Dafür sind wir eine Familie«, versprach mir Paul und küsste mich auf die Stirn.
»Ja, das sind wir«, antwortete ich ihm dankbar. Es tat so gut, diese Worte zu hören, und ich glaubte fest an jedes einzelne von ihnen.
Am gleichen Tag fing für Daniel im Krankenhaus eine Medikamententherapie an. Die Ärzte beobachteten genau, wie mein Baby auf die Arzneien reagierte, und nach vierzehn Tagen durften wir schließlich, zur großen Erleichterung unser aller, nach Hause. Die Ärzte glaubten, dass Daniels weitere Behandlung auch ambulant möglich wäre.
Dies war ein sehr glücklicher Tag für mich, denn er vermittelte mir den Eindruck von etwas Normalität. Obwohl natürlich nichts normal war. Wie sollte dies auch möglich sein mit einem Kind, das nur ein halbes Herz hatte? Trotzdem fühlte es sich für mich wie ein großer Fortschritt an, das Krankenhaus gemeinsam mit meinem Sohn verlassen zu dürfen. Zwei Wochen in einem Hospital sind schon unter erträglicheren Umständen furchtbar und vor allem anstrengend. Die Zeit vergeht einfach nicht, weil sich alles wiederholt. Die Tage fühlen sich durch die routinierten, immer wiederkehrenden Abläufe endlos an, und man hat das Gefühl, ewig auf der Station gefangen zu sein. Doch damit war jetzt Schluss. Endlich.
Beim Betreten unseres schönen Hauses fühlte ich mich mit einem Mal wie befreit, als würde eine zentnerschwere Last von mir abfallen. Endlich wieder zu Hause. Endlich kein steriler Krankenhausgeruch mehr und keine surrenden und piepsenden Geräte, mit denen mein Sohn überwacht wurde.
Ich erinnere mich noch genau an Daniels ersten Abend in seinem eigenen Kinderbettchen. Dieses friedliche Bild hat sich für immer in mein Gedächtnis und in mein Herz gebrannt. In diesem Moment war ich fast so glücklich, als hätte es die niederschmetternde Diagnose nie gegeben. Irgendwie glaubte ich sogar an ein Happy End. Ich weiß, das hört sich ziemlich naiv an, aber ich bin eben eine hoffnungslose Romantikerin und brauchte die Gewissheit, dass am Ende alles gut werden würde. Und wenn am Ende nicht alles gut war, dann war es bekanntlich noch nicht das Ende. Ich war jedenfalls nicht bereit, an dieser Lebenseinstellung zu zweifeln. Nicht jetzt und auch zukünftig nicht. Sollte kommen, was wolle.
Ich hatte mir fest vorgenommen, trotz der belastenden Situation durch Daniels Herzerkrankung den Alltag mit der Familie so normal wie möglich fortzuführen. Dies war ich schon Ryan schuldig, der als gesundes und älteres Kind ohnehin zwangsläufig zu kurz kommen würde, darüber war ich mir im Klaren. Das ließ sich unter diesen Umständen einfach nicht vermeiden. Jedoch wollte ich mein ältestes Kind so wenig wie möglich davon spüren lassen. Also machte ich Ryan morgens wie immer für die Schule fertig und bereitete Frühstück vor. Daniel fütterte ich alle drei Stunden und gab ihm die verordneten Medikamente, wie es die Ärzte festgelegt hatten. Gleichzeitig führte ich den Haushalt weiter. Ich kochte, putzte, wusch die Wäsche und stellte sicher, dass der Kühlschrank stets gefüllt war. Nachmittags schaute ich nach Ryans Schulaufgaben, brachte ihn zum Sportverein oder zu Freunden, mit denen er zum Spielen verabredet war. Nebenher kümmerte ich mich um meinen Mann, so wie ich es all die Jahre zuvor getan hatte. Die einzige Veränderung, die sich durch Daniels Krankheit ergab, betraf meine Arbeit im Kosmetiksalon, die ich vorläufig einstellte. So leid mir dieser Schritt auch tat, er war notwendig, um mich intensiv um mein krankes Baby kümmern zu können.