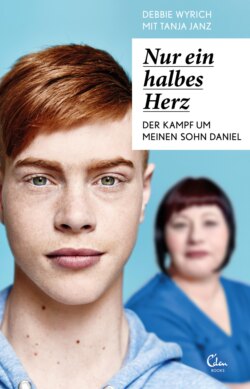Читать книгу Nur ein halbes Herz - Tanja Janz - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4
Was tun?
Zuerst lief alles ganz gut, und es hatte den Anschein, als hätte sich eine Art Alltag in unserem Leben eingestellt. Das Einzige, was mich beunruhigte, war Daniels Verhalten. Der Kleine weinte den lieben langen Tag und ich hatte das Gefühl, es wurde immer schlimmer.
»So geht das nicht weiter. Daniel weint fast ununterbrochen, und das schon seit fast fünf Monaten«, sagte ich zu meiner Schwiegermutter, die am Morgen mit meiner Schwester Ute zu Besuch gekommen war, um mit mir die letzten Details für Daniels Taufe am nächsten Tag zu besprechen. Wir standen zu dritt in unserer großen Wohnküche, ich hielt mein Baby auf dem Arm und versuchte vergeblich, es zu beruhigen.
»Vielleicht hat er Hunger?«, überlegte meine Schwiegermutter und bereitete daraufhin ein Fläschchen für Daniel vor.
Ich glaubte nicht daran, dass mein Baby Hunger hatte. Zu oft hatte ich schon mit einem Fläschchen probiert, ihn zu beruhigen, was jedes Mal nur dazu geführt hatte, dass der Kleine sich übergab.
»Gibst du ihn mir?«, fragte mich meine Schwester.
Ich legte Daniel in die Arme seiner Tante, die ihm den Sauger an die Lippen hielt. Doch kaum hatte mein Baby ein paar Schlucke getrunken, übergab er sich auf ihren Oberkörper und schrie wie am Spieß.
»Das ist wirklich nicht normal«, sagte Ute und wiegte Daniel in ihren Armen, um ihn zu beruhigen.
Ich nahm ihr mein Baby ab und reichte ihr einen feuchten Lappen und Küchentücher, damit sie sich säubern konnte.
»Hast du das dem Kinderarzt mal gesagt?«, fragte meine Schwiegermutter, obwohl sie die Antwort bereits kannte.
»Dem Kinderarzt? Du meinst wohl ›den Kinderärzten‹. Wir waren bei mindestens zehn verschiedenen«, antwortete ich und strich meinem Sohn beruhigend über den Rücken. Ich fühlte mich so hilflos, denn alles, was ich tun konnte, war zuzusehen, wie sich mein geliebtes Kind quälte. Ich konnte ihm nicht helfen. Ich wusste nicht wie. Wie sollte ich auch, wenn nicht einmal die Kinderärzte einen Rat wussten?
»Und was haben die Ärzte gesagt?«, erkundigte sich meine Schwester.
»Nichts.« Ich zuckte die Schultern. »Sie konnten nichts finden. Die letzte Ärztin hat sogar offen zugegeben, wie ratlos sie war, weil sie keine klare Ursache für Daniels Symptome benennen konnte.«
Meine Schwiegermutter schüttelte den Kopf und schaute unglücklich drein. »Das ist wirklich schlimm. Meine Güte, wie soll das nur morgen bei der Taufe werden? Es soll doch ein schöner Tag werden.«
»Wieso? Morgen gibt es perfektes Juniwetter«, entgegnete ich sarkastisch. »Deinen schönen Tag kriegst du also.«
»Ach, Debbie! Als würde ich das meinen … du und dein schwarzer Humor! Also wirklich!«
»Sorry, Schwiegermama. Manchmal bleibt mir einfach nichts anderes übrig, als einen Witz zu machen. Auch wenn er nicht immer ganz passend ist«, sagte ich entschuldigend und streichelte Daniels Kopf. Die kreisenden Bewegungen meiner Hand beruhigten ihn ein wenig. Seine Schluchzer wurden weniger und irgendwann war er auf meinem Arm eingeschlafen.
Für Daniels Taufe am nächsten Tag hatten wir uns eine deutsche evangelische Kirche in Port Elizabeth ausgesucht. Neben unserer Familie waren auch viele Freunde und Nachbarn eingeladen, die alle gekommen waren, um der feierlichen Zeremonie beizuwohnen. Ich war schon immer ein gläubiger Mensch gewesen, und deshalb war es für mich besonders wichtig, dass dieser christliche Ritus vollzogen wurde und mein Kind dadurch in die evangelische Gemeinde aufgenommen wurde und Gottes Nähe spüren konnte. Außerdem war ich davon überzeugt, die Zeremonie würde ihm zusätzliche Sicherheit geben, weil auch Gott danach seine Hände schützend über Daniel ausbreiten würde.
Sobald Daniel am Tag seiner Taufe aufgewacht war, fing er wieder an zu weinen. Ich fütterte ihn und er erbrach sich wieder mal auf meiner Schulter, während ich versuchte, ihn zu beruhigen. Es war immer das Gleiche, und manchmal fragte ich mich, ob es nicht besser wäre, wenn er nicht gefüttert würde, damit er sich das anstrengende Erbrechen sparen konnte. Aber das ging natürlich auch nicht. Wie sollte mein Kind sonst existieren? Daniel spuckte zwar die meiste Nahrung wieder aus, doch verblieb so wenigstens ein kleiner Teil in seinem Körper, von dem er zehren konnte. Es fühlte sich für mich wie ein Teufelskreis an, aus dem ich keinen Ausweg fand. Abends betete ich oft zu Gott und bat ihn darum, mir zu helfen, einen Kinderarzt zu finden, der die Ursache für Daniels Erbrechen finden und ihn heilen würde. Ich glaubte immer noch ganz fest daran, dass wir diesen Arzt mit Gottes Hilfe ausfindig machen würden.
Auf der Fahrt zur Kirche weinte mein Baby ohne Unterlass. Ich tupfte ihm die Tränen mit einem Taschentuch ab und redete beruhigend auf ihn ein. Er sah einfach zauberhaft aus in seinem Taufkleidchen. Fast wie ein Engel.
In der Kirche wurden wir schon vom Pastor und den eingeladenen Gästen erwartet. Der Altarbereich war festlich mit Blumen und großen brennenden Kerzen geschmückt. Davon ließ sich Daniel allerdings nicht beeindrucken. Er weinte während der gesamten Zeremonie ununterbrochen. Besonders als der Pastor beim Taufakt seinen Kopf mit Wasser benetzte, schrie mein Baby wie am Spieß. Einerseits war ich völlig gerührt von der Tatsache, dass mein Kind nun in die christliche Gemeinschaft aufgenommen war, andererseits zerriss es mir fast das Herz, den kleinen Mann so leiden zu sehen. Um Daniel nach der ›Wassertaufe‹ wieder etwas zu beruhigen, wurde er von Arm zu Arm gereicht. Allerdings wurde sein Weinen dadurch nicht besser, im Gegenteil.
Je länger mein Kind weinte, umso mehr spürte ich, wie sich ein starkes Gefühl von Verzweiflung in mir ausbreitete. Dies führte dazu, dass ich nachts keine Ruhe mehr fand und in die Dunkelheit lauschte, ob mein Sohn wieder zu weinen anfing. Was konnte ich bloß tun, damit es meinem Kind besser ging? Was stand überhaupt in meiner Macht? Ich war seine Mutter – war es da nicht meine Pflicht, eine Lösung für ihn zu finden? Ich durfte nicht aufgeben und musste weiter nach dem passenden Arzt suchen. Das war ich meinem Baby schuldig.
Am nächsten Tag rief ich bei einer Gemeinschaftspraxis von Kinderärzten an, um einen Termin auszumachen. Der elften Praxis innerhalb weniger Monate. Wir hatten Glück und durften sogar am selben Morgen noch in die Arztpraxis kommen. Nach einer kleinen Wartezeit wurden wir aufgerufen. Dr. White war für uns zuständig, ein ziemlich junger Kinderarzt, der vermutlich erst vor nicht allzu langer Zeit die Universität verlassen hatte. Ich war mir nicht sicher, ob jung und dynamisch das Richtige für uns war oder ob wir nicht besser bei einem älteren und erfahrenen Arzt aufgehoben gewesen wären.
»Was hat Ihr Kind für Beschwerden?«, fragte der junge Arzt mich.
Ich legte ihm die bisherigen ärztlichen Befunde vor und erzählte ihm die wichtigsten Details der letzten Monate. Er hörte mir konzentriert zu und schaute dabei immer wieder auf die Berichte seiner Kollegen. »Aufgrund Ihrer Schilderungen rate ich Ihnen zunächst von Muttermilch komplett ab. Es scheint mir bei Ihrem Sohn eine Unverträglichkeit vorzuliegen«, sagte er.
Das verwunderte mich. »Aha? Ich dachte immer, Muttermilch wäre das Beste, was ein Baby bekommen könnte.«
»Das ist ja auch so, Mrs Meyer.« Er nickte. »Doch wenn das Kind gegen Muttermilch eine Unverträglichkeit hat, dann nützt uns das leider gar nichts.«
Das leuchtete mir ein. »Und was soll er stattdessen bekommen?«
»Versuchen Sie ihn mal mit Sojamilch zu füttern«, schlug der Arzt vor. »Damit habe ich in den meisten Fällen gute Erfahrungen gemacht, wenn eine Unverträglichkeit auf Muttermilch vorlag.«
Das machte mir Mut. Dr. White schrieb mir passende Produkte für mein Baby auf und ich machte mich mit neuer Entschlossenheit auf den Weg zur Drogerie. Hoffentlich war das nun des Rätsels Lösung. Immerhin hatte Dr. White überhaupt einen Vorschlag gemacht und nicht wie die anderen Ärzte bloß mit den Schultern gezuckt. Auch stimmte mich seine Bemerkung optimistisch, er hätte bereits gute Erfahrungen bei anderen Babys gemacht, die ebenfalls allergisch auf Muttermilch reagierten.
Doch auch diese Umstellung brachte keine Verbesserung. Daniel heulte nach wie vor ohne große Pausen. Ich wurde erneut mit meinem Sohn bei Dr. White vorstellig, um ihm davon zu berichten, dass Daniels Weinen nicht von der Muttermilch kommen konnte. Ich hoffte sehr darauf, einen neuen Ratschlag von ihm zu bekommen, der uns vielleicht dieses Mal auf die richtige Fährte führen wurde.
Doch meine Hoffnungen wurden enttäuscht. »Da bin ich jetzt auch mit meinem Latein am Ende«, sagte der Kinderarzt und zuckte stattdessen hilflos mit den Schultern – wie schon diverse andere Ärzte vor ihm.
Für mich war das Gespräch wie ein niederschmetterndes Déjà-vu. Ich fühlte mich gefangen wie in dem Film Und täglich grüßt das Murmeltier, in dem Bill Murray in der Rolle des Phil Connors immer wieder denselben Tag durchlebt. Ich wollte nicht mehr in einem Hamsterrad laufen, ohne einen Zentimeter vorwärtszukommen, deshalb konnte ich meine Enttäuschung kaum vor Dr. White verbergen. Dass ich so große Hoffnungen in diesen jungen Arzt gelegt hatte und nun wieder bei Punkt Null angelangt war, machte mich ziemlich fertig.