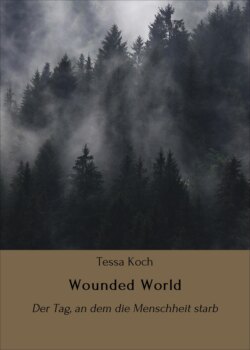Читать книгу Wounded World - Tessa Koch - Страница 5
12. Juli 2021, DIE FLUCHT
ОглавлениеLogbuch-Eintrag 02
Wir sind seit Stunden unterwegs, erst jetzt gönnen wir uns unsere erste Pause. Meine Lungen schmerzen, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in meinem Leben so lange am Stück gerannt bin. Am liebsten wäre ich noch immer in Bewegung, mein Herz schlägt so schnell gegen meine Rippen, dass es wehtut. Ich weiß, dass es Angst ist. Tiefe, schwarze, unendliche Angst.
Den ganzen Weg über habe ich mich immer wieder umgedreht, geschaut, ob sie uns noch immer folgen. Auch jetzt, während ich schreibe, umklammere ich mit meiner anderen Hand fest den Hammer. Ich weiß, dass ich ihn so schnell nicht mehr aus der Hand legen werde.
Dabei kann ich nicht einmal sagen, wie es passiert ist. Was passiert ist, zur Hölle. Ich verstehe es nicht und weiß, dass ich es auch eigentlich gar nicht verstehen möchte. Es ist keine drei Tage her, dass die Welt noch normal gewesen ist, dass alles so war wie immer. Und nun, keine 72 Stunden später, liegt alles in Trümmern. Die Erde, wie wir sie kannten, existiert von nun an nicht mehr.
Zuerst nehme ich den Schmerz in meinem Kopf wahr, ehe ich wirklich zu mir komme. Es ist ein starkes Pochen in meiner Stirn. Meine Hand fährt hoch, betastet meinen Kopf und ich spüre etwas Warmes an meinen Fingern. Langsam, ganz langsam öffne ich die Augen und betrachte meine Hand; sanft fließt das Blut von meinen Fingerspitzen über den Ballen auf mein Handgelenk zu.
Ich ächze leise, als ich mich aufsetze und mich umsehe. Es dauert nur wenige Minuten, bis ich das Wohnzimmer wiedererkenne und mich erinnere. Clarissa muss mich mit dem Messerblock niedergeschlagen und dann zurückgelassen haben. Weil sie nicht wollte, dass ich mit ihr und Adam aus Washington fliehe, vor den Untoten, die in diesem Augenblick langsam aber sicher die Stadt übernehmen.
Tausende verschiedene Schimpfwörter für Clarissa schießen mir durch den Kopf, ebenso wie diverse Möglichkeiten, wie ich mich an ihr dafür rächen kann, dass sie mich einfach hier zurückgelassen hat. Doch weiß ich auch, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, um über solche Dinge nachzudenken. Ich will mich an den langen Vorhängen auf die Beine ziehen, doch die Gardinenstange gibt unter meinem Gewicht nach und stürzt auf mich hinab. Leise fluchend trete ich die Gardine weg und stemme mich dann hoch. Ich rücke Gürtel und Rucksack zurecht, dann gehe ich zu den Fenstern. Als ich hinaus schaue, sehe ich, dass der Jeep fort ist, zusammen mit Adam und Clarissa. Sie haben mich tatsächlich einfach hier gelassen.
„Scheiße.“ Mit zügigen Schritten gehe ich auf die geschlossene Tür zu. Ich weiß nicht, wie lange ich bewusstlos gewesen bin, wie viel Zeit ich verloren habe und was in der Zwischenzeit passiert ist. Doch ich weiß, dass ich nun meinen eigenen Weg aus Washington finden muss. Nach wie vor glaube ich, dass es außerhalb der Stadt sicherer sein muss, fern so vieler Menschen. Daher ist es umso wichtiger aus Washington zu fliehen, ehe die gesamte Stadt von Zombies eingenommen worden ist.
Ich erreiche die Tür. Doch als ich sie öffnen will, tut sich nichts. „Dieses Miststück!“, zische ich, als ich mich gegen das Holz werfe. Aber es bringt nichts, die Tür ist nach wie vor verschlossen. Clarissa hat mich in diesem verdammten Raum eingesperrt. „Scheiße!“ Suchend blicke ich mich in dem Raum um und begreife schnell, dass der einzige Weg aus dieser Wohnung die Fenster sind.
Ich durchquere das Wohnzimmer erneut und öffne dann das breite Fenster. Mit einer Hand fest um den Rahmen beuge ich mich halb hinaus, um mich umzusehen. Unter mir geht es gute fünfzehn Meter in die Tiefe, nichts ist zwischen mir und der Straße, das einen freien Fall bremsen würde. Meinen freien Fall. Rechts von mir ist ebenfalls gähnende Leere, links ein kleiner Vorsprung, der zu der Feuerleiter des Hauses führt. Aus dem benachbarten Schlafzimmer wäre dieser problemlos zu erreichen, so allerdings liegen gute drei Meter zwischen mir und der Feuertreppe.
Meine Knie werden weich, als ich einsehen muss, dass ich keine andere Wahl habe als über die Fenstersimse zu dem Vorsprung bei der Feuerleiter zu klettern, wenn ich aus dieser gottverdammten Wohnung möchte. Mein Herz überschlägt sich fast vor Angst in meiner Brust, als ich wieder in die Tiefe blicke und die Bilder zu verdrängen versuche, die mich zerschmettert auf dem Teer liegend zeigen. Ich bin noch nie ein großer Freund der Höhe gewesen. Außerdem haben inzwischen auch mehrere Untote ihren Weg in die Gasse gefunden, torkeln durch die nasse Straße, auf der Suche nach einer Beute. Sollte ich herunterfallen und den Sturz überleben, so würden sie zweifelsohne über mich herfallen.
Ich ziehe mich aus dem Fenster zurück und blicke mich wieder im Wohnzimmer um, auf der Suche nach etwas, das mir dabei hilft, lebend bei der Feuerleiter anzukommen. Die Simse sind keine vierzig Zentimeter breit, es wird zwar nicht unmöglich aber dennoch äußerst schwierig sein auf ihnen die Balance zu halten. Mein Blick bleibt an der Gardinenstange hängen. Ich knie mich hin und untersuche sie. Die Enden sind nur aufgeschraubt, damit man die Vorhänge leicht wechseln kann. Ich drehe einen ab und betrachte ihn. Er ist gute fünfzehn Zentimeter lang und aus Edelstahl. Ich versuche das Material mit bloßen Händen zu verbiegen, doch es gelingt mir nicht.
Ein Plan formt sich in meinem Hinterkopf, als ich mir das Stück in die Gesäßtasche schiebe und auch das andere Ende von der Gardinenstange schraube. Ich gehe zurück zum Fenster und hänge mich erneut raus. Meine Augen suchen das Gemäuer um mich herum ab und ich finde schnell, wonach ich suche; rissige, teilweise herausgebrochene Fugen. Mit einer Hand wieder fest am Rahmen beuge ich mich weit aus dem Fenster und ramme dann mit Kraft das Gardinenendstück in die Fuge. Es bleibt tatsächlich in dem Spalt stecken.
Wieder werfe ich einen Blick in die Tiefe, dann steige ich durch das Fenster auf den schmalen Sims. Er ist vom Regen rutschig, doch ich bin dankbar, dass es inzwischen nur noch leicht nieselt. Vorsichtig taste ich nach dem Endstück und halte mich daran fest, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Meine zerschnittene Hand schmerzt, doch ich ignoriere es angestrengt. Ich versuche, so wenig Gewicht wie möglich auf meinen improvisierten Griff auszuüben, als ich auf den benachbarten Sims steige. Behutsam gehe ich in die Knie, mit der linken Hand das Gardinenstück fest umfasst, mit der rechten den Rand des Simses.
Für wenige Sekunden verharre ich so, damit mein rasendes Herz sich etwas beruhigt, dann ziehe ich das andere Gardinenstück aus meiner Hosentasche und schlage es in eine weitere Fuge. Ich hole tief Luft, als ich danach greife und auf den nächsten Sims klettere. Wieder verharre ich ein paar Sekunden, um mich auszubalancieren, dann strecke ich meine rechte Hand nach dem rettenden Geländer der Feuerleiter aus. Als ich es fest umfasst habe, lasse ich mit der linken das Gardinenstück in der Wand los und greife auch mit dieser nach dem Geländer. Ich suche nach festem Halt, dann stoße ich mich von dem Sims ab und schaffe es, ein Bein über das Geländer zu schwingen. Ich stoße mit meinem Schambein schmerzhaft gegen das Metall, doch meine Erleichterung, es tatsächlich geschafft zu haben, lässt mich eilig auf den Vorsprung klettern und den Schmerz vergessen. Die Metallplattform kann nicht größer als ein Quadratmeter sein, dennoch ist mir das eingefasste Gitter lieber als die schmalen Fenstersimse.
Ich linse über das Geländer in die Tiefe und zähle die Dinger, die sich bereits in die Gasse verirrt haben. Es sind zwölf Stück, ächzend und stöhnend schlurfen sie durch die Straße. Auch wenn es mir gelingen sollte, sie alle zu töten, so würde der Lärm wohlmöglich nur weitere Untote anlocken. Außerdem wüsste ich auch nicht, wie ich sicher aus der Stadt gelangen sollte, nun wo der Jeep fort ist. Einen letzten Blick nach unten werfend umfasse ich die Sprossen der Leiter und klettere hinauf.
Auf dem Dach des Hauses angekommen, wende ich mich sofort an die Tür, die von hier wieder in das Treppenhaus führt. Noch weiß ich nicht, wie ich aus der Stadt kommen soll, doch bin ich mir sicher, dass es besser ist in einer der Wohnungen einen Plan auszutüfteln. Ich seufze erleichtert auf, als ich feststelle, dass sie dieses Mal nicht verschlossen ist. Schwungvoll reiße ich sie auf und steige die Treppe zu den Wohnungen hinab.
Doch als ich die erste bewohnte Etage erreiche, merke ich sofort, dass es ein Fehler gewesen ist.
Eines der Dinger steht in der geöffneten Wohnungstür, seine milchigen Augen fixieren mich sofort. Mit einem lauten Stöhnen kommt es auf mich zu, die Arme nach mir ausgestreckt. Ein Schrei entfährt mir, als ich im ersten Impuls zurückweiche und stürze. Es kommt weiter auf mich zu, die Finger gekrümmt. In dem Moment, in dem es mich erreicht und nach meinem Knöchel fasst, habe ich den Hammer aus meinem Gürtel gezogen und ihn mit der Finne fest in seinen Kopf gerammt. Das Ding sackt leblos auf mir zusammen. „Oh Gott.“ Ich wuchte ihn von mir herunter, meine Atmung geht viel zu schnell. Es dauert einige Minuten, ehe ich mich halbwegs von dem Schrecken erholt habe.
Und es höre.
Binnen weniger Sekunden bin ich wieder auf den Beinen, hänge mich über das Geländer, um nachzusehen, ob ich mich vielleicht geirrt habe. Doch das habe ich nicht; mindestens zwanzig von diesen Dingern befinden sich im Treppenhaus, sie alle auf dem Weg nach oben, zu mir. Sie müssen durch mein Schreien und das Töten des anderen Zombies auf mich aufmerksam geworden sein. Ich reiße den Hammer an mich, dann renne ich die Stufen wieder zum Dach hinauf. Ich schlage die Tür fest hinter mir zu und sehe mich um. Hier gibt es nichts, wo ich mich verstecken oder vor ihnen in Sicherheit bringen könnte. Kurz überlege ich, wieder die Leiter hinabzuklettern. Doch ich habe Angst, dass sie das vielleicht nicht aufhalten wird und sie mir folgen. Und dann würde ich in der Falle sitzen.
So wie jetzt.
Ich höre das Ächzen der Tür. Als ich mich umdrehe, sehe ich sie auf das Dach kommen. Ihre milchigen Augen schauen sich um, fast so, als wüssten sie nicht mehr, weswegen sie den Weg hierher auf sich genommen haben. Doch dann sehen sie mich am Rande des Daches stehen, den Hammer nutzlos in der Hand. Ein Fauchen erhebt sich, als sie geschlossen auf mich zu kommen, ihre Finger zucken gierig. Es sind mindestens sechs, dem ersten tropft noch immer frisches Blut von den Zähnen. Vielleicht würde es gleich mein Blut sein.
Panisch blicke ich mich um und sehe nur einen Ausweg. Kurz schließe ich die Augen, versuche den letzten Rest Mut in mir zusammenzukratzen. Dann hole ich so weit Anlauf, wie es mir möglich ist, laufe los und springe dann vom Rand des Daches ab. Während ich durch die Luft fliege, rudere ich hilflos mit den Armen, reiße sie im nächsten Moment nach vorne, um meinen Aufprall abzufedern. Ich schlage auf der rechten Schulter auf und überschlage mich einmal, ehe ich auf dem Bauch schlitternd zur Ruhe komme. Mit einem leisen Ächzen stemme ich mich hoch und sehe dann zu dem benachbarten Haus, auf dem ich soeben noch gewesen bin. Die Untoten müssen nur Zentimeter hinter mir gewesen sein, vier von ihnen wanken orientierungslos auf dem Dach umher. Vorsichtig nähere ich mich dem Rand des Daches und blicke über die kniehohe Mauer; zwei weitere liegen zerschmettert auf dem Boden, sie haben versucht mir zu folgen und sind in die Tiefe gestürzt.
„Heilige Scheiße“, flüstere ich, als ich die Blutlachen um die Toten betrachte. Ich könnte genauso gut dort unten liegen.
„Das wollte ich auch gerade sagen.“ Erschrocken fahre ich herum, den Hammer kampfbereit erhoben. „Ey, willst du mir etwa den Schädel einschlagen, Blondie?“ Ein junger Mann kommt hinter den breiten Lüftungsschächten hervor. Er hat seine Hände erhoben, als wolle er sich ergeben, doch ein jungenhaftes Grinsen ziert sein Gesicht. „Und ich dachte du freust dich, noch einen lebenden Menschen in dieser gottverdammten Stadt zu treffen.“
„Wer bist du?“ Ich halte den Hammer nach wie vor erhoben.
„Mein Name ist Liam O‘Malley.“ Sein Grinsen verschwindet langsam. „Willst du das Ding da nicht mal runter nehmen?“
Ich gehe nicht auf seine Frage ein. „Was machst du hier?“
„Tja, ich würde sagen, ich versuche zu überleben, irgendwie.“
„Auf dem Dach?“
„Naja.“ Er lässt langsam seine Hände sinken. „Das ganze Wohnhaus ist voll von diesen Dingern, ich wusste nicht, wo ich sonst hin sollte.“ Er deutet auf die Tür, die er mit einem breiten Brett versperrt hat, das unter die Klinke geklemmt ist. „Und ich muss zugeben, dass es ziemlich amüsant war zu beobachten, wie du dich aus der Wohnung befreit hast.“ Nun grinst er wieder spitzbübisch.
Zögerlich lasse ich den Hammer sinken. „Du hast mich beobachtet?“
„Nimm’s mir nicht übel, Blondie, aber es war ziemlich unterhaltsam. Außerdem dachte ich, falls du das alles überlebst, würdest du eine ziemlich gute Gefährtin abgeben.“
„Gefährtin?“ Ich hänge den Hammer wieder in meinen Gürtel.
„Ja, du weißt schon. Du und ich, gegen den Rest der Welt und so.“ Eine seine Brauen wandert in die Höhe, sein Grinsen unverändert. „Eine Apokalypse macht viel mehr Spaß, wenn man Gesellschaft hat, habe ich gehört.“
„Wie bist du hierher gekommen?“ Ich blicke mich auf dem Dach um.
„Ganz altmodisch über die Treppe. Ich dachte, dass von Dach-zu-Dach-springen überlasse ich dir, Blondie.“
Meine Augenbrauen ziehen sich ärgerlich zusammen. „Und davor?“
Er seufzt. „Bist du immer so?“
„Ich versuche nur festzustellen, ob du gefährlich bist.“
„Gefährlich?“ Er lacht auf. „Komm mal mit.“ Er dreht mir den Rücken zu und geht zu den Lüftungsschächten zurück. Ich zögere kurz, dann folge ich ihm, eine Hand zur Sicherheit auf dem Hammer. Als ich um die breiten Schächte herumgehe, sehe ich mehrere auf dem Boden ausgebreitete Decken. Auf ihnen ein Schlafsack, mehrere gestapelte Dosen, eine große Flasche Wasser und eine E-Gitarre. „Seit das alles begann, hause ich hier oben. Ich habe mich hinter den Schächten versteckt, weil ich mir nicht sicher war, ob du vielleicht gefährlich bist.“
„Das bin ich ganz bestimmt nicht“, sage ich leise. „Sieht bequem aus“, füge ich dann hinzu.
„Kein Fünf-Sterne-Hotel, aber es ist okay.“ Er wirft mir einen schnellen Blick zu. „Du hast ganz schön viel Blut im Gesicht, Blondie, diesen furchtbaren Verband um deine Hand, fliegst einfach so über Dächer … Noch mehr Gründe, weswegen ich mich lieber erstmal vor dir versteckt habe.“
Sofort fasse ich mir ins Gesicht. „Ja, ich habe eines von diesen … diesen Dingern im Treppenhaus erledigt.“ Mein Blick fällt auf meine bandagierte Hand, der Verband ist dreckig und sie pocht unangenehm, jetzt wo ich wieder an die Verletzung denke.
„Du hast einen Parasiten getötet? Nicht schlecht.“
„Parasiten? So nennst du sie?“
„Ja.“ Mit einem leisen Schnauben setzt er sich auf die Decken und bietet auch mir einen Platz an. Ich setze mich ebenfalls. „In der Rede vom Präsidenten sprach er von einem Virus, der die Menschen so werden lässt. Rw-irgendwas. Deswegen Parasiten.“
Ich muss tatsächlich kurz lachen. „Gefällt mir.“
„Und mir gefällt, dass du lachen kannst, Blondie.“ Er legt den Kopf leicht schief.
„Eve Baker“, sage ich. Ich habe beschlossen, dass ich ihm trauen kann. „Das ist mir irgendwie lieber als Blondie.“
„Alles klar. Blondie gefällt mir aber auch“, grinst er und nickt zu meinem hellen Schopf.
Ich erwidere sein Grinsen. „Und wie sieht dein Plan aus, Liam? Dich hier oben auf dem Dach häuslich einrichten und hoffen, dass diese Invasion irgendwie vorübergeht?“
„Oh, ganz sicher nicht. Bis dahin würde ich hier oben wahrscheinlich verhungern.“ Er seufzt, schaut mit zusammen gezogenen Brauen auf seine Hände. „Ich will hier raus. Irgendwohin, wo keine Parasiten sind, wo man leben kann, ohne Angst haben zu müssen.“ Er schweigt kurz. „Und du?“
„Ich auch.“ Ich blicke über die vielen Dächer Washingtons, male mir aus, wie viele Parasiten inzwischen unter diesen sein müssen. „Das war von Anfang an der Plan, doch dann kam das.“ Ich sehe wieder zu Liam und deute auf meine Stirn. „Als das alles begann, war ich gerade bei meinem Ex-Freund und seiner bescheuerten neuen Freundin. Ich wollte nur ein paar Sachen zu ihm bringen und auf einmal war ich in ihrer Wohnung gefangen.“ Ich seufze schwer. „Wir wollten uns einen Wagen holen und raus aus Washington. Doch Clarissa hat mich niedergeschlagen, diese verlogene, kleine -“ Ich unterbreche mich. „Als ich zu mir kam, war ich in einer fremden Wohnung eingeschlossen und konnte nur noch durch das Fenster verschwinden.“
„Was im Übrigen sehr beeindruckend war.“ Er lächelt schwach.
„Danke.“ Auch ich muss lächeln.
„Diese Clarissa … Hatte sie schwarze Haare?“
„Ja.“ Meine Augen weiten sich verwundert. „Woher weißt du das? Hast du sie gesehen?“
„Ich habe gestern zwei Leute beobachtet. Sie haben einen Jeep beladen und sind dann abgehauen. Der Wagen hatte ein bescheuertes In god we trust hinten drauf. Sag mir mal, wo der Penner ist, während die Menschheit gerade zu Grunde geht.“
„Gestern? Oh scheiße.“ Ich vergrabe das Gesicht in den Händen. Immerhin weiß ich nun, wie viel Zeit ich verloren habe, wie viel Vorsprung Adam und Clarissa haben. Vorausgesetzt … „Weißt du, ob sie es geschafft haben?“ Ich linse zwischen meinen Fingern zu Liam durch.
„Soweit ich es beurteilen kann, ja. Sie haben einige von den Parasiten übergemäht und sind dann Richtung Interstate 395 gefahren.“
„Ich habe ihm doch gesagt, dass er nicht den verdammten Interstate nehmen soll. Der wird bestimmt total verstopft sein!“
„Davon kannst du ausgehen.“ Liam mustert mich. „Ich halte es eh für gefährlich die Straßen zu nutzen. Da unten sind Tausende Parasiten, alle nur auf eine köstliche Mahlzeit aus. Und du scheinst mir ein besonderes Sahneschnittchen zu sein. Nein, am sichersten wird es wohl sein, wenn man sich durch die Kanalisation einen Weg nach draußen bahnt.“
„Das habe ich ihnen auch vorgeschlagen!“ Als ich seine amüsierte Miene sehe, räuspere ich mich. „Äh, ich meine, als wir diskutiert haben, wie man hier am besten rauskommt, hatte ich denselben Gedanken.“ Ich versuche gleichgültig zu wirken, cool. Doch ich spüre bereits, wie ich rot werde.
„Weil du nämlich alles andere als blöd bist. Und du hast schon welche von den Parasiten erledigt, ich wusste gleich, dass es ´ne gute Idee ist, dich anzusprechen.“
„Kann sein.“ Ich werde noch etwas röter. „Was ist denn deine Geschichte?“
„Meine Geschichte?“ Er sieht mich fragend an. Leicht überrascht stelle ich fest, dass er nicht hässlich ist. Seine braunen Haare sind kurz und stehen leicht ab, er hat interessante graue Augen und ein markantes Gesicht. Der Dreitagebart lässt ihn beinahe gefährlich aussehen.
„Naja.“ Ich deute auf sein provisorisches Lager. „Ich gehe mal stark davon aus, dass du hier vorher noch nicht gehaust hast, oder?“
Er lacht auf. „Nein, das habe ich tatsächlich nicht. Ich komme aus New York, weißt du? Ich hatte hier ein Vorstellungsgespräch und auf dem Hinweg … tja, da ist der Zug entgleist.“
Meine Augen weiten sich. „Ich habe es in den Nachrichten gesehen, schrecklich.“
„Ja.“ Wieder ziehen sich seine Brauen zusammen. „Ich war im letzten Wagon, als die Durchsage kam, es sei etwas auf den Schienen. Inzwischen glaube ich, dass es die ersten Parasiten waren. Naja, wie dem auch sei, weil ich so weit hinten war, bin ich nochmal mit dem Schrecken davongekommen. Doch es waren so unendlich viele Tote und Verletzte überall … Und auf einmal standen die Toten wieder auf und fielen über den Rest her.“
Er schweigt kurz. „Ich bin abgehauen, so wie alle, die es noch konnten. Als ich zurück in mein Hotel kam, um meine Sachen zu holen, hörte ich von den anderen Unfällen. Ich blieb bis zur Rede des Präsidenten … Du weißt ja, wie sie ausging. Ich bin raus auf die Straße, wollte so schnell wie möglich zum Flughafen. Dann sah ich die ganzen Parasiten, wie sie die Menschen anfielen, sie töteten und diese wiederum zu neuen Parasiten wurden … Nur ein kompletter Vollidiot hätte da noch versucht, sich ganz bis zum Flughafen durchzuschlagen. Ich bin in das nächstbeste Haus geflüchtet und et voila –“ Er breitet einladend die Arme aus „– das ist das Ergebnis meiner wilden Reise. Eine kuschelige Freiluft-Bleibe.“
Ich muss ungewollt kichern. „So schlecht hast du es hier oben eigentlich gar nicht.“
„Nö, mir ist nur jetzt schon das Essen ausgegangen.“ Er deutet auf die leeren Dosen.
Sie erinnern mich an etwas. „Da kann ich dir helfen.“ Ich lasse den Rucksack von meinen Schultern gleiten und ziehe den Reißverschluss auf. „Köstliche Dosen-Ravioli“, sage ich, als ich die Dosen herausziehe. Mein Magen knurrt leise und erinnert mich daran, dass ich das letzte Mal vor vierundzwanzig Stunden etwas gegessen habe. „Bitte.“ Ich reiche ihm eine.
„Meinst du das ernst?“ Er wirkt überrascht. „Wir kennen uns erst seit –“ Er lässt den Ärmel seines dreckigen Pullovers über das Handgelenk rutschen, um auf seine Uhr zu blicken „– fünfunddreißig Minuten und du teilst dein Essen mit mir?“
„Ich habe beschlossen, dass ich dich mag und dir trauen kann. Lass es mich nicht bereuen, ja?“
Er lächelt herzlich. „Das werde ich nicht, Blondie.“
Ich verdrehe kurz die Augen. „Wieso bist du denn noch hier? Noch in der Stadt, meine ich?“
Liam nimmt mir die Dose aus der Hand und öffnet sie für mich. „Ich wollte erstmal beobachten, wie sich alles entwickelt“, antwortet er schlicht. „Die Parasiten beobachten, wie sie sich verhalten und so. Denn wenn du ohne Plan versuchst hier wegzukommen, endest du als einer von ihnen.“ Er öffnet auch seine Dose.
„Das glaube ich zu gern.“
Wir schweigen beide. „Du scheinst ganz gut ausgerüstet zu sein mit deinem Waffengürtel da“, sagt er nach wenigen Minuten.
„Ja.“ Ich zupfe leicht an dem Riemen. „Ich fand ihn in einer Nachbarwohnung und dachte, dass es besser ist als nichts.“
„Es ist sogar sehr gut.“ Ich sehe zu Liam auf. Seine Augen leuchten. „Mit den ganzen Werkzeug kann man sie gut erledigen, ohne allzu viel Lärm zu machen. Ich habe nur das hier.“ Er stellt seine Dose beiseite und kramt in seinem Rucksack. Als er sich mir wieder zuwendet, hat er eine Waffe in den Händen. Ich zucke erschrocken vor ihm zurück und meine Reaktion entgeht ihm nicht. Seine Augen weiten sich verwundert. „Glaubst du wirklich, dass ich dich erschießen würde?“
„Ich – ich weiß nur, dass plötzlich nichts mehr so ist wie es mal war.“
„Da hast du wohl recht … Aber ich werde dir nichts tun. Ich beweise es dir.“ Er wendet sich wieder seiner Tasche zu und kramt solange in ihr, bis er eine weitere Waffe zu Tage fördert. „Ich habe sie einem Polizisten abgenommen, kurz bevor er als einer von ihnen zurückkam. Zusammen mit der Munition. Hier –“ Er hält mir eine der Waffen hin „– ich schenke sie dir.“
Ich zögere. „Ich weiß nicht mal, wie man mit sowas umgeht.“
„Es ist ganz einfach, ich zeige es dir.“ Er legt die Waffe auf seine flache Hand, sodass ich sie gut sehen kann. „Das ist eine Glock, sie wird häufig von der Polizei genutzt. Und sie ist gar nicht so beängstigend, wie du jetzt vielleicht noch glauben magst. Siehst du diesen kleinen Hebel hier, über dem Abzug?“ Er deutet auf Besagten und ich nicke. „Mit diesem entsichert man die Waffe. Jetzt ist sie gerade gesichert, da der Hebel unten ist. Wenn ich ihn nach oben schiebe, ist die Waffe entsichert und somit schussbereit.“ Er schiebt ihn mit den Daumennagel nach oben. „Das heißt aber nicht, dass wir jetzt gleich alle Deckung suchen müssen, denn es gibt eine weitere Sicherung. Und zwar diese Taste hier auf dem Abzug.“
Er deutet auf eine winzige Kunststofftaste, die auf dem eigentlichen Abzug liegt. „Das ist die Abzugssicherung. Nur wenn du diesen kleinen Hebel und den Abzug drückst, kannst du auch tatsächlich schießen. Ansonsten bleibt die Waffe gesichert. Du legst deinen Finger nur auf den Abzug, wenn du auch wirklich schießen willst, das ist wichtig. Dazu visierst du dein Ziel an, am besten immer einen Tick weiter links zielen als du zu treffen beabsichtigst, da die Waffe einen kleinen Rechtsdrall hat, und dann feuerst du. Wichtig ist, dass du immer den Rückstoß bedenkst. Er ist nicht besonders stark, aber wenn du zu nah mit deinem Gesicht an der Waffe bist, kann es im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen. Ansonsten war’s das.“
Er schiebt den Hebel wieder nach unten und reicht mir die Waffe. Ich halte sie spitz in meinen Fingern. „Woher kennst du dich mit sowas aus?“
Er zuckt mit den Schultern. „Man lernst so einiges mit der Zeit.“
Meine Brauen ziehen sich leicht zusammen, ich weiß, dass er mir ausweicht. Doch erstmal werde ich nicht weiter nachfragen. „Also entsichern“, wiederhole ich leise und schiebe den Hebel mit dem Daumennagel nach oben. „Ziel anvisieren.“ Ich blicke über den Lauf der Waffe auf einen der Parasiten, die noch immer auf dem benachbarten Dach sind. Bewusst ziele ich etwas weiter links des Kopfes. „Und den Abzug plus die Taste drücken.“ Mein Zeigefinger legt sich auf den Abzug. Ich halte den Atem an, dann drücke ich ihn durch.
Der Kopf des Parasiten zerplatzt, sein Gehirn spritzt über das Dach. Die Leiche fällt hinten über, gegen einen der anderen Parasiten, der zu fauchen beginnt. Auch die anderen schwanken nun zu dem Toten, doch als sie begreifen, dass er einer der ihren war, lassen sie wieder von ihm ab und wandern weiter ziellos über das Dach.
„Du bist ein Naturtalent!“ Als ich mich zu Liam umdrehe, sehe ich seine vor Überraschung geweiteten Augen. „Die – die wenigsten treffen gleich beim ersten Mal!“
„Bei dem Lehrer“, sage ich schüchtern und lege schnell den Hebel um. Dann lege ich die Glock zwischen uns auf die Decke. Sie macht mir noch immer Angst, doch vor allem beunruhigt mich das Gefühl der Macht, das mich durchströmt hat, als ich eben über das Leben des Parasiten bestimmt habe. Von einer Sekunde auf die anderen war er tot, meinetwegen. Und es hat sich gut angefühlt.
„Behalte sie.“ Liam blickt mich ernst an. „Ich schenke sie dir. Sie wird uns noch nützlich sein, glaube mir. Und ich fühle mich besser, wenn ich weiß, dass du dich notfalls schützen kannst.“ Er nimmt sie von der Decke und hält sie mir wieder hin.
Kurz betrachte ich die Waffe. Dann seufze ich leise und nehme sie ihm ab. Ohne sie mir noch einmal genauer zu besehen, stecke ich sie in die freie Schlaufe an meinem Gürtel. „Ich verstehe wirklich nicht, warum du noch immer hier oben sitzt, wenn du zwei Waffen und Munition hast“, sage ich.
„Ganz simpel. Ich zeige es dir, komm mit.“ Er erhebt sich und hält mir seine Hand hin, um mir aufzuhelfen. Ich ergreife sie und lasse mich von ihm auf die Beine ziehen. Er geht mir voran auf den Rand des Daches zu, er tritt so nahe heran, dass er mit den Schienbeinen gegen die kleine Mauer stößt, die es rahmt. Ich stelle mich neben ihn und blicke hinab auf die Straße. Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte Parasiten befinden sich dort unten. „Ich hatte genug Zeit, um sie zu beobachten. Schau mal auf das Fenster dort, bei dem Café, ja?“
Ich sehe ihn verwundert an, um sicherzugehen, dass er mich nicht auf den Arm nimmt. Doch er schaut ernst drein. Also suche ich das Schaufenster, von dem er gesprochen hat, und fixiere es. Im nächsten Moment zerberstet es, Liams Kugel lässt das Glas in Tausende Splitter zerspringen. Der Lärm hallt durch die ganze Straße, vielleicht sogar durch ganz Washington. Sofort wenden sich einige der Parasiten dem Café zu, schwanken zu dem zersplitterten Fenster. Kurz darauf drängen sich Dutzende von den Dingern um das Café, entweder durch den Lärm dorthin gelockt oder durch die anderen Untoten in die Richtung getrieben.
„Lärm lockt sie an“, sagt Liam leise neben mir und beobachtet geradezu angewidert, wie sie sich gegenseitig schieben und drängen. „Und da sie nicht sonderlich intelligent zu sein scheinen, folgen sie den anderen, wenn sie meinen, dass die etwas Interessantes entdeckt haben.“
„Schwarmintelligenz“, flüstere ich.
Liam lacht leise. „Ja genau. Auf jeden Fall wäre es dumm zu schießen, wenn es nicht wirklich notwendig ist. Und da ich nur die Waffen habe, wusste ich bisher einfach nicht, wie ich ungesehen zu einem der Gullideckel kommen soll, um in der Kanalisation zu verschwinden.“
Ich betrachte noch immer die Parasiten, die sich eng aneinander drängen und frage mich, ob Adam und Clarissa bewusst ist, dass Lärm sie anlockt. Und ob die beiden es wohl geschafft haben. Mein Blick schweift über die Straße und bleibt dann an dem Polizeiauto hängen. Es steht direkt vor dem Eingang unseres Hauses, die Türen noch immer weit aufgerissen. Liams Worte wiederholen sich leise in meinem Kopf, als ich meine Brauen nachdenklich zusammenziehe und das Auto betrachte. „Und was ist“, setze ich langsam an, „wenn wir das ausnutzen?“
„Was ausnutzen?“ Er sieht mich von der Seite an.
Mein Blick ruht noch immer auf dem Polizeiwagen, eine Idee formt sich in meinem Kopf, ein Plan. „Alles.“ Ich reiße mich von dem Auto los und sehe ihn an. „Das mit dem Lärm und der Schwarmintelligenz.“
Seine Stirn legt sich in Falten. „Ich kann dir gerade nicht ganz folgen, Blondie.“
„Es ist ganz einfach.“ Ich fasse ihn sanft am Ellbogen und drehe ihn in Richtung des Polizeiwagens. „Siehst du den Streifenwagen? Er steht direkt vor dem Eingang dieses Gebäudes, das sind keine fünf Meter von der Tür. Wenn wir es nach unten schaffen, könnte einer die Sirenen einstellen, einen Gang einlegen und den Wagen losrollen lassen. Die lauten Sirenen werden sofort sämtliche Parasiten anlocken. Und wenn er die Straße runter rollt, werden sie ihm folgen, weg von uns. Und zwar alle.“ Ich blicke wieder zu Liam auf.
Er sieht mich erstaunt an. Im nächsten Moment hat er seine Arme fest um meine Taille geschlungen und mich hochgehoben. „Du bist brillant, du bist brillant, Blondie! Die anderen werden sich noch in den Arsch beißen, dass sie dich zurückgelassen haben!“ Er dreht uns mehrmals im Kreis und lacht dabei ausgelassen.
„Liam!“, rufe ich. „Bitte, mir wird schlecht!“
Er hält an und setzt mich ab, schiebt mich dann auf Armeslänge von sich. „Das ist unser Ticket raus aus dieser verdammten Stadt, weißt du das?“ Er strahlt mich an.
Ich kann nicht anders als ebenfalls zu grinsen. „Hoffen wir nur, dass der Schlüssel steckt.“
„Das sollte nicht das Problem sein, notfalls schließen wir den Wagen kurz.“
Eine meiner Brauen wandert in die Höhe. „Das kannst du?“
„Sicher – die wichtigere Frage ist nur, wie wir heil nach unten kommen. Das ganze Wohnhaus ist voll mit den Drecksviechern.“ Er blickt zu der versperrten Tür.
„Wir könnten die Feuerleiter nehmen“, wende ich ein, auch ich schaue nun zu der Tür. „Wenn wir leise und schnell sind, werden sie uns nicht bemerken, ehe wir bei dem Polizeiwagen sind. Außerdem habe ich ja tolle Waffen, die keinen Lärm machen.“ Ich deute auf meinen Gürtel. „Und für den Ernstfall haben wir die Pistolen und können immer noch Schutz im Haus suchen.“
Liam sieht mich kurz an. „Also gut, machen wir’s.“ Er geht zurück zu seinem Lager und holt hinter den Schächten einen riesigen tarnfarbenden Rucksack hervor. Er beginnt sorgfältig die Decken zusammenzulegen und in seinem Rucksack zu verstauen, ebenso wie seinen Schlafsack und die Flasche Wasser. Die E-Gitarre fasst er am Hals und dreht sich dann grinsend zu mir um. „Ich bin soweit.“
„Willst du die wirklich mitnehmen?“ Ich zeige auf seine Gitarre.
„Na klar.“ Er wirkt beinahe überrascht über meine Frage. „Wenn die Welt untergeht, braucht man Musik. Du weißt schon, motivierende Kampflieder, wie The Show must go on oder Hell’s Bells oder so.“
„Oder Thriller“, seufze ich, das dazugehörige Video mit den tanzenden Zombies im Kopf.
„Ja genau.“ Er grinst wieder jungenhaft.
„Von mir aus, dann lass uns.“ Ich gehe auf die Feuerleiter zu und will gerade meinen Fuß auf die Mauer setzen, als Liam mich sanft an der Schulter fasst und zurückhält. „Was ist?“ Fragend sehe ich ihn an.
„Man sagt zwar immer Ladies first und so, aber du solltest mich lieber vorgehen lassen.“
„Ich kann gut auf mich selbst aufpassen.“ Sogar ich höre den gekränkten Unterton in meiner Stimme.
Sein Lächeln wird sanft. „Das glaube ich dir sofort. Aber ich fühle mich wohler bei.“
Wieder seufze ich, als ich ihm den Vortritt lasse. Doch ehe er auf die Leiter steigen kann, ziehe ich zwei der Schraubendreher aus meinem Gürtel und halte sie ihm hin. „Und ich fühle mich wohler, wenn ich weiß, dass du noch andere Waffen hast außer deiner Glock.“ Er nimmt sie mir ohne etwas zu sagen ab und schiebt sie zu seiner Glock in den Bund seiner Jeans. Dann beginnt er die Leiter hinabzusteigen, die Gitarre fest unter den linken Arm geklemmt.
Ich werfe einen letzten Blick auf die Straße, sehe, dass die meisten der Parasiten noch immer bei dem Café sind. Sie scheinen tatsächlich nicht allzu intelligent zu sein, denke ich, als ich meinen Fuß auf die erste Sprosse setze und Liam nach unten folge. Etwa zwei Meter über dem Boden hält er inne und macht mich mit einem leisen Pfeifen auf sich aufmerksam. Als ich zu ihm hinunter blicke, nickt er zu einem parkenden Auto zu unserer Rechten. Ich nicke, um ihm zu symbolisieren, dass ich ihn verstanden habe. Er springt die letzten Meter in die Tiefe und läuft geduckt zu dem Auto, von den Parasiten ungesehen. Ich kletterte den Rest lieber und als mein Fuß auf der Straße aufsetzt, nehme ich Hammer und Glock in beide Hände und folge ihm.
„So weit, so gut“, flüstert er mir zu. In der linken Hand hält er nach wie vor seine Gitarre, in der rechten einen meiner Schraubenzieher. Er sieht sich vorsichtig um. „Hier stehen zum Glück viele Autos, wir können uns von Wagen zu Wagen schleichen, bis wir beim Streifenwagen sind.“
„Okay, dann los.“
Wieder schaut er, ob die Luft rein ist, dann rennt er geduckt zum nächsten Fahrzeug, ich dicht hinter ihm. Es dauert keine fünf Minuten, bis wir hinter dem Polizeiwagen hocken. Liam schaut in das Wageninnere und lacht ganz leise. „Schlüssel steckt.“ Erneut schaut er sich um, doch keiner der Parasiten hat uns bisher bemerkt. Sein Blick schweift zu dem Eingang des Hauses, auf dessen Dach wir vor wenigen Minuten noch gestanden haben. „Ich glaube, dass mir fast alle Parasiten nach oben gefolgt sind, als ich in das Haus bin“, flüstert er mir zu. „Also sollte die Eingangshalle sicher sein. Du gehst schon mal dort rein, während ich mich um das Auto kümmere.“
„Nein!“, protestiere ich leise. „Ich lasse dich hier nicht alleine zurück!“
„Aus dem Eingang kannst du mir für den Notfall Feuerschutz geben, falls ein paar von denen auf mich aufmerksam werden.“ Ich will wieder etwas sagen, doch er kommt mir zuvor. „Mach’s einfach, Blondie, bitte.“ Ich werfe ihm einen ärgerlichen Blick zu, dann schaue ich, ob die Luft rein ist und laufe ungesehen zu dem Eingang des Hauses. Vorsichtig drücke ich die Klinke nach unten und öffne die Tür soweit wie nötig. Dann schlüpfe ich in das Haus.
Leise schließe ich die Tür wieder hinter mir, dann drehe ich mich um und suche mit erhobenem Hammer das Haus ab. Rechts von mir sind Dutzende Briefkästen, links führt die Treppe zu den Wohnungen hinauf. Direkt gegenüber von mir ist der Fahrstuhl, die Türen stehen weit offen. Außer mir befindet sich niemand in der Halle. Eilig wende ich mich der Tür zu und öffne sie wieder einen Spalt breit. Ich ziehe die Glock aus meinem Gürtel und entsichere sie, so wie Liam es mir gezeigt hat. Konzentriert umfasse ich sie mit beiden Händen, den Zeigefinger nur Millimeter vom Abzug entfernt, schussbereit, wenn es sein muss.
Liam ist bereits in den Streifenwagen gestiegen, ich sehe ihn halb geduckt hinter dem Steuer. Er lässt den Motor an und das laute Röhren des Motors zieht sofort die Aufmerksamkeit einiger Parasiten auf sich. Im nächsten Moment ertönt das laute Heulen der Sirenen, der Wagen rollt langsam los. Liam springt auf der Beifahrerseite heraus, fasst seine Gitarre und kommt geduckt auf mich zu. Ich öffne die Tür für ihn und schließe sie sofort, kaum dass er in der Halle ist. Die ersten Parasiten haben sich in Bewegung gesetzt, sie folgen tatsächlich dem Polizeiwagen, der langsam die Straße hinab rollt. Ich fasse Liam an der Schulter und lege einen Finger auf meine Lippen, als er sich fragend zu mir umdreht. Leise ziehe ich ihn hinter mir her in den Fahrstuhl und nehme ihm die Gitarre aus der Hand. Ich lege den Hals auf die Schwelle und schließe dann mit dem Knopf die Türen; durch die Gitarre haben wir einen etwa zehn Zentimeter breiten Spalt, durch den wir beobachten können, was vor uns passiert.
„Meine arme Gitarre!“, zischt Liam empört.
„Sei lieber dankbar dafür, dass die Fahrstühle so alt sind, dass sich die Türen nicht automatisch wieder öffnen“, flüstere ich zurück und sichere meine Waffe wieder.
„Woher wusstest du das denn?“
Ich schnaube leise. „Als ich zu meinem Ex bin, um ihm seine Sachen zu bringen, habe ich meinen Fuß eingeklemmt.“ Liam lacht leise, sagt aber dankenswerterweise nichts weiter dazu. „Es funktioniert tatsächlich!“, flüstere ich, als ich Dutzende Parasiten an dem Haus vorbeigehen sehe.
„Klar, dein Plan war ja auch genial. Hoffen wir nur, dass das Auto schön weit kommt.“
„Noch hört es sich so an, als ob es sich immer weiter entfernt“, erwidere ich und lausche.
Auch er horcht kurz. „Was meinst du, wie lange wir warten sollten?“
Ich blicke durch den Spalt und sehe noch immer die Parasiten in Scharen an unserem Haus vorbeiziehen. „Vielleicht so fünf bis zehn Minuten?“
„Würde ich auch sagen.“ Er setzt seinen Rucksack ab und lässt sich dann neben ihm auf dem Boden nieder. „Mach’s dir bequem, Blondie, ein Weilchen dauert’s ja noch.“
„Du sollst mich nicht so nennen.“ Dennoch setze ich mich zu ihm. Er grinst mich nur spitzbübisch an. Ich verdrehe kurz die Augen. „Hast du einen Plan, wie wir uns in der Kanalisation zurecht finden sollen?“
„Naja, wir sind nicht weit vom Potomac River entfernt, wenn wir uns in südwestlicher Richtung halten, können wir nichts verkehrt machen.“
„Und woher wissen wir, dass wir in südwestliche Richtung gehen?“ Liam zieht einen Kompass aus seiner Gesäßtasche und grinst mich an. „Natürlich hast du einen Kompass dabei“, sage ich und schüttele leicht fassungslos den Kopf. „Du scheinst gut auf eine Zombie-Apokalypse vorbereitet zu sein.“
Er lacht leise. „Man muss immer auf einen Ausnahmezustand vorbereitet sein.“
„Ja genau, deswegen hatte ich auch Deo, mein Handy und Pfefferminzbonbons dabei, als ich gestern meine Wohnung verließ.“ Er blickt mich amüsiert an. „Was schaust du denn so? Während du uns den Weg durch die Kanalisation bahnst, sorge ich dafür, dass wir hinterher nicht allzu übel riechen.“
Sein stummes Lachen schüttelt ihn. „Du bist mir eine, verdammt nochmal.“
„Ich weiß, du bist froh mich zu haben.“
„Und wie.“ Dieses Mal lächelt er nicht, sieht mir nur fest in die Augen.
Nach wenigen Sekunden senke ich den Blick. „Ich glaube, die Luft ist langsam rein.“
„Du hast recht.“ Er erhebt sich und setzt sich den Rucksack wieder auf. Dann drückt er auf die Taste, die die Fahrstuhltüren wieder aufgleiten lässt, und nimmt seine Gitarre in die Hand. Kurz mustert er sie eingehend. „Keine Kratzer, dein Glück.“ Er verlässt mir voran den Fahrstuhl und schleicht auf die Tür zu. Er blickt auf die Straße und auch ich schaue über seine Schulter nach draußen. Sie liegt ruhig und verlassen vor uns, rechts kann ich den Strom der Parasiten sehen, der dem Geheul des Streifenwagens folgt, das sich noch immer von uns entfernt. „Dann mal los.“
Liam zieht die Tür auf und tritt nach draußen. Sofort schlägt er die entgegengesetzte Richtung zu den Untoten ein und biegt in die erste Gasse zu unserer Linken. Es ist die, über die ich waghalsig gesprungen bin, die zerschmetterten Toten liegen noch immer dort. Liam schleicht weiter, direkt auf einen Gullideckel zu, der am Ende der Gasse ist. Er geht gerade an den breiten Mülltonnen vorbei, als ich ein leises Ächzen höre. Plötzlich greift eine tote Hand nach Liams Knöchel und bringt ihn zu Fall. Ich sehe ihn hart mit dem Kinn auf dem Teer aufschlagen, seine Glock schlittert über den Boden. Eine weitere Hand fasst sein Bein, ich sehe den Toten, der sich schwer über den Boden zu Liam zieht. Seine Beine fehlen, eine Blutspur zeigt seinen Weg zu den Mülltonnen, hinter denen er gelehnt hat. Der Untote erinnert mich an den Jungen von dem Unfall, dem einer der Beamten mitten ins Gesicht geschossen hat. Die Zähne des Parasiten sind nur Zentimeter von Liams Bein entfernt, als ich nach vorne stürze und den Hammer tief in seinem Kopf versenke. Wieder spritzt mir Blut ins Gesicht, auch Liam bekommt welches ab. Der Junge sackt zusammen, endgültig tot.
„Danke.“ Liam keucht schwer und sieht zu mir mit weit aufgerissenen Augen auf.
„Kein Problem.“ Ich halte ihm meine Hand hin und ziehe ihn schnell auf die Beine. „Wir sollten echt von hier verschwinden.“
„Ja.“ Er wirkt noch immer geschockt, doch er ist schon wieder so weit bei sich, dass er seine Glock einsammelt und weiter auf den Gulli zugeht. „Darf ich mir den mal leihen?“, fragt er und deutet auf meinen Hammer.
„Sei aber vorsichtig, mit dem töte ich am liebsten.“
Er lächelt halbherzig über meinen Scherz, dann schiebt er die Finne in eines der Löcher und hebt den Deckel an. Er zieht ihn wenige Meter weit, dann reicht er mir den Hammer zurück. „Bereit?“, fragt er und sieht mich prüfend an.
Ich blicke in die Dunkelheit unter uns. „Kann’s gar nicht erwarten.“
„Sehr schön.“ Er lässt einen der Träger von seiner Schulter gleiten und zieht den Rucksack nach vorne. Kurz sucht er in einem vorderen Reißverschlussfach, dann holt er zwei Taschenlampen zum Vorschein. Er reicht mir eine. „Lass uns gehen.“ Er zieht seinen Rucksack fest und klemmt sich die Gitarre wieder unter den Arm. Dann steigt er mir voran die Leiter hinab.
Ein leises Seufzen entfährt mir, als ich ihm hinterher sehe. Mein Herzschlag beschleunigt sich etwas, ich muss mir eingestehen, dass ich Angst habe. Dann schalte ich meine Taschenlampe ein und nehme sie fest zwischen die Zähne, während ich meine Füße auf die Sprossen setze. Ich atme ein letztes Mal tief die frische Luft ein, ehe ich Liam hinab folge. „Oh mein Gott!“, stoße ich hervor, nachdem ich die Lampe aus meinem Mund genommen habe. Mit der anderen Hand halte ich mir fest die Nase zu.
„Was hast du erwartet?“ Sein Grinsen wirkt nicht ganz so schelmisch wie zuvor. „Da wird uns dein Deo auch nicht weiterhelfen, was?“
„Kein Deo dieser Welt könnte das bekämpfen.“
Er lacht, während er auf seinen Kompass leuchtet. „Wir müssen hier lang.“ Er deutet nach rechts. „Du hast keine Angst vor Ratten, oder?“
„Ich habe Angst vor übel riechenden Kanalisationen“, erwidere ich dumpf und nehme die Hand von der Nase.
„Wird Zeit, die Phobie zu bekämpfen.“
„Juhu.“
Er grinst, natürlich tut er es. „Lass uns gehen.“
Wir waten langsam durch das knöchelhohe Wasser und ich versuche mir nicht vorzustellen, was da alles um meine Füße herum schwimmt. Zum ersten Mal, seit das alles begonnen hat, bin ich froh, dass ich meine hohen Lederboots angezogen habe und mir das Brackwasser so nicht in die Schuhe laufen kann. Der Schein unserer Taschenlampen durchschneidet die Schwärze und tatsächlich sehe ich hier und da eine Ratte entlang laufen. Doch nach allem, was ich in den letzten Stunden gesehen habe, weiß ich, dass eine Ratte das letzte ist, wovor ich mich fürchten muss.
„Also“, setze ich an, nachdem wir eine ganze Weile schweigend nebeneinander hergelaufen sind. „Du warst bei der Army?“
Er sieht mich überrascht an. „Woher weißt du das?“
„Man muss kein Genie sein, um das rauszukriegen. Du kannst mit ´ner Glock umgehen, hast noch Ansätze dieses typischen Haarschnitts, weißt, wie man ein Auto kurzschließt und der tarnfarbende Militärrucksack erschien mir auch sehr verdächtig.“
„Ja, der Rucksack macht’s“, stimmt er mir zu und ich lache. Dann seufzt er. „Ja, ich war im Fort Meade in Maryland stationiert. Ich hatte mich für fünf Jahre verpflichtet und mein Vertrag lief vor einem Monat aus.“ Er lacht auf. „Kurz bevor das alles hier passiert ist, das nennt man wohl Glück im Unglück, was?“
„Und deswegen das Vorstellungsgespräch hier? Von dem du vorhin erzählt hast?“
„Naja.“ Tatsächlich wird Liam leicht rot. „Ich wollte nicht mein Leben lang bei der Army bleiben, ich habe es mehr meinem Vater zu liebe getan. Ich dachte … naja.“ Er hebt seine Gitarre leicht an. „Ich hatte ein … Vorsingen.“
Überrascht sehe ich ihn an. „Cool“, sage ich dann und lächle breit, als er mich ungläubig anblickt. „Nein, wirklich, ich meine es ernst. Ich singe auch gerne, allerdings nur unter der Dusche. Und irgendwie auch sehr falsch und sehr schief.“
Liam fängt an zu lachen. „Man, Blondie, in deiner Nähe kann man sich gar nicht unwohl fühlen, was?“
Ich nestele an meinem Gürtel herum. „Weiß nicht, ich glaube, dass ich oft nerve.“
„Also mich nicht.“ Er grinst. „Was ist denn deine Geschichte?“
„Hm?“ Gerade bin ich mit dem Strahl meiner Taschenlampe einer weiteren Ratte gefolgt.
„Du kommst nicht aus den USA, oder? Du hast einen leichten Akzent. Deutsch?“
Tatsächlich bin ich beeindruckt. „Nicht schlecht. Ich bin in Hamburg aufgewachsen.“
„Und dann Wahl-Amerikanerin geworden?“
„Nicht ganz.“ Kurz bin ich stumm, dann beschließe ich, dass ich Liam die Wahrheit erzählen kann. Ich habe ihm vertraut, als es um mein Leben ging. Dann sollte ich ihm auch meine Vergangenheit anvertrauen können. „Ich bin hier geboren. Also nicht hier.“ Ich verziehe leicht die Nase, als ich mich in dem stinkenden Schacht umsehe. „Sondern in New York. Mein Vater war Amerikaner, meine Mutter Deutsche. Sie sind extra kurz vor meiner Geburt hergereist, damit ich beide Staatsbürgerschaften habe.“ Ich blicke starr geradeaus in den dunklen Gang. „Sie starben. Meine Eltern. Es war kurz vor meinem achtzehnten Geburtstag, sie hatten einen bescheuerten Motorradunfall. Danach ging es mir … nicht sonderlich gut. Ich trieb mich mit den falschen Leuten herum, kümmerte mich nicht wirklich um meine Zukunft und war auch nicht immer der netteste Mensch. Alles war mir egal mit einem Mal.“ Ich trete eine leere Dose beiseite, die vor mir in dem Brackwasser treibt. „Eines Tages bin ich aufgewacht und habe mich gefragt, was ich da eigentlich tue. Mir wurde klar, dass es so nicht weitergehen kann. Am selben Tag noch packte ich meine Siebensachen, habe all meine Ersparnisse zusammen gekratzt und bin hergekommen.“ Ich zucke mit den Schultern. „Und bin dann irgendwie in Washington hängen geblieben.“
„Das tut mir leid.“ Liam sieht mich bekümmert von der Seite an. „Das mit deinen Eltern, meine ich.“
„Es ist inzwischen vier Jahre her, ich habe mich damit arrangiert, denke ich. Außerdem“, setze ich nach kurzem Zögern hinzu, „ist es vielleicht … naja, besser so. Ich habe sie verloren und das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Aber ich weiß, dass sie tot sind, dass sie wirklich tot sind. Sie laufen nicht auf den Straßen herum und fallen Menschen an. Ich muss keine Angst um sie haben, verstehst du?“
„Ich verstehe ganz genau, was du meinst.“ Seine Lippen sind fest aufeinander gepresst.
Kurz schweigen wir beide. „Was ist mit deiner Familie?“, frage ich leise.
„Sie leben in Arkansas. Meine Eltern haben eine dieser altmodischen Farmen, weißt du? Mit riesigen Viehweiden, Ackerland, Scheunen, das alles eben.“
„Wow, das kenne ich so nur aus dem Fernsehen.“
Er lacht. „Ja, es war eigentlich ziemlich cool dort aufzuwachsen. Doch als ich älter wurde, habe ich es immer mehr gehasst und deswegen irgendwann das Weite gesucht. Meine Brüder haben es mir dann irgendwann nachgemacht.“
„Du hast Brüder?“, frage ich interessiert.
„Ja, drei.“
„Nicht schlecht. Ich habe es immer gehasst Einzelkind zu sein.“
„Aber wie du schon sagtest, ist das in solchen Zeiten vielleicht sogar besser.“ Ich sehe seine Sehnen hervortreten, als er die Taschenlampe krampfhaft umfasst.
„Weißt du“, sage ich, den Blick auf seine Hand gerichtet, „wenn wir jemals aus diesem stinkenden Loch hier raus sind und ich mich mindestens zwanzig Mal geduscht habe –“ Er lacht leise „– dann könnten wir uns doch auf den Weg nach Arkansas machen, was meinst du? Wir wissen doch ohnehin nicht, wo wir hin sollen. Und eine große Farm scheint mir ein guter Platz zu sein für eine Zombie-Apokalypse. Zusammen mit deiner Familie.“
Tatsächlich glaube ich, Tränen in seinen Augen schimmern zu sehen. „Das wäre toll.“
„Dann haben wir einen Plan.“ Ich lächle ihn aufmunternd an.
Er erwidert es. „Du bist also 22?“, lenkt er das Gespräch dann auf ein weniger heikles Thema.
„Und du anscheinend ein Mathe-Genie“, necke ich ihn. „Ja, bin ich.“
Er seufzt wehmütig. „Dann bist du ja noch halb grün hinter den Ohren.“
„Wie bitte? Wie alt bist du denn?“
Er grinst. „25.“
Vor Empörung bleibt mir der Mund offen stehen. „Du bist drei lächerliche Jahre älter und sagst, ich sei noch grün hinter den Ohren?“
„Drei Jahre sind drei Jahre“, lacht er. „Hier müssen wir links“, fügt er dann nach einem Blick auf seinen Kompass hinzu. Wir biegen an der nächsten Gabelung links ab und waten weiter nebeneinander her durch das knöchelhohe Brackwasser. „Sag mal.“ Ich sehe zu ihm auf. Sein Blick ruht sanft auf meinem Gesicht. „Was meintest du vorhin, als du sagtest, du seist nicht immer der netteste Mensch gewesen?“
„Sagen wir mal so.“ Ich lächle halbherzig. „Du bist nicht der einzige hier, der weiß, wie man ein Auto knackt und kurzschließt, okay?“
Er lacht. „Also bin ich in dieser Zombie-Apokalypse mit ´ner Kriminellen unterwegs?“
Ich werde rot. „Nein. Also … nicht mehr. Die letzten Jahre habe ich bei Starbucks gearbeitet, um mein Studium finanzieren zu können.“ Eine seiner Brauen wandert fragend in die Höhe. „Literaturwissenschaften.“
„Nicht schlecht.“
Ich möchte mich bei ihm bedanken, als ich etwas hinter uns höre. Langsam drehe ich mich um, leuchte in den Schacht hinter uns. Das Licht meiner Taschenlampe wird von Dutzenden milchigen Augen zurückgeworfen. „Liam.“ Meine Stimme ist viel zu hoch.
Er dreht sich um, folgt dem Schein meiner Taschenlampe. „Ach du Scheiße …“
„Lauf!“, rufe ich und renne im nächsten Moment selber los. Das Fauchen und Ächzen hinter uns wird lauter, auch die Parasiten werden schneller, versuchen uns zu folgen. Vor uns ist eine weitere Gabelung, wir werfen uns im Laufen einen Blick zu, nehmen beide wieder den linken Gang. Das Brackwasser spritzt um unsere Beine, wir haben einen weiten Vorsprung zu den Parasiten aufgebaut.
Im nächsten Moment rutsche ich auf etwas Glitschigem aus und schlage der Länge nach hin. Ich beiße mir fest auf die Unterlippe, um das ekelhafte Wasser nicht zu schlucken. Ich will mich wieder hochkämpfen, hinter Liam herlaufen, der nicht bemerkt hat, dass ich gefallen bin. Doch mein Fuß hat sich in einem Gitter verfangen, egal wie sehr ich auch ziehe, ich bekomme ihn nicht los. Das Fauchen hinter mir wird lauter, ich höre das Ächzen und Stöhnen der Parasiten, die sich ihren Weg durch die Kanalisation bahnen. Ich werfe einen Blick über meine Schulter, sie sind keine zehn Meter mehr von mir entfernt. „Liam!“, rufe ich und reiße wieder panisch an meinem Fuß.
Er wirft einen Blick über seine Schulter, sieht mich am Boden im Brackwasser liegen. „Eve!“ Er bremst schlitternd ab, wirft seine Gitarre in den Schacht und kommt zu mir zurückgerannt. Im Laufen zieht er seine Glock, zielt auf einen der Parasiten, der nur noch wenige Meter von mir entfernt ist. Der Schuss ist durch die Enge des Tunnels ohrenbetäubend laut, weitere folgen. Liam trifft jedes Mal, die Parasiten stürzen nach hinten und treiben tot in dem Abwasser. Im nächsten Augenblick ist er neben mir. „Steh auf, Eve, los!“
„Ich hänge irgendwo fest, mein Fuß klemmt fest!“ Wieder reiße ich panisch an meinem Bein.
Liam schießt zwei weiteren Parasiten in den Kopf, doch es kommen immer mehr. Ich frage mich, wieso so viele von ihnen hier unten sind. Er zerrt an meinem Bein, versucht es ebenfalls frei zu bekommen, doch er ist ebenso erfolglos. Wieder kommt uns ein Parasit nahe, als Liam auf seinen Kopf zielt und abdrücken will, klickt es nur einmal. „Scheiße!“ Wieder drückt er auf den Abzug, doch nichts geschieht. Sein Magazin ist leer.
„Lauf, Liam.“ Ich blinzele die Tränen weg und versuche mein schnell schlagendes Herz zu ignorieren. „Los, wenn du dich beeilst, dann schaffst du es.“
Er sieht mich an, nur für wenige Sekunden. Dann ist er wieder auf den Beinen und läuft in den Schacht, fort von mir. Kurz schließe ich meine Augen und drehe dann den Kopf zu den Parasiten. Einer ist nur noch wenige Meter von mir entfernt, sein Fauchen ist so hoch, dass sich mir die Nackenhärchen aufstellen. Ich versuche mich auf das vorzubereiten, was nun kommen muss, die scharfen Zähne in meinem Fleisch, die kratzenden Finger auf meiner Haut.
Auf einmal spritzt mir das Dreckwasser ins Gesicht, als Liam an mir vorbeirennt, die Gitarre mit beiden Händen am Hals gefasst. Er holt weit aus und schlägt den Parasiten zu Boden. Er wirft sich neben ihn in das Wasser, zückt den Schraubenzieher, den ich ihm gegeben habe, und bohrt ihn dem Untoten mitten durch das Auge, bis ins Gehirn. Sekunden später ist Liam wieder bei mir, seine Hand unter Wasser. Sie fasst meinen Knöchel und zieht einmal kräftig. Ich spüre, wie mein Schuh sich aus dem Gitter löst und freikommt. Seine Hand fest um meinen Oberarm geschlossen, zieht Liam mich auf die Beine, hinter sich her durch den Tunnel. An einer weiteren Gabelung zieht er mich in den rechten Gang, doch wir sehen schon von Weitem die Parasiten, die am anderen Ende durch das Wasser waten. Wir drehen uns um, doch auch dort sind welche, sie umzingeln uns. Die Schüsse haben sie angelockt, alle, die hier unten sind, werden in den nächsten Minuten bei uns sein. Ich blicke mich um und versuche einen Ausweg zu finden. Da fällt mir eine Leiter an der gegenüberliegenden Wand auf.
„Die Leiter!“ Ich zeige auf unseren Ausweg, unsere Rettung. Liam läuft mir voran, springt auf die Sprossen und steigt hinauf. Ich folge ihm sofort. Ein Parasit packt meinen Knöchel, doch ich reiße meinen Fuß los und trete ihm ins Gesicht. Mit einem Ächzen versucht Liam den Deckel aufzuschieben, schafft es mit einer Hand jedoch nicht. Er blickt kurz auf seine Gitarre und lässt sie dann los. Ich fange sie auf, ehe sie in das Wasser fallen und für immer verloren gehen kann. Währenddessen hat er den Deckel beiseitegeschoben und zieht sich auf die Straße über uns. Die Gitarre unter den Arm geklemmt folge ich ihm. Wir laufen geduckt zu einem Auto und kauern uns hinter ihm zusammen. Überall um uns herum sind Parasiten, doch bis jetzt hat keiner von ihnen Notiz von uns genommen. „Was machen wir jetzt?“ Mein Herz schlägt so hart gegen meine Rippen, dass es wehtut, meine Hände sind schwitzig vor Angst.
Liam wirft einen Blick über die Motorhaube des Wagens. „Weißt du, wie weit wir vom Interstate entfernt sind?“
Auch ich schaue nun über das Auto, versuche mich zu orientieren. „Nicht weit“, flüsterte ich, erleichtert, dass ich weiß, wo wir sind. „Wir sind in einer Nebenstraße, wenn wir dort hinten rechts gehen und dann die nächste links, sind wir auf direktem Wege zum Interstate.“
„Nur dass wir zu Fuß nicht lebend dort ankommen werden.“ Liam duckt sich wieder hinter das Auto. „Wir müssen fahren.“
„Fahren? Wir werden nicht durchkommen bei den ganzen -“
„Mit einem Motorrad schon“, unterbricht er mich leise. Ich folge seinem Blick und sehe eine Maschine nur wenige Meter von uns entfernt stehen. Mir entweicht ein Laut, der halb Stöhnen und halb Weinen ist. „Wir haben keine andere Wahl. Sorry, Kleines.“ Tatsächlich schafft Liam es, mir beruhigend zuzulächeln, in diesem Moment, in dem wir umzingelt von Parasiten hinter einem Auto kauern.
„Schon gut, Hauptsache wir kommen hier endlich raus.“ Ich klinge belegt.
„Mein Reden.“ Er schaut, ob die Luft rein ist, dann schleicht er mir voran auf das Motorrad zu. Auch hier steckt der Schlüssel, die meisten Bewohner Washingtons scheinen ohne nachzudenken geflohen zu sein, als die Angriffe begannen. Oder sie sind Teil der Untoten geworden. Liam schwingt sein Bein über die Maschine, ich klettere hinter ihm rauf. Im nächsten Moment röhrt das Motorrad laut auf, ich will mich an Liam festkrallen, merke jedoch schnell, dass sein Rucksack ein sicheres Festhalten unmöglich macht.
„Setz deinen Rucksack ab!“, zische ich ihm zu.
„Was?“
„Ich kann mich sonst nicht an dir festhalten! Keine Sorge, ich nehme ihn.“
„Er ist ganz schön schwer.“
„Diskutier jetzt nicht mit mir!“ Ich sehe die ersten Parasiten auf uns zukommen, die durch das Röhren des Motorrads angelockt werden. „Gib mir einfach deinen beschissenen Rucksack!“ Er lässt den Rucksack von seinen Schultern gleiten und reicht ihn mir. Ich setze meinen ebenfalls ab, schwinge seinen auf meinen Rücken, stelle die Träger meines Rucksacks so weit wie möglich und ziehe ihn über Liams. Das Gewicht zieht unangenehm an meinen Schultern, doch nun kann ich meine Arme fest um seinen Oberkörper schlingen, nur die Gitarre ist noch zwischen uns. „Ich bin soweit“, sage ich.
Liam gibt Gas und wir schnellen nach vorne. Er rast an den Parasiten vorbei, fährt dann rechts und gleich die nächste Straße links, so wie ich es ihm gesagt habe. Bereits nach wenigen weiteren Minuten Fahrt ist der Interstate zu sehen. Mit geweiteten Augen sehe ich die ganzen Autos an uns vorbeiziehen, die überall abgestellt worden sind. Wir umfahren sie wie Slalomstangen, ich versuche mir nicht vorzustellen, was mit all den Menschen geschehen ist, die in diesen Wagen auf dem Interstate gewesen sind. Auch hier sind einige Parasiten, sie taumeln zwischen den Autos umher, auf der Suche nach frischem Fleisch. Doch außer uns befindet sich kein lebender Mensch mehr auf dem Interstate. Liam lenkt das Motorrad geschickt durch die abgestellten Fahrzeuge und wir lassen so Washington immer weiter hinter uns, fahren bereits über den Potomac River hinweg. Von dem Slalomfahren wird mir leicht übel, ich presse mein Gesicht an Liams Rücken und schließe die Augen.
Ich versuche nicht an meine Eltern zu denken, meinen Dad, der immer ein Träumer gewesen ist, und meine Mum, die ihn stets liebevoll auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen wusste. Ich versuche nicht daran zu denken, wie sie gemeinsam auf Dads alter Maschine aufgebrochen waren, zu einer abendlichen Tour, so wie sie es seit Jahren an besonders schönen Sommerabenden machten. Ich versuche nicht daran zu denken, dass sie nie zurückkamen, dass stattdessen ein Polizist an unserer Haustür klingelte, mich auf den Boden der Tatsachen zurückholte, für alle Zeit.
Nur ab und an öffne ich meine Augen, sehe, dass wir den Potomac River bereits hinter uns gelassen haben. Dass wir Washington hinter uns gelassen haben. Noch immer müssen wir uns unseren Weg um Hunderte stehende Autos suchen, ich höre über das Röhren des Motorrads hinweg das Fauchen der Parasiten, die auf dem Interstate zwischen den Autos umherwandern. Sie folgen dem Lärm der Maschine, doch wir sind zu schnell für sie. Wir fahren noch eine gute halbe Stunde, ehe ich, das Gesicht nach wie vor an Liams Rücken gepresst, merke, wie wir langsamer werden. Ich öffne meine Augen, wir sind noch immer auf einem Interstate, doch ich weiß nicht auf welchem. Um uns herum stehen nach wie vor Autos, doch die Abstände zwischen den einzelnen Fahrzeugen sind größer. Vorsichtig blicke ich an Liam vorbei nach vorne und sehe, dass nur wenige Kilometer vor uns eine Kleinstadt liegt.
„Warum werden wir langsamer?“
„Ich weiß es nicht.“ Liam ist angespannt, als er das Motorrad zwischen zwei Pick Ups ausrollen lässt. „Scheiße“, sagt er, als wir zum Stehen kommen. „Scheiße!“ Er schlägt fest auf den Lenker. „Scheiße, scheiße, scheiße!“
„Liam!“ Er hört auf, auf den Lenker einzuschlagen. „Wir müssen hier weg. Wir müssen hier schnell weg.“ Mein Ton bewegt ihn dazu, sich zu mir umzudrehen. Doch ich habe keine Augen für ihn, habe mich ebenfalls umgewandt. Hunderte Parasiten sind hinter uns, sie suchen sich ihren Weg an den parkenden Autos vorbei. Seit Washington an müssen sie uns gefolgt sein, je mehr Meter wir hinter uns gelassen haben, desto mehr von ihnen haben sich dem Strom angeschlossen und sind hinter dem lauten Motorrad her.
„Oh mein Gott.“ Liam wirkt wie paralysiert.
Ich steige von der Maschine, meine Gelenke sind steif. „Komm!“ Entschlossen fasse ich seinen Unterarm und ziehe auch ihn vom Motorrad. „Wir müssen laufen, wir müssen hier weg, okay?“ Er sieht mich nicht an, starrt über meine Schulter auf die Masse, die nur wenige hundert Meter hinter uns ist. „Liam!“ Nun blickt er mich an, das Gesicht starr. „Wir müssen laufen. In irgendeine Kleinstadt. Wir suchen uns ein Haus und schließen uns dort ein. Wenn wir schnell genug sind und leise, dann schaffen wir es. Wir haben es bis hierher geschafft, also haben wir das Schlimmste bereits hinter uns. Aber du musst jetzt bei mir sein. Du musst mir helfen, okay?“
Mein Blick sucht den seinen. Für wenige Sekunden sehen wir uns an, dann schluckt er einmal fest und nickt. „Du hast recht. Wir können es schaffen.“
„Genau.“ Ich drücke ihm seine Gitarre in die Hand. „Wir werden es schaffen.“ Ich strecke meine Hand nach ihm aus und sehe ihn an.
„Wir werden es schaffen.“ Er ergreift meine Hand und verschränkt seine Finger fest mit meinen. Wir sehen uns ein letztes Mal um, sehen die Parasiten hinter uns näher kommen, Hunderte, vielleicht sogar Tausende. Doch wir sind schneller als sie, wir sind klüger als sie. Und wir wollen leben. Wir sehen uns an, nicken uns zu.
Und dann laufen wir.