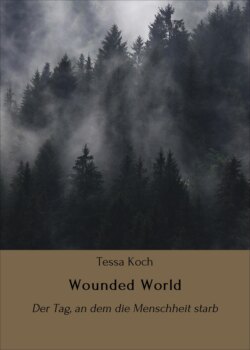Читать книгу Wounded World - Tessa Koch - Страница 6
21. Juli 2021, DIE TANKSTELLE
ОглавлениеLogbuch-Eintrag 03
Wenn die Welt untergeht, nur noch wenige Tausend Menschen leben, gebietet es der gesunde Menschenverstand, dass sie sich zusammen tun und gemeinsam einen Weg aus diesem Albtraum finden. Es zählt dann nicht mehr, wer man einmal gewesen ist, was man einmal getan hat. Es ist egal, ob man männlich oder weiblich, schwarz oder weiß, jung oder alt ist. Das einzige, was zählt, wenn die Welt in Trümmern liegt, so viele bereits gestorben sind, ist, dass man ein Mensch ist. Oder etwa nicht?
Ich bin so unendlich dankbar gewesen, als ich Liam getroffen habe, auch wenn ich zu Beginn vorsichtig gewesen bin. Man weiß nie, mit wem man es zu tun hat, wer neben einem liegt, während man wichtige Energie sammeln muss. Doch wir haben einander schnell getraut, vertraut und verstanden, dass wir einander brauchen. Nicht nur um zu überleben, sondern für unser Seelenheil, um nicht den Verstand zu verlieren.
Aber es sind nicht alle Menschen so wie Liam. Nicht in allen ruft dieser Ausnahmezustand das Beste hervor. Es gibt auch böse Menschen, furchtbare Menschen, bei denen nur Gott alleine weiß, weswegen sie bisher überlebt haben. Die einem wehtun, einen zerstören wollen, trotz oder vielleicht sogar wegen allem, was geschehen ist. Ein paar von ihnen sind wir begegnet. Durch diese Treffen habe ich eines gelernt: Dass wir die Lebenden mehr fürchten müssen als die Toten.
Meine Schultern schmerzen so sehr, die Last der beiden Rucksäcke zerrt an meinen Muskeln. Auch meine Beine schmerzen, sie wollen das Gewicht meines Körpers nicht mehr tragen, doch sie müssen. Sie müssen es einfach. Das Brennen in meinen Lungen macht mich beinahe wahnsinnig, der Schweiß rinnt mir das Gesicht hinab, vermischt sich mit dem Blut des Parasiten, den ich noch in der Gasse erschlagen habe und brennt in meinen Augen.
Die Stadt ist nur noch wenige Hundert Meter entfernt, es fühlt sich so an als würden wir schon seit Stunden laufen. Vielleicht tun wir es ja auch. Ich werfe einen Blick über die Schulter, sehe die Massen von Parasiten hinter uns. Auch sie sind nur wenige Hundert Meter von uns entfernt. Ihr Anblick, die gräuliche tote Haut, die milchig weißen Augen, das Fauchen, Stöhnen und Ächzen, treibt mich weiter voran, auch wenn ich am liebsten einfach zusammenbrechen würde. Liam hält meine Hand noch immer fest umfasst, er zieht mich inzwischen mehr, als dass er neben mir herläuft. Immer wieder wirft er mir besorgte Blicke zu, ich kann seinem Gesicht ansehen, dass er es bereut, mir seine Sachen gegeben zu haben. Ich muss zugeben, dass ich ebenfalls bereue seinen Rucksack aufgesetzt zu haben. Sein Gewicht, zusätzlich zu dem meines Gepäcks, raubt mir mit jedem weiteren Schritt kostbare Kraft, die mich andernfalls hätte schneller laufen lassen.
„Ich kann nicht mehr!“, keuche ich nach weiteren hundert Metern. „Ich kann einfach nicht mehr!“
„Du musst, wir haben es doch schon fast geschafft!“ Er zieht mich weiter, energisch, entschlossen. „Bitte, Eve! Wir müssen es einfach schaffen, das hast du selbst gesagt!“ Der Blick, den er mir zuwirft, ist flehend.
Ich sammle meine letzten Kraftreserven zusammen und schließe nun zu ihm auf, statt hinter ihm her zu torkeln. Wenige Minuten später laufen wir über die Grenze der Stadt, vorbei an einem Ortsschild, das ich in der Eile nicht lesen kann. Liam zieht mich nach rechts, an eines der Wohnhäuser vorbei, direkt in dessen Garten. Zuerst glaube ich, dass er durch eine der Hintertüren in das Innere gelangen will, doch stattdessen hält er auf den Gartenzaun zu. Als er vor ihm anhält, wirft er seine Gitarre über den Zaun, hilft mir dann, ebenfalls über den Gartenzaun zu gelangen und folgt mir dann. Er hebt seine Gitarre auf, nimmt meine Hand und zieht uns durch den nächsten Garten, zu dem nächsten Zaun. Auch über diesen klettern wir, so wie über fünf weitere.
„Das sollte reichen“, keucht er, nachdem wir einen weiteren Zaun passiert haben. Er wirft einen Blick über die Schulter, noch immer können wir das Fauchen, Ächzen, Stöhnen der Parasiten hören, doch sehen wir keine. Liam läuft auf die Hintertür des Hauses zu, in dessen Garten wir uns gerade befinden. Er drückt gegen die Tür, doch sie öffnet sich nicht. Er zieht den Pullover über seinen Kopf, steht mit nacktem, durchtrainiertem Oberkörper vor mir, wickelt sein Oberteil fest um seine Faust und schlägt die Scheiben der Tür ein. Anschließend greift er durch das Loch in das Haus und entriegelt die Tür. Er hält sie für mich auf und ich trete eilends in das Haus.
Sofort verschließt Liam die Tür wieder, schlüpft in sein T-Shirt und sieht sich in dem Wohnzimmer um, in dem wir nun sind. Dann schiebt er einen Sessel vor die Tür. Währenddessen habe ich die schweren Rucksäcke abgesetzt und verspüre das unglaubliche Verlangen meine Schultern zu massieren. Doch stattdessen ziehe ich meinen treuen Hammer aus dem Gürtel und sehe mich in dem Haus um. Es ist still hier, doch ich weiß, dass es nichts zu bedeuten hat. Und solange wir uns nicht überzeugt haben, dass die Familie, die hier einst lebte, fort ist, werde ich mich nicht entspannen können.
Auch Liam hat einen der Schraubenzieher gezückt, die ich ihm gegeben habe. Das Wohnzimmer hat zwei Ausgänge, einen in die angrenzende Küche, einen in den dunklen Flur. Ich bedeute Liam, dass er die Küche überprüfen soll, während ich den Flur auf ungebetene Gäste absuchen will. Er wirkt nicht besonders glücklich mit meinem Plan, macht sich dennoch lautlos auf den Weg in die Küche. Ich schleiche in den Flur, sehe, dass sich rechts von mir eine Treppe in die erste Etage zieht und mir gegenüber eine weitere Tür ist. Die Haustür ist links von mir. Leise gehe ich durch den Flur, werfe einen flüchtigen Blick durch die Fenster neben der Eingangstür. Die Parasiten ziehen in Scharen an dem Haus vorbei. Ich ducke mich eilig, damit mich nicht zufällig einer entdeckt und versucht hier hinein zu gelangen.
Als ich vor der geschlossenen Tür gegenüber dem Wohnzimmer stehe, umfasse ich den Hammer etwas fester. Vorsichtig öffne ich die Tür und betrete ein leeres Esszimmer. Gerade als ich mich etwas entspanne, kommt eine Gestalt in den Raum gestürmt. Ich weiche erschrocken zurück, einen Schrei im Hals. „Pssht, Eve, ich bin’s“, flüstert Liam, die Hände erhoben.
„Oh Gott“, flüstere ich, die freie Hand auf meine Brust gedrückt. „Mach das nie wieder, ich hätte fast geschrien.“
„Tut mir leid. Hast du irgendwas entdeckt? Oder irgendwen?“
„Nein, du?“
„Auch nicht.“ Er wirft einen Blick über meine Schulter. „Wir sollten uns in der ersten Etage umsehen.“
„Und am besten dort bleiben, bis die Viecher vorbei sind.“ Wieder sehe ich aus dem Fenster auf die Parasiten, die an dem Haus vorbeiströmen.
„Gute Idee.“ Liam geht an mir vorbei in den Flur, er hat unsere Rucksäcke bei sich sowie seine Gitarre. Ich folge ihm die breite Treppe hinauf in die erste Etage, insgesamt sind hier oben vier weitere Zimmer, jeweils zwei auf der linken und rechten Seite des Flures.
Wir sehen uns kurz an, dann biegt Liam nach links und ich nach rechts ab, um die einzelnen Räume zu kontrollieren. Das erste Zimmer, das ich betrete, ist ein verlassenes Kinderzimmer. Ich betrachte die vielen Spielsachen, die in dem Zimmer verteilt sind, sehe das Himmelbett vor einer rosa Wand. Hier hat einmal ein kleines Mädchen gelebt, der Gedanke, was vielleicht mit ihr geschehen ist, lässt mich erschauern. Ich trete zurück auf den Flur, ich möchte das Zimmer schnell hinter mir lassen. Als ich die nächste Tür öffne, höre ich sofort, dass in dem Raum jemand ist. Ich umfasse den Hammer fester und stoße die Tür weit auf, während ich im Flur stehen bleibe. Es ist dunkel in dem Zimmer, meine Augen gewöhnen sich nur langsam an das Licht. Leises Ächzen und Stöhnen dringt an meine Ohren, ich weiß, dass es einer von den Parasiten sein muss. Ich trete in den Raum und sehe mich um, den Hammer erhoben.
Im nächsten Moment lasse ich ihn wieder sinken.
Es ist das Badezimmer der oberen Etage, in einem hellen Sandton gehalten, der mir unter anderen Umständen durchaus gefallen würde. In der Badewanne liegt ein Mädchen, ich schätze es auf fünfzehn, sechzehn Jahre, zu alt für das Kinderzimmer, das ich eben gesehen habe. Überall ist Blut, ich sehe noch die Einschnitte auf der fauligen Haut. Sie muss sich vor Stunden, vielleicht sogar Tagen die Pulsadern aufgeschnitten haben, vielleicht weil ihre restliche Familie bereits tot, fort ist. Doch auch wenn sie gestorben ist, kein Mensch mehr, ist sie dennoch wieder gekommen, als einer der ihren. Als sie mich sieht, beginnt sie zu fauchen, ihre Hände nach mir auszustrecken. Sie ist zu schwach, um aufzustehen, mich tatsächlich anzugreifen. Langsam nähere ich mich der Badewanne und betrachte die junge Frau. „Es tut mir so leid“, flüstere ich, als ich in ihre milchigen leeren Augen blicke. „Das alles tut mir so unendlich leid.“
Dann schlage ich ihr mit dem Hammer den Schädel ein. Sie sackt zusammen, nun für immer fort. Mir rutscht der Hammer aus den Fingern und ich sinke erschöpft neben dem toten Mädchen auf die Knie. „Es ist nicht deine Schuld.“ Ich blicke über die Schulter und sehe Liam mit bekümmerter Miene im Türrahmen stehen.
„Es ist einfach nur furchtbar“, flüstere ich. „Vor ein paar Tagen ist alles noch normal gewesen. Sie alle haben noch gelebt, waren Menschen. Und nun töten wir sie.“ Ich blicke wieder auf das tote Mädchen. „Eben war ich in einem Kinderzimmer. Es kann nicht ihres gewesen sein, es waren Spielsachen für ein kleines Mädchen dort, nicht älter als sechs.“ Wieder schweige ich kurz. „Vielleicht hat sie ihre ganze Familie verloren und keinen anderen Ausweg mehr gesehen.“
Liam legt seine Hand auf meine Schulter. „Du hast sie erlöst.“ Ich sehe zu ihm auf. „Sie alle werden von uns erlöst. Das, was wir da draußen sehen, sind keine Menschen mehr. Sie haben nicht mehr diese Empfindungen und Gedanken, die wir haben. Sie sind nicht mehr, verstehst du?“ Er sieht mich ernst an. Ich denke über seine Worte nach, das, was ich selber erlebt habe. Wieder fällt mein Blick auf das tote Mädchen, ihre graue Haut, ihre milchigen Augen. Sie wollte mich angreifen, sie wollte das Fleisch von meinen Knochen reißen, weil für sie nichts anderes mehr gezählt hat als ihr Hunger, ihr Verlangen nach Blut und Fleisch. Liam hat recht, sie sind nicht mehr die Menschen, die sie einmal waren, auf die dieses Haus schließen lässt. Sie sind nichts weiter als niedere Wesen, reduziert auf einen einzigen, ewigen Trieb.
„Lass uns aus diesem Raum verschwinden, ja? Ich halte es hier drin nicht mehr aus.“
„Klar. Ich habe ohnehin noch ein anderes Bad gefunden, es grenzt an das Elternschlafzimmer.“ Liam führt mich aus dem Raum und zieht die Tür hinter uns fest zu. „Es ist direkt gegenüber der Treppe.“ Wir betreten das Schlafzimmer, Liam schließt die Tür hinter uns und setzt dann unsere Rucksäcke ab. „Wie konntest du die soweit tragen? Die sind unglaublich schwer.“
Kaum dass er es erwähnt, beginnen meine Schultern wieder zu schmerzen. „Keine Ahnung“, sage ich und setze mich auf das Bett. „Es wundert mich, dass ich mich überhaupt noch bewegen kann. Mir tut alles weh. Und ich bin einfach nur müde.“ Ich lasse mich nach hinten fallen und starre an die Decke, die Füße noch auf dem Boden.
„Ich auch.“ Liam legt sich neben mich, starrt ebenfalls an die Decke. „Wir sollten uns auch auf jeden Fall ausruhen, ehe wir weiterreisen.“
„Und wir brauchen ein Auto.“ Mit den Augen folge ich einer Fliege, die unter der Decke umherschwirrt. „Am besten ein großes. Wir durchsuchen die Häuser, sammeln Essen, Medikamente, alles was wir so brauchen, ein und machen uns dann auf den Weg nach Arkansas.“
„Halten nur an, wenn wir Benzin brauchen.“
„Oder uns das Essen ausgeht.“
Liam wendet sich mir zu. „Das klingt nach einem ziemlich guten Plan.“ Ich lächle ihm schwach zu. „Und weißt du das?“ Ich ziehe meine Brauen fragend hoch und nun lächelt auch er. „Wir haben es tatsächlich geschafft. Du hast uns aus diesem verdammten, verseuchten Nest raus geschafft, Blondie.“
„Wir haben es beide geschafft“, verbessere ich ihn. „Ich wäre in der Kanalisation nämlich fast gefressen worden.“
„Und ich in der Gasse, noch bevor wir überhaupt unter der Erde waren.“ Wir schweigen beide kurz. „Dachtest du eigentlich, ich würde dich zurücklassen als ich los gelaufen bin, um meine Gitarre zu holen?“, fragt er mich nach wenigen Sekunden der Stille.
„Ganz ehrlich?“ Ich sehe ihn an, in seine grauen Augen. Aus der Nähe sehe ich die braunen Sprenkel, die sich um seine Pupille ziehen. „Ja, ich dachte es wirklich. Aber ich bin dir nicht böse gewesen.“
Er seufzt leise, beinahe unglücklich. „Dann merk dir ab sofort eins: Ich werde dich nicht zurücklassen, niemals, und wenn wir am Ende beide bei draufgehen.“
„Dito.“ Wir grinsen uns an, auch wenn uns der Ernst unseres Gespräches bewusst ist. Langsam komme ich zur Ruhe, merke wie mein Puls sich wieder normalisiert, das Adrenalin in meinen Adern abklingt. Nun, wo es nicht mehr um unser Leben geht, wir nicht mehr fliehen müssen, fällt mir auch etwas anderes auf. „Wir stinken.“
Ich ziehe die Nase kraus und Liam beginnt zu lachen. „Wir sind durch die Kanalisation gekrochen, kilometerweit gerannt und haben hier und da einen Parasiten getötet. Wenn wir nicht stinken würden, wäre eindeutig etwas falsch gelaufen.“
„Kann schon sein“, stimme ich ihm zu und setze mich auf. „Aber jetzt, wo wir in einem Raum sind, in dem es nicht stinkt, fängt es an mich zu stören.“ Ich sehe mich in dem Schlafzimmer um und sehe den breiten Kleiderschrank gegenüber dem Bett. Langsam rappele ich mich auf und gehe auf ihn zu. „Wird Zeit, für einen Tapetenwechsel.“ Ich ziehe die Schranktüren auf und sehe die fein eingestapelten Klamotten durch. „Hier.“ Ich werfe Liam ein weißes Hemd und eine dunkle Jeans zu. „Das dürfte dir eigentlich passen.“
Er fängt die Sachen auf und seufzt dann theatralisch. „Die Welt geht unter und dennoch habe ich eine herrische Frau hinter mir, die meine Klamotten aussucht.“
Ich muss lachen, während ich die Kleidung der fremden Frau durchsehe. „Wer hat dir denn früher deine Sachen rausgesucht? Deine Freundin?“ Ich versuche es beiläufig klingen zu lassen, falte ein Oberteil auseinander und halte es mir probehalber vor den Brustkorb.
„Nein, meine Mutter. Zumindest als ich noch zu Hause gewohnt habe. Die letzten Jahre habe ich es dann alleine bewerkstelligt, irgendwie.“ Er tritt zu mir an den Schrank, beginnt nun ebenfalls die Klamotten durchzusehen.
„Aha.“ Ich falte das Oberteil wieder zusammen und lege es zurück, nehme mir ein anderes.
„Ja.“ Auch er betrachtet ein Hemd eingehend. „Die Richtige war halt noch nicht dabei. Seit Jahren.“ Er wirft mir einen schnellen Blick zu und sieht dann wieder auf sein Hemd. „Bei dir scheint sie ja auch noch nicht allzu erfolgreich gewesen zu sein, was? Die Partnersuche?“
Ich verziehe leicht das Gesicht, als ich an Adam denke. Und an Clarissa. „Könnte man wohl so sagen. Von der neuen Flamme seines Ex-Freundes niedergeschlagen zu werden, würde ich nicht unbedingt als erfolgreich bezeichnen.“
„Oder du hast grade alles richtig gemacht.“
Ich muss lachen. „Oder so. Okay“, sage ich dann. Wir haben genug unsere Fühlerchen nacheinander ausgestreckt. „Ich glaube, dass ich mal duschen werde. Solange es noch fließendes Wasser gibt.“ Meine Stirn legt sich in leichte Falten, als ich darüber nachdenke.
„Ich warte hier brav.“ Liam geht zurück zum Bett und setzt sich neben die Sachen, die ich für ihn ausgesucht habe. Er verschränkt die Hände miteinander und sieht mich wie ein aufmerksamer Schüler an.
Über seine Miene muss ich grinsen. „Auch besser für dich.“ Ich löse den Waffengürtel von meinen Hüften und werfe ihn neben ihm auf das Bett. „Ich kann mich nämlich auch wunderbar ohne Waffen zur Wehr setzen.“
„Nach allem, was ich in den letzten sechs Stunden gesehen habe, möchte ich das nicht bestreiten.“ Sein Lachen folgt mir in das Bad. Kurz überlege ich die Tür zu verschließen, entscheide mich dann aber dagegen. Ich vertraue Liam, auch wenn wir uns erst seit wenigen Stunden kennen. Außerdem muss man nun immer damit rechnen, im Notfall schnell weiterziehen zu können. Türschlösser können dabei durchaus hinderlich sein.
Ich lege die neuen Klamotten auf die geschlossene Toilette und bin dankbar, als ich mich meiner verdreckten und verschwitzten Kleidung entledigen kann. Es dauert etwas, bis ich meinen Zopf gelöst und meine Haare entknotet habe, doch dann steige ich in die Dusche, schließe die Türen hinter mir und lasse das Wasser an. Nach wenigen Sekunden wird es bereits warm, meine Muskeln entspannen sich sofort. Ich bin dankbar, dass wir noch warmes Wasser haben und hoffe, dass dieser Segen solange wie möglich halten wird. Das Wasser zu meinen Füßen färbt sich schwarz und rot, ich wasche Haut und Haar dreimal, ehe ich das Wasser abstelle und aus der Dusche steige. Schwere Dampfschwaden folgen mir, als ich mich in das Handtuch einwickele und langsam abtrockne. Anschließend steige ich in die fremde Unterwäsche, dann in eine bequeme Jeans, ein weißes Top und eine hellblaue Bluse. Aus dem Regal neben der Badewanne nehme ich mir eine Haarbürste und entferne sorgfältig alle fremden Haare.
Ich verlasse erfrischt und sauber das Bad. „Du glaubst gar nicht wie toll das gerade -“, setze ich an, als ich wieder in das Schlafzimmer komme. Doch ich breche jäh ab, als ich sehe, dass es leer ist. „Liam?“ Ich erhalte keine Antwort.
Sofort lasse ich die Haarbürste fallen, greife die Glock vom Bett und eile aus dem Raum. Ich werfe in jedes Zimmer in der oberen Etage einen Blick, doch sie sind allersamt leer. Auf dem Weg nach unten entsichere ich meine Waffe, halte sie eng an meine Brust, während ich mich leise durch das Haus bewege. Noch immer ziehen Parasiten durch die Straßen, ich laufe geduckt an den Fenstern vorbei. Aus der Küche klingen sanfte Geräusche an meine Ohren, ich schleiche durch das Wohnzimmer auf die Tür zu. Mir fällt auf, dass die Jalousien hier heruntergelassen sind, vorhin waren sie noch nicht geschlossen.
Mit Schwung reiße ich die Tür auf und springe schussbereit in den Raum. Liam lässt vor Schreck einen Löffel fallen, klappernd fällt er zu Boden. „Willst du, dass ich einen Herzinfarkt kriege?“, zischt er, eine Hand fest auf der Brust.
„Willst du, dass ich einen Herzinfarkt kriege? Du kannst doch nicht einfach verschwinden, ohne zu sagen, wo du bist!“ Ich lasse die Waffe sinken.
Er lacht leise. „Ich dachte, dass es dir nicht so gefällt, wenn ich in das Badezimmer platze, Blondie. Wo sollte ich auch außerdem hin?“ Amüsiert sieht er mich an, eine Braue fragend angehoben.
„Was weiß denn ich!? Von Parasiten gefressen, von irgendeinem Rückkehrer erschossen!“ Mir schießen Tränen in die Augen und ich versuche sie wegzublinzeln. „Vielleicht lässt du mich auch einfach zurück, woher soll ich das denn wissen?“ Die Tränen laufen nun doch über, stürzen meine Wangen hinab.
Liam sieht mich erschrocken an, binnen weniger Sekunden ist er bei mir. „Hey, Eve, Kleines, ganz ruhig.“ Er nimmt mich in die Arme. „Ich kann gut auf mich aufpassen, das weißt du doch. Ich werde mich nicht einfach fressen oder erschießen lassen, okay? Und ich lasse dich auf keinen Fall alleine, hörst du? Ich bin froh, dass ich dich habe.“
„Versprochen?“ Ich schluchze leise. Alles ist mit einem Mal fremd und anders und erst jetzt begreife ich so wirklich, welche Angst mir die Vorstellung bereitet, dieser neuen grausamen Welt alleine gegenüber treten zu müssen. Ich brauche Liam.
Er drückt mich fest. „Ja, versprochen. Wir kennen uns noch nicht lange, ich weiß. Aber du kannst mir vertrauen.“ Er schiebt mich auf Armeslänge von sich und sieht mich ernst an. „Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, kann ich dich doch nicht einfach zurücklassen, Blondie. Okay?“ Ich nicke, wische mir beschämt die Tränen aus dem Gesicht. Liam lächelt schon wieder. „Ich habe geschaut, ob ich was Essbares für uns finde. Noch geht der Strom und ich dachte, ich koche uns was Schönes, was meinst du?“
Ich erwidere sein Lächeln. „Klingt ziemlich gut.“ Dann ziehe ich die Nase leicht kraus. „Aber vielleicht solltest auch du vorher lieber erstmal duschen, nichts für ungut, aber du stinkst.“
Er lacht. „Na, da ist sie ja wieder, meine rotzfreche Blondie.“
„Ach, halt die Klappe“, erwidere ich, muss aber auch grinsen. „Geh lieber duschen und ich übernehme das Kochen.“
„Ist gut.“ Er ist schon halb aus dem Raum, als er im Türrahmen innehält. „Ich habe im Wohnzimmer und hier in der Küche die Jalousien runtergelassen, in den anderen Räume habe ich mich nicht getraut. Ich hatte Angst, dass der Lärm die Parasiten auf uns aufmerksam macht. Also sei vorsichtig vorne, okay? Halte dich von den Fenstern fern.“
„Mache ich.“
„Gut. Dann werde ich mir mal diesen wunderbar männlichen Duft aus Schweiß, Blut und Fäkalien abwaschen.“ Er verlässt unter meinem Lachen den Raum und geht nach oben. Nur wenige Minuten später höre ich über meinem Kopf die Dusche rauschen.
Ich setze Wasser für Nudeln auf und durchsuche, während es zu kochen beginnt, gewissenhaft die Küche. Es sind erstaunlich viele Lebensmittel zu finden, ich glaube nicht, dass die Familie versucht hat zu fliehen. Vermutlich sind sie von den Parasiten überrascht worden und zu leichten Opfern geworden. Außer das Mädchen. Schnell konzentriere ich mich auf einen weiteren Schrank, schiebe die Gedanken an das tote Mädchen über mir beiseite.
Alles, was ich Brauchbares finde, trage ich auf der Arbeitsfläche zusammen. Ich suche nur Lebensmittel aus, die von längerer Haltbarkeit sind, und lege besonders großen Wert darauf, sämtliche Getränke zusammenzusuchen. Als das Wasser zu kochen beginnt, gebe ich die Nudeln dazu und finde in einem Schrank im Wohnzimmer Einkaufskörbe und Tüten. Ich trage sie in die Küche und stelle sie zu den bereits ausgewählten Lebensmitteln, ehe ich Tomaten und Zwiebeln schneide. Beides gebe ich dann in eine Pfanne und lasse es anbraten. Die Sauce zu den Nudeln ist schnell gezaubert und abgeschmeckt, sodass sie auf kleiner Flamme weiterköcheln kann, während ich die Vorräte einzupacken beginne.
„Riecht ziemlich gut.“ Ich sehe zu Liam auf, der in der Tür steht. Er hat ein kleines Handtuch in den Händen, mit denen er sein kurzes Haar trocken rubbelt. Er trägt tatsächlich die Klamotten, die ich für ihn herausgesucht habe, und sie passen ihm erstaunlich gut. „Wow, du warst schon ganz schön fleißig“, sagt er, als er sich in der Küche umsieht.
„Ja.“ Ich rühre die Sauce um. „Ich dachte, ich mache mich zur Abwechslung auch mal nützlich. So ziemlich alles Essbare, was länger als eine Woche haltbar ist, befindet sich jetzt in den Tüten und Körben, so wie alle Getränke, die ich finden konnte. Ich habe auch ein paar Messer zusammen gesucht und so.“ Ich zucke mit den Schultern.
„Wie gesagt, ziemlich fleißig.“ Er schaut interessiert in die Tüten und Körbe. „Damit werden wir weit kommen.“ Er grinst, als er zu mir an den Herd kommt. „Wir können es wirklich schaffen, Blondie.“
Ich halte ihn den Löffel unter die Nase. „Hör auf mich so zu nennen, verdammt, oder du wirst nicht einmal mehr diesen Raum lebend verlassen.“
Er grinst nur noch breiter, seine Brauen wandern in die Höhe. „Es passt aber zu dir.“
„Weil ich blonde Haare habe? Gratulation, du bist nicht farbenblind.“
Er muss lachen. „Nein, du bist eine Kämpferin, bissig, wenn es sein muss. Wie ein Hund. Deswegen Blondie.“
„Wie kommst du denn von bissig wie ein Hund auf Blondie, ich meine -“ Meine Augen weiten sich, als der Groschen fällt. „Du hast mich nicht ernsthaft nach Hitlers Hund benannt, oder?“
„Naja.“ Er legt sich das Handtuch um den Nacken und umfasst beide Enden grinsend. „Wie gesagt, du bist bissig, Deutsche, hast blondes Haar …“
„Du wirst garantiert nichts zu essen abbekommen!“ Empört wende ich mich wieder den Töpfen zu, klaube mir ein Handtuch von der Spüle und trage dann den Nudeltopf zum Waschbecken, um das Wasser abzugießen.
„Ach komm schon, ein bisschen Galgenhumor muss sein, in diesen Zeiten.“
„Einen Galgen kannst du haben“, murre ich leise und trage den Topf zurück zum Herd.
„Eve.“ Er grinst noch immer, während er mir zwei Teller reicht. „Das war natürlich nur ein Spaß. Du weißt schon, diese ganze Hunde-Sache. Ich habe dir den Namen nur wegen deiner blonden Haare gegeben, ich bin ein rücksichtsloses, chauvinistisches Arschloch und entschuldige mich vielmals dafür.“
Ich fülle uns beiden auf. „Das klingt schon besser.“ Auch ich grinse, kann gar nicht glauben, wie normal wir uns gerade verhalten, wie normal wir gerade leben. „Na gut, du darfst doch etwas essen.“ Ich reiche ihm seinen Teller und er nimmt ihn mir eilig ab.
Wir essen beide an die Arbeitsfläche gelehnt und nehmen uns jeweils zweimal nach. Nun, wo ich geduscht habe und auch gesättigt bin, kommt wieder die Erschöpfung durch. Seit Tagen habe ich nicht wirklich geschlafen, war die ganze Zeit nur auf der Flucht und in ständiger Angst. Meine Muskeln schmerzen noch immer von der Anstrengung des Laufens und der schweren Rucksäcke. Als ich meinen leeren Teller in die Spüle stelle, brennen meine Augen vor Müdigkeit.
„Meinst du, dass wir schlafen können?“, frage ich Liam, als wir wenige Minuten später wieder im Schlafzimmer sind. Auf dem Weg hierher haben wir gesehen, dass noch immer Parasiten an unserem Haus vorbeiziehen, doch es sind nur noch wenige, der Großteil hat das Haus und vermutlich auch die Stadt bereits passiert. Ich setze mich auf das Bett und nehme die Haarbürste zur Hand, die ich vor einer guten Stunde dort fallen ließ.
„Ich denke schon.“ Er setzt sich auf die andere Betthälfte und fährt sich müde mit beiden Händen über das Gesicht. „Aber vielleicht wäre es dennoch besser, wenn einer von uns wachbleibt und aufpasst, nur zur Sicherheit.“
„Eine Nachtwache?“ Ich werfe die Haarbürste auf meinen Rucksack, damit ich sie nicht vergesse einzupacken, und lege mich dann hin.
„Ja genau.“ Er lächelt mich schief an. Ich seufze leise, als mir bewusst wird, dass er recht hat und es so sicherer ist. Doch es fühlt sich so an als könnte ich Tage durchschlafen. Da gefällt mir der Gedanke einer Nachtwache nicht besonders. „Keine Sorge, ich fange an“, sagt Liam. „Immerhin habe ich dich die Rucksäcke tragen lassen und du hast meine Gitarre gerettet – du hast es dir verdient.“
Am liebsten würde ich das Angebot sofort annehmen, doch mein schlechtes Gewissen meldet sich leise. „Ist schon okay, ich kann auch die erste Wache übernehmen.“
„Nein.“ Er klingt entschlossen, lächelt aber immer noch. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich fitter bin als du – nimm’s mir nicht böse.“
„Na gut.“ Ich ziehe die Decke unter mir hervor, meine Kleidung behalte ich an. „Aber du weckst mich, ja? Damit du auch noch etwas Schlaf abbekommst.“
„Klar doch.“
Ich werfe ihm einen letzten forschenden Blick zu, dann drehe ich mich auf die Seite, weg von ihm, und schließe meine brennenden Augen. Das Bett ist unglaublich bequem, ich versinke sofort in der weichen Matratze und dem duftenden Bettzeug und versuche meinen Kopf frei von all den schrecklichen Gedanken zu machen.
Als ich meine Augen wieder aufschlage, ist es Taghell. Ich blinzle gegen das Licht an, brauche nur wenige Sekunden, bis ich begreife, was es zu bedeuten hat. Im nächsten Moment schrecke ich hoch, auch Liam neben mir zuckt erschrocken zusammen, er hält ein Buch in den Händen, das er irgendwo in dem Zimmer gefunden haben muss. „Wachst du immer so auf?“, fragt er.
„Wie spät ist es? Warum hast du mich nicht geweckt?“ Ich streiche meine Haare hinter die Ohren, einzelne lockige Strähnen fallen mir dennoch störrisch ins Gesicht.
„Du hast so friedlich geschlafen, da wollte ich dich nicht wecken.“
„Liam!“ Ich weiß, dass er es nur gut gemeint hat, dennoch fühle ich mich sofort schlecht. „So war das aber nicht abgemacht!“
„Es macht nichts, ich kann immer noch im Auto schlafen, wenn ich will. Außerdem war das Buch einfach zu spannend.“ Er hält es mir ins Gesicht und ich betrachte den Einband.
„Das ist die Biografie von George W. Bush“, sage ich dumpf.
„Was?“ Er betrachtet nun selber den Einband. „Das erklärt irgendwie alles.“
Ich muss ungewollt lachen. „Du bist ein Idiot, weißt du das?“, necke ich ihn. Ich weiß, dass er mich nicht wecken wollte, weil er gesehen hat wie müde und kaputt ich gewesen bin. Er muss auch erschöpft sein nach unserer gestrigen Reise, ist dennoch auf geblieben, um mich im Notfall beschützen zu können. Er ist ein durch und durch guter Kerl.
„Und du stehst drauf, Blondie“, erwidert er breit grinsend, eine Braue hochgezogen.
Ich verdrehe wieder einmal die Augen. „Also ich werde jetzt ins Bad gehen.“
„Und ich schaue mal, was sich zum Frühstück findet – ich bin also unten in der Küche, nur falls du wieder mit einer Waffe in den Raum springen willst.“
Tatsächlich werde ich leicht rot. „Ich überlege mir noch, ob du mir die Mühe wert bist.“ Unter seinem leisen Lachen schlage ich die Decke beiseite und stehe auf. Kurz strecke ich mich und meine Gelenke knacken. Dann gehe ich ins Bad und schließe die Tür hinter mir. Ich gehe auf Toilette, dann wasche ich mir Hände und Gesicht. Anschließend suche ich in dem Schrank neben der Tür nach unbenutzten Zahnbürsten und werde tatsächlich fündig. Ich putze mir die Zähne und bürste mein störrisches Haar.
Als ich die Küche betrete, bin ich gerade dabei sie zu einem Pferdeschwanz zusammen zu binden. Liam ist dabei Spiegeleier zu braten und sieht zu mir auf, als ich eintrete. „Versteckst du deine wilde Mähne wieder?“
Ich sehe ihn überrascht an. „Was?“
„Na deine Haare, Blondie. Es sieht hübsch aus, wenn sie offen sind.“ Überrascht halte ich im Binden des Zopfes inne, unsicher, was ich antworten soll. „Ich habe Spiegeleier für uns gemacht“, redet Liam weiter.
„Sieht gut aus“, sage ich und streiche meinen Zopf glatt. Noch immer bin ich wegen seines Kommentares verwirrt, versuche es mir aber nicht anmerken zu lassen.
„Ich hoffe, dass sie auch schmecken“, lacht er, als er mir einen beladenen Teller reicht. „Nach dem Essen sollten wir uns ein Auto suchen. Vereinzelt schwirren hier zwar immer noch Parasiten rum, aber der große Strom ist weitergezogen. Mit den paar werden wir fertig.“
„Zuerst sollten wir das Haus zu Ende durchsuchen und alles packen. Wenn wir ein Auto finden, wird das Motorengeräusch wieder welche anlocken – ich möchte dann so schnell wie möglich hier weg“, wende ich ein. „Lass uns alles zusammensuchen, packen und vor die Haustür stellen, damit wir’s nur kurz einladen müssen.“
„Wieder einmal ist dein Plan genial.“ Er verneigt sich leicht vor mir und ich muss darüber lachen. „Wo wollen wir denn anfangen?“ Er stellt sein dreckiges Geschirr in die Spüle und sieht mich fragend an. „Bist du in der Küche soweit durch?“
„Ich denke schon.“ Auch ich stelle meinen leeren Teller weg. „Im Wohnzimmer habe ich mich nur kurz umgesehen, in den anderen Räumen gar nicht. Wir sollten auf jeden Fall das Badezimmer nach Medikamenten durchsuchen.“
„Dann lass uns uns am besten aufteilen, damit wir schnell weiterkommen. Es beunruhigt mich irgendwie, wenn wir an einem Fleck sind.“
„Ich weiß, was du meinst.“ Kurz blicken wir uns an. „Dann werde ich mal oben im Bad nachschauen und unsere anderen Sachen runterholen.“
„Und ich werde das alles in den Flur schleppen.“ Liam deutet auf die Tüten und Körbe, die ich gestern bereits gepackt habe. „Wir brauchen ein echt großes Auto, wenn wir das alles mitkriegen wollen.“
„Wir finden schon was Passendes“, sage ich über die Schulter beim Verlassen des Raumes. Geduckt gehe ich wieder an den Fenstern vorbei und laufe dann eilig die Treppe hinauf in das Badezimmer, das an das Elternschlafzimmer angrenzt.
Ich gehe auf den breiten Spiegelschrank über dem Waschbecken zu. Eigentlich will ich ihn nur kurz durchsuchen und dann weiterschauen, doch als ich mich ihm nähere, bleibt mein Blick an meinem Spiegelbild hängen. Mir fallen Liams Worte wieder ein und ich ziehe das Zopfband aus meinem Haar. Sofort fallen sie mir weich über die Schultern. Ich betrachte mein Gesicht eingehend, unter meinen braunen Augen liegen tiefe Schatten. Über meine Nase ziehen sich vereinzelte Sommersprossen, mein Gesicht wird von meinen blonden Locken gerahmt. Früher, als ich mein Haar kürzer trug, waren meine Haare kraus und wild. Inzwischen reichen sie über meine Schultern, sodass sie sich etwas ausgehängt haben und weich fallen. Die Person, die mich anblickt, sieht müde und erschöpft aus. Wenn mein Gesicht etwas mehr Farbe hätte, ich keine dunklen Augenringe und diesen stets bekümmerten Ausdruck hätte, würde ich vielleicht wirklich hübsch aussehen. So jedoch kann ich nicht nachvollziehen, weswegen Liam das vorhin zu mir gesagt hat. Aber vielleicht wollte er nur freundlich sein, die Stimmung etwas auflockern.
Clarissas Bild tritt mir wieder vor Augen, ihre helle Haut, das schwarze Haar, die blauen Augen. Immer wenn ich sie gesehen habe, sah sie perfekt aus. Sie macht sich viel mehr Gedanken über ihre Kleidung und ihr Make Up, sie hat jeden Tag eine andere Frisur. Ich hingegen ziehe das an, was in meinem Schrank obenauf liegt und schminke mich nur, wenn ich besonders gut aufgelegt bin. Meine Haare trage ich aus purer Gewohnheit zusammengebunden. Vielleicht hat Adam dich deswegen verlassen, Dummerchen, tadele ich mich selbst. Weil du dich gehen lässt, dir keine Gedanken um dein Äußeres machst. Und jetzt ist es zu spät. Kurz schüttele ich den Kopf, schüttele die Stimme, die Gedanken ab. Es ist unwichtig, weswegen Adam mich verlassen hat, es ist unwichtig, weswegen Liam vorhin diese Worte an mich gerichtet hat. „Die gottverdammte Welt geht gerade unter“, flüstere ich mir zu, als ich den Spiegelschrank öffne und ihn eilends durchsuche. „Da sollte ich mir wirklich keine Gedanken um mein Aussehen machen. Oder um Männer.“
Sämtliche Medikamente landen in der Tüte, die ich mir aus der Küche mitgenommen habe, ebenso wie Zahnbürsten, Zahnpasta und ein paar Handtücher. Danach gehe ich zurück in das Schlafzimmer und überprüfe, ob unsere Rucksäcke gepackt sind. Ich lege meinen Waffengürtel um, schultere die Rucksäcke und werde sofort wieder an meine schmerzenden Muskeln erinnert. Danach nehme ich mir Liams Gitarre, trage alles nach unten und stelle es am Fuße der Treppe ab.
„Bist du soweit?“ Liam kommt in den Flur und stellt die restlichen Sachen dazu.
„Ja, lass uns ein Auto klauen.“
Er grinst mich an, während er seine Glock in den Bund seiner Jeans steckt. „Wir sollten durch die Hintertür raus, nur für den Fall, dass auf der Straße noch Parasiten sind.“ Wir gehen zurück in das Wohnzimmer, werfen uns einen letzten Blick zu, als Liam den Sessel beiseite schiebt und dann seine Hand auf den Knauf legt. Er öffnet die Tür, nur einen Spalt breit, und ich schiebe mich nach draußen. Wachsam sehe ich mich um, doch der Garten ist leer und ruhig. Liam ist dicht hinter mir, als ich um das Haus schleiche und geduckt hinter dem Zaun auf die Straße sehe. Eine Handvoll Parasiten wankt dort umher, doch sie stellen kein großes Problem für uns da. Ich blicke mich weiter um, betrachte die wenigen Autos, die in den Auffahrten der Häuser stehen.
„Sieh nur“, flüstere ich Liam zu und deute auf einen dunklen Kleintransporter, der fünf Häuser weiter steht. „Der dürfte doch groß genug sein.“
„Ja.“ Er sieht zu den wenigen Parasiten, die auf der Straße sind. „Wir sollten durch die Gärten gehen –“ Mein Blick fällt auf eine Handharke neben ihm, sie hat drei gebogene Zacken „– dann können wir ungesehen zu dem Haus laufen –“ Ich greife nach ihr und betrachte sie kurz eingehend „– und durch die Hintertür rein –“ Mit der anderen Hand taste ich nach dem Gartentor neben mir und öffne es leise „– und dann suchen wir uns einen Weg in die Garage, dann können wir von dort zu dem Auto.“ Geduckt laufe ich auf die Straße, schleiche mich an einen der Parasiten an. Im nächsten Moment habe ich die Harke tief in seinem Kopf versenkt und ihn lautlos zu Boden gelegt. Zwei weitere werden auf mich aufmerksam, kommen gemeinsam auf mich zu. Ich ramme dem linken Parasiten die Harke in den Kopf, trete den anderen fest vor die Brust, ziehe die Harke schwungvoll wieder heraus und schlage dem anderen die Finne meines Hammers tief ins Gesicht. Auch sie sacken neben mir zusammen. „Oder wir pfeifen einfach auf Vorsicht und töten alles und jeden.“ Schwer atmend drehe ich mich zu Liam um, er kommt kopfschüttelnd, aber wie gewohnt grinsend zu mir gelaufen. „Nicht schlecht, Blondie. Hat mich ein bisschen an Kill Bill erinnert.“
„Du redest manchmal einfach zu viel“, erwidere ich grinsend und hänge den Hammer wieder in meinen Gürtel, die Harke behalte ich zur Sicherheit in der Hand.
Liam wirkt tatsächlich etwas beleidigt. „Ich versuche nur alles zu durchdenken.“
„Was ja auch wunderbar ist, aber manchmal hilft es einfach draufzuhauen. Komm.“ Ich gehe ihm voran zu dem Haus mit dem Transporter, er folgt mir leise murrend. Immer wieder werfe ich Blicke über die Schulter, versuche alles im Auge zu behalten. Zu oft sind wir bereits von den Parasiten überrascht worden und ihnen nur knapp entkommen. Doch die Straße ist ruhig, die wenigen, die ich sehe, sind Dutzende Meter von uns entfernt.
Als wir bei dem Transporter ankommen, zieht Liam sofort an der Tür. Doch der Wagen ist abgeschlossen. „Mist.“ Er legt seine Hände an die Scheiben und blickt in das Innere. „Sollen wir ihn aufbrechen?“
„Lass uns doch erstmal im Haus nach den Schlüsseln sehen.“
Wir gehen zu der Haustür, Liam drückt die Klinke, doch auch sie ist versperrt. „Verdammt nochmal!“ Während er wütend an der Tür zieht, blicke ich mich um und sehe einen Terrakotta-Frosch mit einem Willkommensschild neben der Tür stehen. „Geh ein bisschen zurück, ich werde sie eintreten.“ Ich knie mich hin und hebe ihn an, besehe mir seine Unterseite. Auf ihr klebt ein Schlüssel. Liam geht etwas zurück, nimmt Anlauf. Noch immer kniend zupfe ich an seinem Hosenbein. Als er zu mir runter blickt, zeige ich ihm grinsend den Schlüssel. „Oder … wir nehmen den Schlüssel.“ Er wird tatsächlich etwas rot. Er nimmt ihn mir ab und schließt die Tür auf. Mit gezücktem Schraubenzieher geht er mir voran in das Haus. Leise lasse ich die Tür hinter mir ins Schloss fallen und folge Liam dann den Flur entlang. Er geht auf die angelehnte Tür am Ende des Flures zu, dabei kommen wir an mehreren weiteren geschlossenen Türen vorbei. Vorsichtig stößt er sie weiter auf, tritt in das dahinter liegende Schlafzimmer. Ich will ihm gerade folgen, da kommt er bereits wieder aus dem Raum und zieht die Tür hinter sich fest ins Schloss. „Geh da nicht rein!“ Er hat seine Lippen fest aufeinander gepresst.
„Wieso nicht?“
„Vertrau mir einfach.“
Ich blicke in sein starres Gesicht. „Sie sind tot, oder? Die Leute, die hier gewohnt haben?“
Er seufzt leise. „Es ist nicht schön.“
„Aber vielleicht haben sie die Schlüssel bei sich.“
Er sieht mir ins Gesicht. „Lass uns erstmal im restlichen Haus nachsehen.“
Er schiebt mich von der Tür weg, nach und nach durchsuchen wir die anderen Räume des Hauses. Im Gegensatz zu dem, in dem wir uns die Nacht über versteckt haben, hat dieses nur eine Etage und wesentlich kleinere Räume. Bilder im Wohnzimmer verraten mir, dass ein älteres Ehepaar hier gelebt hat. Ich betrachte die Fotos, sehe mir auch die anderen Dinge an, die die alten Vitrinen füllen. Porzellanfiguren, künstliche Blumen und altes Geschirr sind in den Schränken, die Schlüssel finden wir jedoch nicht. Auch nicht in den anderen Zimmern. „Wir müssen zurück“, sage ich daher, als wir wieder auf den Flur treten, den Blick auf die geschlossene Schlafzimmertür gerichtet. „Sie müssen die Schlüssel im Schlafzimmer haben.“
„Bleib du hier, ich werde nachsehen.“
„Zu zweit sind wir aber schneller.“ Ich kann Liam ansehen, dass er nicht will, dass ich den Raum betrete. „Es ist süß, dass du dir Sorgen um mich machst, aber wir haben schon ganz andere Dinge inzwischen gesehen.“
Er seufzt leise. „Sag aber nicht, ich hätte dich nicht gewarnt.“
„Niemals.“ Wir gehen zum Schlafzimmer zurück, Liam stößt die Tür auf und geht mir voran in den Raum. Als ich ihm folge, schlägt mir sofort ein furchtbarer Geruch entgegen. Ich halte mir die Nase zu und sehe mich in dem Schlafzimmer um. Das alte Ehepaar, das ich auf den Fotos im Wohnzimmer gesehen habe, liegt in dem breiten Bett, er hält die Waffe noch in den Händen, mit der er zuerst ihr und dann sich selbst in den Kopf geschossen hat.
Ich betrachte das tote Ehepaar nachdenklich, während Liam den Raum durchsucht. „Hier sind sie auch nicht!“, ruft er frustriert aus.
Langsam gehe ich auf die Toten zu, den Blick auf etwas Silbernes gerichtet, das aus der Hosentasche des Mannes blitzt. Ich beuge mich leicht zu ihm herunter und zupfe mit spitzen Fingern den Schlüssel aus seiner Tasche. „Hier.“ Meine Stimme klingt komisch, da ich mir noch immer die Nase zuhalte. Der Verwesungsgeruch dringt dennoch zu mir durch, er ist kaum auszuhalten. Ich schaue wieder zu den Toten. „Vielleicht ist ihre Entscheidung gar nicht so dumm“, sage ich dann nachdenklich.
Liam kommt zu mir und nimmt mir die Schlüssel ab. Er wirft einen letzten Blick auf die beiden Toten. „Sie hatten einander. Es ist dumm.“ Er nimmt den Revolver in die Hand, schaut nach, wie viele Kugeln er noch hat. Dann steckt er ihn zu seiner Glock in den Bund seiner Jeans und verlässt den Raum. Auch ich schaue die beiden ein letztes Mal an, dann folge ich Liam. Er ist auf der anderen Seite des Flures, direkt an der Haustür. Er zieht sie ruppig auf und tritt nach draußen, ohne auf mich zu warten. Meine Brauen ziehen sich leicht zusammen, als ich ihm folge. Als ich nach draußen trete, sehe ich ihn bereits das Auto aufschließen und einsteigen. Ich gehe eilig zu der Beifahrerseite und ziehe sie auf. „Ich fahre den Wagen kurz rüber, du brauchst nicht mitzufahren.“
„Liam, was ist -“ Er lässt das Auto an und übertönt so meine Worte. Wütend schlage ich die Tür wieder zu, ich verstehe nicht, was auf einmal in ihn gefahren ist. Er fährt aus der Ausfahrt, rollt über die Straße auf das Haus zu, in dem unser Gepäck und die Vorräte sind. Ich jogge ebenfalls zu dem Haus, blicke mich um und sehe, dass die wenigen Parasiten in der Straße sich uns zugewandt haben. Sie haben das Auto gehört und kommen nun langsam auf uns zu. Meine Hand tastet wieder nach der Harke, ich umfasse sie fest. Als ich bei Liam ankomme, hat er bereits die Hintertüren des Transporters weit geöffnet. Ich sehe zu der kaputten Haustür und weiß, dass er sie dieses Mal einfach eingetreten hat, voller Wut, so wie es mir scheint. „Liam“, setze ich wieder an und folge ihm in den Flur des Hauses
Er nimmt unsere Rucksäcke und seine Gitarre. „Wir haben jetzt keine Zeit zum Reden, Eve, wir müssen alles einladen und dann hier weg, das hast du selbst gesagt.“ Er geht wieder nach draußen und lässt mich einfach stehen.
„Das kann doch nicht wahr sein!“, sage ich leise, als ich ihm hinterher sehe. Dann nehme ich mir zwei Tüten und gehe zurück zum Transporter.
„Ich lade ein, du holst den Rest.“ Liam reißt mir die Tüten aus der Hand und wirft sie achtlos in das Auto. Ich will wieder etwas sagen, hole bereits tief Luft. Doch dann stoße ich sie nur ungehalten aus, begreife, dass wir erst einmal hier weg müssen, ehe ich ihn auf sein dämliches Verhalten ansprechen kann. Also gehe ich wieder in das Haus und hole die anderen Sachen. „War’s das?“, fragt er mich, als ich ihm zwei weitere Taschen reiche.
„Ein Korb ist noch.“ Ich drehe ihm den Rücken zu und gehe zurück in das Haus. Der Korb steht einsam am Fuße der Treppe, es ist einer dieser zusammenfaltbaren Einkaufskörbe. Ich habe ihn mit sämtlichen Getränken, die ich finden konnte, beladen, da er am stabilsten ist. Als ich ihn nun anhebe, muss ich unter dem Gewicht ächzen und setze ihn wieder ab.
„Eve!“, ruft Liam von draußen.
„Ich komme ja schon!“, rufe ich gereizt zurück. Erneut hebe ich den schweren Korb an, versuche die Schmerzen in meinen Schultern zu ignorieren. Meine Muskeln sind noch von dem gestrigen Laufen mit den schweren Rucksäcken lädiert. Mit Hilfe meines Oberschenkels, auf dem ich den Korb abstütze, schaffe ich es letztendlich ihn hoch in meine Arme zu wuchten.
Als ich zur Tür aufsehe, steht dort Liam, seine Glock direkt auf mich gerichtet. Ich kann nichts sagen, starre ihn nur an, habe keine Chance wegen des Korbes an meine eigene Waffe zu gelangen. Der Schuss hallt in dem Haus laut wider, im nächsten Moment hat Liam mir den Korb aus den Armen gerissen. „Wir müssen hier weg, schnell!“
Ich drehe mich mit rasendem Herzen um, sehe den toten Parasiten auf der Schwelle zum Wohnzimmer liegen. Er muss durch die Hintertür in das Haus gelangt sein, die wir vorhin offen stehen gelassen haben. Ich habe nicht einmal gemerkt, dass er hinter mir war, nur wenige Zentimeter von mir entfernt. Kurz schüttele ich den Kopf, dann folge ich Liam nach draußen. Er hat die Hintertüren des Transporters geschlossen und steigt gerade auf der Fahrerseite ein. Wenige Sekunden später ziehe ich mich auf den Beifahrersitz und knalle die Tür laut hinter mir zu. „Wo kommen die auf einmal alle her?“ Mehrere Dutzend Parasiten sind auf einmal in der Straße und kommen auf uns zu.
„Das Auto und der Schuss müssen sie angelockt haben, wer weiß, wie viele von denen in den Häusern waren.“ Er lässt den Wagen an und tritt auf das Gas. Sofort kippen die Tüten hinter uns um, die Vorräte rollen über die breite Fläche. Ich klettere nach hinten, stelle die Tüten wieder auf und räume die Sachen zurück. Da fährt Liam scharf nach rechts, sodass ich das Gleichgewicht verliere und falle.
„Liam, verdammt!“, rufe ich und blicke wütend nach vorne.
„Dir hat keiner gesagt, dass du dahinten rumturnen sollst!“ Er fährt eine scharfe Linkskurve und ich falle in die andere Richtung. „Und überall sind diese verdammten Viecher, ich versuche nur ihnen auszuweichen.“ Wieder ein Schlenker nach rechts, der mich auf den Hintern fallen lässt.
Ich gebe den Versuch auf, die Tüten einzuräumen und sicher hinzustellen und klettere wieder auf den Beifahrersitz. „Was ist verdammt nochmal los mit dir?“, fahre ich Liam an. Er wirft mir einen Seitenblick zu, dann weicht er dem nächsten Parasiten auf der Straße aus. „Liam!“
Er zuckt leicht zusammen. „Du meintest vorhin im Haus, dass ihre Entscheidung gar nicht so dumm gewesen ist, von dem toten Ehepaar.“ Er hält auf einen der Parasiten zu, tritt das Gas voll durch und überfährt ihn einfach.
„Und?“ Ich halte mich am Türgriff fest, sehe ihn unverwandt an.
„Wieso hast du das gesagt?“
„Weil ich es glaube.“ Er schnaubt nur. „Okay, du bist anscheinend wütend, weil ich das gesagt habe. Aber du musst es mal aus meiner Perspektive sehen“, führe ich es weiter aus. „Ich habe niemanden mehr, dort draußen wandern verdammte Untote herum und fressen die Menschen! Und wenn es keinen Ausweg gibt, du weißt, dass du ihnen nicht entkommen kannst, wieso soll man es dann nicht zu seinen eigenen Bedingungen beenden?“
„Sie hatten einander.“ Er wirft mir wieder einen Seitenblick zu. „Und du hast mich.“
„Ich weiß. Und ich bin dankbar dafür.“
Wieder schaut er zu mir. „Wirklich?“
Ich lache kurz auf. „Ich wäre ohne dich schon lange tot, Liam. Wir kennen uns erst seit zwei Tagen, klar. Aber ich bin froh, dich zu haben. Nicht nur weil du mir mit den Parasiten hilfst. Sondern weil du mir hilfst nicht durchzudrehen. Ansonsten würde ich vielleicht wirklich so enden wie das alte Ehepaar.“
Er seufzt leise. „Es tut mir leid. Dass ich so heftig zu dir war, meine ich.“
„Wir alle drehen in diesen Zeiten durch“, erwidere ich nur, das tote Mädchen in der Badewanne wieder vor Augen. „Und wir alle tun, was wir für richtig halten.“
„Du hast wohl recht.“
„Das ist doch klar.“ Er lacht auf. „Also … weißt du eigentlich, wo wir gerade hinfahren?“, frage ich und blicke durch die Windschutzscheibe auf die Straße. Wir haben die Stadt bereits hinter uns gelassen.
„Wir müssen zum Interstate 66.“
„Meinst du, dass wir dort durchkommen werden?“
„Wir werden es herausfinden müssen … Andernfalls müssen wir uns eine Karte besorgen. Der Weg über den Interstate ist der einzige, den ich kenne.“ Er hat seine Brauen zusammengezogen, ich sehe leichte Sorge auf seinem Gesicht.
„Lass uns bitte nur nicht mehr Motorrad fahren, ansonsten bin ich bei allem dabei“, sage ich, den Blick auf sein Gesicht gerichtet.
„Das mit dem Motorrad tut mir leid, Kleines. Ich kann mir vorstellen, dass du Angst hattest. Wegen deiner Eltern und so.“ Er nimmt den Blick kurz von der Straße, um mich anzusehen.
„Ja … Wir hatten ja keine andere Wahl. Ich würde es in Zukunft trotzdem gerne vermeiden.“
„Ist gespeichert. Außerdem glaube ich, dass wir mit dem Baby hier ohnehin einen guten Deal gemacht haben.“ Liam klopft auf das Lenkrad.
„Da hast du wohl recht.“ Ich sehe mich in dem Kleintransporter um und sehe wieder die umgestürzten Tüten. „Wenn du für ein paar Minuten von den wilden Wendemanöver und dergleichen ablassen könntest, räume ich hinten mal das Chaos auf.“
„Ich überlege es mir“, grinst er.
Theatralisch verdrehe ich die Augen, dann ziehe ich mich zwischen den Sitzen durch in den hinteren Raum. Auf der breiten Fläche sind zwei der vier Tüten umgefallen, der Korb steht zum Glück auch noch. Ich sammele die Dosen ein und räume sie dann ordentlich in die Tüten zurück. Schnell merke ich jedoch, dass sie bei den leichtesten Erschütterungen wieder umzustürzen drohen. Ich sehe mich um, zwischen unseren Sachen liegen wenige, die den eigentlichen Besitzern des Kleintransporters gehört haben müssen. Mein Blick fällt auf einen Spanngurt. Ich nehme ihn mir, suche an der Wand zwei Punkte, an denen ich ihn befestigen kann, und hänge ihn ein. Nun ist er über die gesamte Breite der linken Wand gespannt. Säuberlich klemme ich die Tüten, unsere Rucksäcke, den Korb sowie Liams Gitarre hinter ihm fest und betrachte zufrieden mein Werk.
„Darf ich an deinen Rucksack?“, frage ich Liam, als mir eine Idee kommt.
„Na klar, da ist eh nichts Spannendes drin.“
„Ich will ihn nicht durchsuchen, ich dachte nur, dass wir es uns hier hinten etwas gemütlicher machen könnten“, erkläre ich, während ich die Decken und den Schlafsack aus seinem Rucksack hole. Liam hat sie fest zusammengerollt, ich bin überrascht, als ich das Bündel entfalte und sehe, dass es ganze vier Decken sind. Ich breite zwei auf der restlichen freien Fläche aus, rolle den Schlafsack aus und falte eine der Decken länglich, sodass sie ein gutes Kissen abgibt. Die letzte lege ich zusammen und lege sie neben den Schlafsack. Ein sehr provisorisches Bett für uns, doch besser als gar nichts.
Anschließend sehe ich meinen eigenen Rucksack durch; ich habe in Washington gegriffen, was mir damals als nützlich erschien, jetzt wird es Zeit, die Sachen einmal zu sichten. Ich habe noch zwei Dosen Ravioli und die Flasche Wasser. Ich lasse sie in dem Rucksack und packe aus unseren Vorräten Wasser und etwas Essen in Liams Rucksack. Falls wir den Transporter aufgeben müssen, sollten wir für den Notfall etwas Proviant bei uns haben. Ich finde meine Handtasche auf dem Boden des Rucksacks und ziehe sie heraus. Als ich auch sie durchsehe und Deo und Pfefferminzbonbons beiseitegeschoben habe, fällt mein Blick auf mein Handy. Ich habe bereits ganz vergessen, dass ich es dabei habe, in den letzten Tagen hat sich so vieles geändert. Ich blicke auf das Display, der Akku ist fast leer. Ich habe mehrere verpasste Anrufe. Mit dem Telefon in der Hand klettere ich wieder nach vorne zu Liam.
„Was hast du da?“
„Mein Handy. Ich hatte ganz vergessen, dass ich es mit habe.“ Ich gehe die verpassten Anrufe durch; Freunde von der Uni, eine Kollegin von Starbucks. Doch die meisten Anrufe sind von meiner Tante aus Deutschland, sie hat auch als einzige Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen. Kurz zögere ich, dann spiele ich sie ab und drücke auf den Lautsprecher.
„Eve, ich bin es, Barbara. Ich weiß, dass ich mich lange nicht bei dir gemeldet habe, aber hier passieren komische Dinge und ich wollte einfach nur wissen, ob es dir geht gut. Melde dich bei mir … Bitte.“ Die nächste Nachricht. „Eve.“ Sie schluchzt. „Ich habe solche Angst, so viele Menschen sind gestorben. Wir mussten die Stadt verlassen und Lennard … oh Gott, er ist tot. Sie haben ihn erwischt. Und sie sind überall, sie sind überall, sie sind -“ Ein verzerrtes Stöhnen ist zu hören, dann ein langer Schrei. Die Nachricht endet.
„Das klang nicht gut.“ Liam sieht mich besorgt an. Ich weiß, dass er nicht verstanden hat, was meine Tante gesagt hat, da sie auf Deutsch gesprochen hat. Ich gebe ihm die Nachrichten so wortgetreu wie möglich wieder, das Handy fest umfasst. „Es tut mir sehr leid“, sagt er dann und sieht bekümmert auf die Straße vor uns.
„Ich mochte sie nie“, sage ich leise, den Blick auf mein Telefon gesenkt. „Nachdem meine Eltern starben, hatten wir ein paar … Differenzen. Um genau zu sein, habe ich sie gehasst.“ Meine Augenbrauen ziehen sich zusammen. „Dennoch hat sie so ein Ende nicht verdient. Genauso wenig wie Lennard, ihr Mann.“ Ich seufze leise, schaue wieder auf mein Telefon. „Die Nachrichten sind zwei Tage alt, also muss es in Deutschland etwas später ausgebrochen sein.“
„Das ist ´ne verdammte Scheiße“, sagt Liam, das Lenkrad fest umfasst. „Wenn es dieses komische Virus auch in Deutschland gibt, da auch Parasiten sind … Dann wird es auf der gesamten Welt so aussehen.“
„Verdammte Scheiße“, wiederhole ich seine Worte leise und packe dann mein Handy in das Handschuhfach. Ich will es nicht mehr sehen, nicht mehr an mein altes Leben erinnert werden, an meine Freunde, die vermutlich alle tot sind. „Glaubst du, dass es überhaupt noch irgendwo sicher sein wird?“
„Wir müssen uns einen eigenen sicheren Ort schaffen.“ Sein Blick sucht den meinen. „Und deswegen müssen wir nach Arkansas. Auch wenn meine Familie … wenn sie … fort sein sollte, könnten wir uns dort etwas aufbauen.“ Er wirft mir einen schnellen Blick zu. „Sie wohnen weit außerhalb, man kann das Land gut überblicken. Und auf der einen Seite ist ein kleiner Wald, in dem man sich zurückziehen könnte im Notfall.“
„Sie leben noch, Liam“, sage ich leise, dennoch bestimmend. „Wir werden dort alle zusammen einen sicheren Ort schaffen, hörst du?“
„Das weißt du nicht.“
„Das stimmt. Aber ich glaube dennoch fest daran.“
„Danke.“ Er lächelt mir kurz zu. Dann schaut er wieder nach vorne. „Oh nein …“
Auch ich blicke nach vorne, schaue auf den Interstate, der vor uns liegt. Überall stehen Autos, teilweise sind sie demoliert durch Auffahrunfälle. Und egal wohin ich auch schaue, sehe ich Parasiten; sie wanken zwischen den Autos umher, sind teilweise noch in den Fahrzeugen eingeklemmt. Es müssen Hunderte sein, auf die gesamte Länge des Interstates gesehen sogar Tausende.
„Zeit für Plan B“, sage ich, als er anhält.
„Jip.“ Er seufzt leise, als er den Rückwärtsgang einlegt, um zu drehen.
Mein Blick schweift über den Interstate, ich versuche zu begreifen, wie viele Menschen versucht haben müssen zu fliehen und letztendlich in ihr Verderben gefahren sind. Da sehe ich einen Jungen, er steht auf einem Wagendach, Dutzende Parasiten um sich herum. Er schreit und tritt nach den Untoten, die ihn fassen und vom Auto ziehen wollen. „Liam!“ Ich fasse seinen Arm, deute auf den Jungen. „Wir müssen ihm helfen!“ Im nächsten Moment habe ich mich abgeschnallt und bin aus dem Wagen gestiegen.
„Blondie!“ Er steigt ebenfalls aus. „Was hast du vor?“
Ich sehe wieder zu dem Jungen, immer mehr Parasiten werden durch sein Schreien auf ihn aufmerksam. „Du musst mir aufs Dach helfen“, sage ich und schaue zu dem Kleintransporter auf.
„Was?“ Liam sieht mich verständnislos an.
„Wir können ihm da nicht raushelfen“, sage ich, schlucke schwer. „Es sind zu viele, wir würden selber bei draufgehen. Aber wir können ihn erlösen, ihn vor den Schmerzen bewahren.“
Er sieht mich kurz an. Dann verschränkt er seine Hände und hält sie mir als Tritt hin. Ich setze meinen Fuß in seine Hände, lasse mich von ihm anheben und ziehe mich anschließend auf den Transporter. „Wenn du schießt, Kleines, werden sie auf uns aufmerksam werden und hierher kommen.“ Ich blicke zu Liam hinab. „Ich setze mich schon in den Wagen und lasse den Motor an. Du hast einen Schuss, hörst du? Einen Versuch und dann steigst du zu mir in das Auto und wir verschwinden von hier, egal ob du getroffen hast oder nicht, okay?“
Ich nicke ihm zu und ziehe dann die Glock aus dem Bund meiner Jeans.
Liam steigt wieder ein und lässt den Motor an, der Wagen vibriert sanft unter meinen Füßen. Ich nehme den Jungen auf dem Autodach ins Visier, gerade als ich abdrücken will, packt ihn einer der Parasiten am Knöchel und reißt ihn um. Er knallt auf das Dach, schafft es noch sich festzuhalten, um nicht hinabzustürzen. Doch es reicht dennoch für den Parasiten, er wetzt seine Zähne tief in die Wade des Jungen. Ich sehe das Fleisch, das immer länger gezogen wird, ehe es reißt. Auf einmal ist da so viel Blut.
Ich muss mehrmals tief einatmen, um meinen rebellierenden Magen zu beruhigen, dann ziele ich erneut auf den Jungen. Er schreit so markerschütternd, während er sich am Dach festklammert und die Parasiten das Fleisch von seinen Beinen reißen. Als ich mir sicher bin, ihn zu treffen, drücke ich den Abzug durch. Ich treffe tatsächlich, sein Kopf zerplatzt. Doch ich kann mich nicht lange über meinen spärlichen Erfolg freuen, denn die Parasiten ziehen den toten Jungen vom Auto und beginnen ihn zu zerreißen. Und viele von ihnen blicken nun in unsere Richtung, versuchen mit ihren milchigen Augen die Quelle des Lärms auszumachen.
Sie sehen mich auf dem Dach des Kleintransporters stehen, beginnen zu fauchen und zu ächzen. Ich beobachte, wie sie einen Weg zu suchen beginnen, sie wollen zu uns, uns töten, zerreißen, verspeisen. Die parkenden Autos behindern sie, sie bewegen sich noch langsamer als ohnehin schon voran, sie stellen daher keine unmittelbare Gefahr für Liam und mich dar. Dennoch habe ich nicht vor, auf dem Dach des Transporters zu bleiben und zu beobachten, wie lange sie zu uns brauchen.
Ich springe vom Dach, reiße dann die Beifahrertür auf und springe in den Wagen. Liam tritt das Gaspedal fest durch und wir entfernen uns eilig vom Interstate. Ich drehe mich um, blicke durch die kleinen Heckfenster zurück auf den Interstate. Noch immer sehe ich die Traube von Parasiten, die sich um den Jungen scharen. „Du hast das Richtige getan.“ Ich drehe mich wieder nach vorne und sehe Liam an. Seine Miene ist ernst. „Du hast dem Jungen großes Leid erspart, furchtbare Schmerzen … Anders hätten wir ihn nicht retten können.“
„Leider.“ Meine Lippen sind fest aufeinander gepresst.
„Ja. Ich glaube, dass es auch nicht das letzte Mal gewesen sein wird.“
Ich muss seufzen. „Ich befürchte es auch.“
Wir schweigen beide kurz. „Wir müssen schnell eine Karte finden, irgendwo. Außerdem müssen wir bald mal tanken“, fügt er mit einem Blick auf die Anzeige hinzu.
„Dann lass uns mal hoffen, dass bald eine Tankstelle kommt“, sage ich und schaue mich in der verlassenen Kleinstadt um, durch die wir gerade fahren.
„Notfalls müssen wir ein Auto anzapfen.“ Ich verziehe leicht das Gesicht bei der Vorstellung. „Aber wir schauen erstmal nach einer Tanke“, sagt Liam grinsend, als er meine angewiderte Miene sieht. „Ein paar Meilen kommen wir noch weit.“
„Okay.“ Ich ziehe meine Beine auf den Sitz und umfasse sie mit den Armen. Nachdenklich stütze ich mein Kinn auf den Knien ab, denke über das nach, was in den letzten Stunden alles geschehen ist.
In den letzten drei Tagen habe ich Hunderte Tote gesehen. Menschen, die bei den vielen Unfällen ihr Leben verloren. Menschen, die von den Parasiten angefallen wurden, selber als Untote zurückkamen. Menschen, die entschieden haben, dass sie diese Erde lieber verlassen wollen, anstatt um ihr Überleben zu kämpfen. Ich denke über Liams und meine kleine Auseinandersetzung nach, seine Wut über mein Verständnis für das alte Ehepaar. Ich frage mich, wie viele Menschen noch über den Selbstmord nachdenken, diesen letzten Schritt vielleicht sogar schon gegangen sind. Und ich frage mich, was es zu bedeuten hat, dass auch ich mich schon mit dieser Option auseinandergesetzt habe, sie nachvollziehen kann.
Ist unsere Welt wirklich dem Untergang geweiht? Gibt es nur noch eine Handvoll Menschen, die so wie wir durch das Land reisen und versuchen, einen sicheren Ort zu finden? Das erste Mal seit Tagen denke ich wieder an die Worte des Präsidenten, dass verzweifelt nach einem Heilmittel geforscht wird. Ob sie vielleicht kurz vor dem Durchbruch stehen? Wir nur noch etwas länger durchhalten müssen, bis dieser wahr gewordene Albtraum ein Ende findet? Oder gibt es dort draußen niemanden mehr, der nach der Lösung sucht? Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir alle so enden werden?
„Da vorne ist eine Tankstelle“, reißt Liam mich aus meinen Gedanken und deutet auf ein altes Haus. Wir befinden uns auf einer abgelegenen Straße, die Tankstelle ist das einzige Gebäude weit und breit. Liam fährt auf den Hof und hält vor einer der Zapfsäulen. Sein Blick gleitet zu dem breiten Haus, es ist hell erleuchtet. „Ich werde mich da drinnen mal umsehen. Würdest du das Auto betanken?“
„Klar.“ Ich schnalle mich ab und steige aus, ebenso wie er. Während Liam zu dem Haus geht, nehme ich den Zapfhahn und beginne das Auto zu betanken. Ein leises Seufzen entfährt mir. Noch haben wir Strom und fließendes Wasser, wir können noch wenige Vorteile nutzen, die unsere Zivilisation vor wenigen Tagen noch als selbstverständlich angesehen hat. Doch bald werden wir auf Strom und Wasser verzichten müssen und das wird ganz neue, eigene Probleme schaffen, die unser Überleben erschweren werden.
Mein Blick fällt auf ein umgestürztes Regal an der Hauswand. Ich sehe mehrere Kanister unter ihm begraben. Ich werfe einen Blick zum Transporter, der noch immer betankt wird, dann gehe ich zu dem Regal. Ich stelle es wieder auf und betrachte die Kanister; es sind nur noch vier übrig, vermutlich kamen andere Flüchtende vorbei und haben den Rest mitgenommen. Dennoch sind vier besser als nichts, also nehme ich sie und trage sie zum Auto zurück.
Nachdem der Transporter vollgetankt ist, beginne ich die Kanister zu füllen und dann in den Wagen zu räumen. Ich klemme sie zu den anderen Vorräten hinter den Spanngurt und schließe dann die beiden Türen. Anschließend hänge ich den Zapfhahn zurück und sehe zu dem Gebäude. Es ist inzwischen eine gute Viertelstunde vergangen, seit Liam und ich uns getrennt haben, doch er ist noch immer nicht zurück. Ein ungutes Gefühl überkommt mich, ich werfe einen letzten Blick zu dem Transporter, dann gehe ich auf das Gebäude zu, eine Hand auf die Glock gelegt.
Ich höre Stimmen aus dem Inneren des Hauses, meine Brauen ziehen sich leicht zusammen, als ich die Tür öffne und eintrete. Der Tankshop sieht furchtbar aus, viele der Regale sind umgerissen, die einst säuberlich eingeräumte Ware über den Boden verteilt. Die Kasse ist zu meiner Rechten, sie steht offen und ist vermutlich leer. Neben ihr ist eine offen stehende Tür, aus dem benachbarten Raum dringen die Stimmen. Leise gehe ich auf die Tür zu und sehe eine kleine angrenzende Kneipe.
Liam steht nur wenige Meter von der Tür entfernt, ich sehe an seiner Haltung, dass er angespannt ist. Ihm gegenüber sind vier Männer, sie sitzen auf Barhockern, gefüllte Gläser vor sich. Zwei von ihnen scheinen in unserem Alter, die anderen beiden schätze ich auf Mitte vierzig.
„Liam?“, frage ich ängstlich in die angespannte Stille hinein und trete nah an ihn heran.
„Du hast uns gar nicht gesagt, dass du ein Mädchen dabei hast!“, ruft einer von ihnen aus und die anderen beginnen zu lachen. „Ich habe das Gefühl, als hätte ich seit Jahren keine Frau mehr gesehen, dabei ist es ein paar verfickte Tage her.“ Sie lachen wieder alle schallend.
Liam tritt einen Schritt beiseite, verdeckt mich so vor den Blicken der Männer. Seine Hand legt sich auf meine Hüfte, sanft schiebt er mich zu der Tür zurück. „Wie gesagt, wir wollten eh gerade gehen“, sagt er zu den Männern.
„Nein! Wieso bleibt ihr nicht noch ein bisschen, hm? Ey, Süße“, wendet sich einer der Männer an mich. „Willst du nicht was trinken? Wir haben alles da, sogar harten Alkohol.“
Ich blicke in das eingefallene Gesicht des Mannes, sein breites, widerliches Grinsen. „Nein, nein danke“, sage ich dann langsam, gehe immer weiter zurück. „Liam, ich bin fertig, wir können dann wieder fahren.“
„Das werden wir jetzt auch. War nett“, sagt er zu den Typen. Er schiebt mich weiter zur Tür, ich bin nur noch wenige Meter von ihr entfernt.
Im nächsten Moment schlingt sich eine Hand von hinten in mein Haar. Ich schreie auf und will mich losreißen, doch ich spüre nur Sekunden später, wie sich ein scharfes Messer an meine Kehle legt. „Eine falsche Bewegung und ich verpasse ihr ein hübsches zweites Grinsen“, sagt eine tiefe Stimme hinter mir.
Liam will auf uns zukommen, mir helfen, doch da erklingt das Geräusch einer Waffe, die gespannt wird. Einer der Männer zielt direkt auf Liams Kopf, seine Hand ist ruhig, sein Grinsen unverändert. „Schön langsam, mein Lieber“, sagt der Typ und die anderen beginnen wieder zu lachen.
Liam hebt langsam seine Hände über den Kopf. Ehe er sich zu den Kerlen umdreht, wirft er mir einen Blick zu. „Was wollt ihr?“
„Keine Sorge, wir lassen euch am Leben, wenn ihr kooperativ seid“, sagt der mit der Waffe. Seine Augen huschen zu mir, sein Grinsen wird eine Spur breiter. „Wie gesagt, ich habe seit gefühlten Jahren keine Frau mehr gesehen. John, nimm der Süßen mal den schicken Gürtel da ab.“ Er deutet mit seiner Waffe auf meine Hüften.
Einer der beiden Mittzwanziger kommt auf mich zu, ein breites Grinsen im Gesicht. Er will um mich herum fassen, um den Gürtel zu öffnen. Doch als er mir nahe kommt, spucke ich ihm ins Gesicht. Der Typ fasst sich ins Gesicht, schaut dann seine Hand an, beinahe verwundert. Dann schlägt er mir mit der flachen Hand ins Gesicht.
Liam kommt auf uns zu, er will den Typen, John, angreifen. Auf einmal hallt ein Schuss durch den Raum und ich sehe das Einschussloch wenige Zentimeter neben Liams Kopf. „Na na na, Süße, schön brav. Oder ich pumpe deinen Freund voller Kugeln.“ Ich werfe Liam einen verzweifelten Blick zu, dann senke ich den Blick, ergebe mich. Sie lachen wieder alle, als ich mir dieses Mal widerstandslos den Gürtel und die Glock abnehmen lasse.
„Mach dir keine Gedanken“, sagt John zu Liam. Er umfasst fest mein Gesicht, seine Finger bohren sich in meine Wangen. Er nähert sein Gesicht dem meinen, bis uns nur noch wenige Zentimeter trennen. Dann grinst er wieder. „Du bekommst sie wieder, wenn wir fertig sind.“ Erneutes Gelächter hallt durch den Raum. Er lässt mich los und sofort drehe ich den Kopf von ihm weg, sehe Liam an, seine Hände vor Wut geballt, sein Gesicht hilflos.
Das Messer drückt in meinen Hals, ich spüre warm das Blut meine Haut hinab rinnen, als der Mann hinter mir mich zwingt, weiter in den Raum zu gehen. Seine Hand schlingt sich etwas fester in mein Haar, schmerzhaft werden sie mir ausgerissen. Ich will an meinen Schopf fassen, seine Hand aus meinem Haar lösen, doch als ich auch nur andeute, meine Arme zu heben, drückt er das Messer tiefer in meine Haut. Mein Herz schlägt schmerzhaft gegen meine Brust, ich kann Liam hinter mir nicht mehr sehen und habe zu große Angst, dass sie ihn tatsächlich erschießen, wenn ich noch einmal versuche mich loszureißen.
John geht uns voran und legt meinen Gürtel auf den Tresen. Er öffnet anschließend die Tür neben der Bar, widerstandslos lasse ich mich in den Raum führen. „Drohe, ihren Freund zu erschießen und sie macht sofort, was man will.“ Die Männer beginnen zu grölen. Als der Mann hinter mir lacht, schneidet sein Messer immer wieder scharf in meine Haut. „Und du bleibst schön brav da stehen, wenn du nicht willst, dass wir ihr die Kehle aufschlitzen.“
Ich werde in den Raum bugsiert, es ist ein kleines Büro. Ich höre die Tür hinter uns zugehen, im nächsten Moment ist John wieder in meinem Blickfeld. „Wir haben euch beobachtet, seit ihr auf den Hof gefahren seid.“ Er lacht. „Wir sind ganz schön gewieft, was, Süße?“ Er wendet sich von mir ab, ich sehe die vielen Decken auf dem Boden und begreife, dass sie hier ihr Lager aufgeschlagen haben, schon seit mehreren Tagen hier leben müssen.
Noch immer hat der andere seine Hand in meinem Haar vergraben, das Messer an meiner Kehle. Ich sehe zu seinem Kumpel, der gerade die Decken auf dem Boden richtet. Ich weiß, was sie vorhaben, was Liam vom ersten Moment an begriffen hat. Mein Herz schlägt noch etwas schneller, meine Angst wird noch größer. „Bring sie her, Keith.“ Keith reißt wieder an meinen Haaren, das Messer drückt sich tief in meine Haut. Ich sehe auf die Decken am Boden, John, der grinsend daneben steht und langsam seinen Gürtel öffnet.
Mit Kraft trete ich Keith auf den Fuß und als er erschrocken aufschreit, reiße ich ihm das Messer aus der Hand. Ich winde mich aus seinen Armen, reiße mir Haare dabei aus. Als ich zu ihm herumfahre, will er sich auf mich stürzen. Ohne nachzudenken steche ich zu, ramme das Messer tief in seinen Körper, drei, vier, fünf Mal. Er bricht vor mir zusammen. Ich wende mich John zu, der mich aus weit aufgerissenen Augen ansieht. Schweratmend hebe ich das blutige Messer an, bereit, auch ihn niederzustechen.
Da ertönen hinter mir laute Schüsse.
Mein Kopf dreht sich zur Tür, mein Herz setzt kurz aus, als ich an Liam denke. Im nächsten Moment wirft sich John auf mich, schlägt mir das Messer aus der Hand. Ich knalle hart mit dem Kopf auf den Boden auf, bin durch den Aufprall benommen. Die Hände des Typens sind überall auf mir, er reißt an meiner Bluse, berührt mich. Ich kneife meine Augen fest zusammen, hole weit aus und ohrfeige ihn. Das Bild vor meinen Augen ist noch immer doppelt, dennoch hole ich wieder aus, schlage auf ihn ein, treffe ihn im Gesicht.
Meinen nächsten Schlag fängt er ab, umklammert fest mein rechtes Handgelenk. Seine Faust trifft mich seitlich auf die Nase, mein Blut spritzt. Mit meiner freien Hand versuche ich an seine Augen zu gelangen, ihn zu kratzen. Da legt sich seine andere Hand um meinen Hals und drückt fest auf meine Kehle. „Stirb, du Schlampe!“ Er lässt mein Handgelenk los, legt auch seine andere Hand um meinen Hals, die Sehnen an seinem Arm treten hervor, weil er so fest auf meine Gurgel drückt. „Du dämliche Hure!“
Panisch kratzen meine Finger über seine Arme, ich röchele leise, versuche seine Hände von meiner Gurgel zu bekommen. Doch er ist zu stark, seine Augen sind weit aufgerissen, auch er blutet aus der Nase. Dennoch grinst er breit, wahnsinnig, während er mich würgt, langsam erstickt. Ich trete mit den Beinen hilflos in die Luft aus, ziehe an seinen Händen, vergeblich. Das Bild flackert vor meinen Augen, mein Mund klappt sinnlos auf und zu.
Ein Schuss beendet jäh meinen Überlebenskampf. Das Gehirn des Typens spritzt an die Wand zu unserer Linken, er sackt im nächsten Augenblick tot auf mir zusammen. Ich höre einen weiteren Schuss, weiß, dass es Liam ist, der gerade dem Kerl in den Kopf schießt, den ich abgestochen habe. Ich wälze den Toten von mir herunter, kämpfe mich auf alle Viere und japse dann nach Luft, den Kopf zwischen den Armen.
„Eve!“ Liam wirft sich neben mir auf die Knie. „Bist du okay? Eve?“
„Alles – okay“, stoße ich hervor. Ich brauche weitere Sekunden, bis sich mein rasendes Herz etwas beruhigt hat. „Ich bin okay“, sage ich dann wieder und sehe zu ihm auf. Seine Augen sind weit aufgerissen, sein Gesicht ist blass. Ich atme noch immer schwer, als ich mich auf die Beine kämpfe. „Mir geht’s gut.“ Sein Blick gleitet über mein Gesicht, dann über meine Bluse. Auch ich sehe auf mein Oberteil, sehe die abgerissenen Knöpfe, den zerrissenen Stoff, die blutigen Fingerabdrücke auf dem hellen Blau. Ich kämpfe mich aus der Bluse, werfe das Stoffbündel weit von mir, kaum dass ich es ausgezogen habe. Meine Brust hebt und senkt sich schnell. „Lass – lass uns sehen, ob wir hier noch irgendwas Brauchbares finden. Ich – ich sehe mich drüben um.“ Ich will aus dem Raum gehen, nur raus aus diesem Zimmer, stoße jedoch hart mit der Schulter gegen den Türrahmen, als sich alles vor mir zu drehen beginnt.
Da legen sich Liams Arme sanft um mich, er stützt mich. „Lass uns zum Transporter gehen und einfach von hier verschwinden. Scheiß auf die Vorräte, wir haben genug.“
„Ja.“
Ich zittere, kann mich kaum noch aufrecht halten. Liam führt mich durch die Kneipe, ich sehe die anderen drei Männer, sie liegen tot auf dem Boden. Ich weiß nicht, wie er sie alleine bewältigen konnte, doch ich frage nicht nach. Wir betreten den Tankshop. Liam trägt mich mehr, als dass er mich stützt, ich stoße immer wieder gegen ihn und spüre dabei meinen Waffengürtel, den er sich umgehängt hat. Meine Beine zittern so sehr, dass sie mich kaum noch tragen können.
Im Vorbeigehen greift Liam mehrere Karten und steckt sie in seine Gesäßtasche, um mich weiterhin mit beiden Händen halten zu können. Als wir nach draußen treten, atme ich die frische Luft tief ein. Liam hilft mir in den Transporter, schnallt mich sogar an, als ich sitze. Dann schließt er sanft die Tür und eilt um den Wagen. Seine Tür fällt mit einem dumpfen Schlag ins Schloss und ich zucke leicht zusammen.
„Ich fahre gleich los, ich will mir vorher nur dein Gesicht ansehen. Und deinen Hals.“ Seine Brauen ziehen sich sorgenvoll zusammen, als er seine Hand nach mir ausstreckt. Seine Finger legen sich unter mein Kinn, seine Berührung ist so sanft, dass ich sie fast nicht spüre. Er betrachtet meine schmerzende Nase, hebt dann meinen Kopf leicht an, um die Dutzenden Schnitte auf meinem Hals zu betrachten. „Warte.“ Er klettert in den Laderaum des Transporters, kommt nach wenigen Minuten mit einem Handtuch und einer Flasche Wasser wieder nach vorne. Er presst das Handtuch fest auf die geöffnete Flasche, dann hält er sie kurz über Kopf.
„Es sieht toll aus, was du hinten gemacht hast.“ Behutsam tupft er mit dem feuchten Tuch meine Nase ab, wischt mir das Blut aus dem Gesicht und vom Hals. „Clever mit den Spanngurten, Kleines. Und das Bett sieht bequem aus, wir werden dort garantiert gut schlafen.“ Ich weiß, dass er nur mit mir redet, um mich zu beruhigen. Noch immer zittere ich am ganzen Körper, mein Herz schlägt noch immer viel zu schnell. „Tut deine Nase sehr weh?“ Ich blicke ihn stumm an, schüttele dann leicht den Kopf. „Halte lieber das Handtuch etwas gegen, es wird sie kühlen.“
„Okay.“ Ich flüstere, mein Hals schmerzt. „Können wir hier weg? Bitte?“
Liam gibt mir das Tuch. Er wirft mir einen besorgten Blick zu, dann startet er den Motor und fährt vom Hof. Ich sehe in den Seitenspiegel, sehe die Tankstelle immer kleiner werden. Erst als ich sie nicht mehr sehe, verlangsamt sich mein Herzschlag allmählich. Ich ziehe meine Beine auf den Sitz, umschlinge sie mit meinem linken Arm. Den rechten stütze ich auf den Knien ab, kann so besser meine schmerzende Nase kühlen.
Immer wieder sehe ich John vor mir, wie er grinsend seinen Gürtel öffnet, auf mich zukommen will. Ich kann das Japsen von Keith hören, als ich ihm das Messer in den Bauch gerammt, ihn getötet habe. Noch will ich nicht ganz begreifen, dass ich so eben einen Menschen getötet habe, einen von uns. Und noch weniger will ich begreifen, was sie uns antun wollten, mir. Sie haben sich bewusst gegen uns gestellt, in Zeiten, in denen die wenigen noch lebenden Menschen eigentlich zusammenhalten sollten.
Ich blicke aus dem Fenster, auf die vorbeiziehende Landschaft. Ich spüre Liams Blicke auf mir, immer wieder schaut er zu mir herüber. Ich weiß, dass er sich Sorgen um mich macht, wir fahren bereits seit mehreren Stunden, ohne dass einer von uns ein Wort gesagt hat. Das Handtuch in meinen Händen ist bereits getrocknet, ich halte es dennoch weiterhin an meine Nase. Meine Gedanken schweifen immer wieder ab, immer wieder zu der Tankstelle. Ohne Liam wäre mir dort etwas Schlimmeres widerfahren als der Tod.
Ich reiße mich von dem Fenster los und sehe zu ihm herüber. Mein Nacken schmerzt, da ich solange nach rechts geblickt habe. Liam hat das Steuer mit beiden Händen fest umfasst, seine Lippen sind aufeinander gepresst. Er macht sich noch immer Sorgen um mich. „Danke“, flüstere ich in die Stille hinein.
„Nicht dafür, Kleines“, sagt er schlicht.
„Doch. Ohne dich wäre ich … ich wäre …“ Erst jetzt dringt gänzlich zu mir durch, was er verhindert hat. Wieder beginnt mein Körper zu zittern, ein tiefes Schluchzen steigt in mir auf. Es bricht aus mir heraus, ich lege beide Hände auf mein Gesicht und beginne laut zu weinen.
Der Wagen wird langsamer, im nächsten Moment stehen wir. Ich höre Liams Gurt, als ich zwischen meinen Fingern zu ihm aufsehe, blicke ich direkt in seine bekümmerte, sorgenvolle Miene. Dennoch nimmt er mich nicht in die Arme und ich verstehe, dass er mich nicht gegen meinen Willen berühren will. Doch er würde mir niemals wehtun, ich weiß es einfach. Schluchzend schlinge ich meine Arme um seinen Hals und werfe mich an seine Brust. Sofort legt Liam seine Arme um mich, zieht mich fest an sich ran und hält mich einfach, während ich weine.
Die ganze Benommenheit fällt von mir ab, der ganze Schock. Seine Hände streichen beruhigend über meinen Rücken, in seinen starken Armen fühle ich mich sicher und geborgen. Ich weine lange, bis ich mich langsam beruhige und schließlich ganz verstumme. „Es ist okay, Eve“, sagt Liam leise, als ich still an seiner Brust ruhe, das Gesicht noch tränennass. „Es ist okay. Wir sind da raus, wir haben es geschafft.“
„Du hast mich gerettet“, flüstere ich.
„Du hast mich gerettet.“ Er drückt mich kurz fest an seine Brust, sein Gesicht in meinem Haar vergraben. Er atmet tief ein, dann lässt er mich los. „Du solltest etwas schlafen und dich ausruhen, Kleines.“ Er will den Motor wieder starten.
„Ich will nicht alleine sein“, sage ich leise. „Können wir – können wir nicht einfach eine Pause einlegen? Wir beide?“ Ich sehe zwischen meinen Wimpern zu ihm auf, sein Blick ruht auf mir.
„Vielleicht ist es wirklich das Beste“, antwortet er nach wenigen Minuten. Er betätigt die Türverriegelung und die Schlösser klicken beruhigend, als sie einrasten. Den Schlüssel lässt er stecken, für den Fall, dass wir schnell weiterfahren müssen. „Nach dir.“ Er deutet nach hinten.
Ich ziehe mich zwischen den Sitzen durch und er folgt mir. Müde lege ich mich auf die linke Seite des provisorischen Bettes und decke mich mit einer der Wolldecken zu. Liam zieht den Schlafsack auf und legt sich rein. Nachdem wir beide bequem liegen, sehen wir uns an. Seine Augen blicken noch immer besorgt drein, doch ein sanftes Lächeln spielt um seine Lippen. „Es ist wirklich sehr bequem“, sagt er leise.
Ich erwidere sein Lächeln schwach. „Danke.“
Sein Blick wird sanft. „Es war ein echt anstrengender Tag, Eve. Ruh dich aus.“
Meine Hand tastet nach seiner, als ich sie finde, umschließe ich sie fest. „Du auch. Schlaf gut.“
„Gute Nacht, Eve.“ Seine Finger verschlingen sich mit meinen. „Träum was Schönes.“
So schlafen wir schließlich ein.