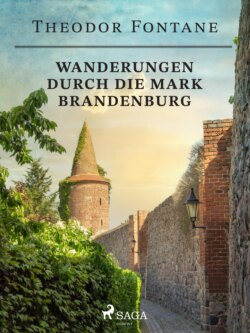Читать книгу Wanderungen durch die Mark Brandenburg - Theodor Fontane, Theodor Fontane - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Rheinsberg
Оглавление1. Die Kahlenberge. Französische Kolonistendörfer.
Einfahrt in Rheinsberg. Der Ratskeller.
Unter den Linden. Das Möskefest
Rheinsberg von Berlin aus zu erreichen ist nicht leicht. Die Eisenbahn zieht sich auf sechs Meilen Entfernung daran vorüber, und nur eine geschickt zu benutzende Verbindung von Hauderer und Fahrpost führt schließlich an das ersehnte Ziel. Dies mag es erklären, warum ein Punkt ziemlich unbesucht bleibt, dessen Naturschönheiten nicht verächtlich und dessen historische Erinnerungen ersten Ranges sind.
Wir haben es besser, kommen von dem nur drei Meilen entfernten Ruppin und lassen uns durch die Sandwüste nicht beirren, die, zunächst wenigstens, hügelig und dünenartig vor uns liegt. Fragt man nach dem Namen dieser Hügelzüge, so vernimmt man immer wieder »die Kahlenberge«. Nur dann und wann wird ein Dorf sichtbar, dessen ärmliche Strohdächer von einem spitzen Schindelturm überragt werden. Mitunter fehlt auch dieser. Einzelne dieser Ortschaften (zum Beispiel Braunsberg) sind von französischen Kolonisten bewohnt, die berufen waren, ihre Loire-Heimat an dieser Stelle zu vergessen. Harte Aufgabe. Als wir ebengenanntes Braunsberg passierten, lugten wir aus dem Wagen heraus, um »französische Köpfe zu studieren«, auf die wir gerechnet. »Wie heißt der Schulze hier?« fragten wir in halber Verlegenheit, weil wir nicht recht wußten, in welcher Sprache wir sprechen sollten. »Borchardt.« Und nun waren wir beruhigt. Auch die Südlichen-Race-Gesichter sahen nicht anders aus als die deutsch-wendische Mischung, die sonst hier heimisch ist. Übrigens kommen in diesen Dörfern wirklich noch französische Namen vor, und »unser Niquet« zum Beispiel ist ein Braunsberger.
Die Wege, die man passiert, sind im großen und ganzen so gut, wie Sandwege sein können. Nur an manchen Stellen, wo die Feldsteine wie eine Aussaat über den Weg gestreut liegen, schüttelt man bedenklich den Kopf in Erinnerung an eine bekannte Cahinetsordre, darin Friedrich der Große mit Rücksicht auf diesen Weg und im Ärger über 195 Taler, 22 Groschen, 8 Pfennig zu zahlende Reparaturkosten ablehnend schrieb: »Die Reparation war nicht nöthig. Ich kenne den Weg, und muß mir die Kriegs-Camer vohr ein großes Beest halten, um mir mit solches ungereimtes Zeug bei der Nahse kriegen zu wollen.« Der König hatte aber doch unrecht, »trotzdem er den Weg kannte«. Erst auf dem letzten Drittel wird es besser; im Trabe nähern wir uns einem hinter reichem Laubholz versteckten, immer noch rätselhaften Etwas und fahren endlich, zwischen Parkanlagen links und einer Sägemühle rechts, in die Stadt Rheinsberg hinein.
Hier halten wir vor einem reizend gelegenen Gasthofe, der noch dazu den Namen der »Ratskeller« führt, und da die Turmuhr eben erst zwölf schlägt und unser guter Appetit entschieden der Ansicht ist, daß das Rheinsberger Schloß all seines Zaubers unerachtet doch am Ende kein Zauberschloß sein werde, das jeden Augenblick verschwinden könne, so beschließen wir, vor unserem Besuch ein solennes Frühstück einzunehmen und gewissenhaft zu proben, ob der Ratskeller seinem Namen Ehre mache oder nicht. Er tut es. Zwar ist er überhaupt kein Keller, sondern ein Fachwerkhaus, aber ebendeshalb, weil er sich jedem Vergleiche mit seinen Namensvettern in Lübeck und Bremen geschickt entzieht, zwingt er den Besucher, alte Reminiszenzen beiseite zu lassen und den »Rheinsberger Ratskeller« zu nehmen, wie er ist. Er bildet seine eigene Art, und eine Art, die nicht zu verachten ist. Wer nämlich um die Sommerszeit hier vorfährt, pflegt nicht unterm Dach des Hauses, sondern unter dem Dache prächtiger Kastanien abzusteigen, die den vor dem Hause gelegenen Platz, den sogenannten »Triangelplatz«, umstehen. Hier macht man sich's bequem und hat einen Kuppelbau zu Häupten, der alsbald die Gewölbe des besten Kellers vergessen macht. Wenigstens nach eigener Erfahrung zu schließen. Ein Tisch ward uns gedeckt, zwei Rheinsberger, an deren Kenntnis und Wohlgeneigtheit wir empfohlen waren, gesellten sich zu uns, und während die Vögel immer muntrer musizierten und wir immer lauter und heitrer auf das Wohl der Stadt Rheinsberg anstießen, machte sich die Unterhaltung.
»Ja«, begann der eine, den wir den Morosen nennen wollen, »es tut not, daß man auf das Wohl Rheinsbergs anstößt. Aber es wird freilich nicht viel helfen, ebensowenig, wie irgend etwas geholfen hat, was bisher mit uns vorgenommen wurde. Wir liegen außerhalb des großen Verkehrs, und der kleine Verkehr kann nichts bessern, denn was unmittelbar um uns her existiert, ist womöglich noch ärmer als wir selbst. Durch ein unglaubliches Versehen leben hier zwei Maler und ein Kupferstecher. Der Boden ist Sandland, Torflager gibt es nicht, und die Fischzucht kann nicht blühen an einem Ort, dessen sämtliche Seen für vier Taler preußisch verpachtet sind.«
Wer weiß, wo diese Bekümmernisse schließlich gelandet wären, wenn nicht eine große Festfahne, die von einigen Kindern an uns vorübergetragen wurde, den Klagestrom unterbrochen, uns selbst aber zu der Frage veranlaßt hätte: »Was ist das?« – »Das ist die Fahne vom Möskefest, die man hat reparieren lassen«, erwiderte der andere, dessen gute Laune das Gegenstück zu der Morosität seines Nachbarn bildete. »Der sie trägt, ist Fähnrich Wilhelm Huth, und der ihm zur Rechten geht, heißt General Eduard Netzeband; sitzt seit Ostern in Quarta.« Diese Bemerkungen machten uns natürlich begierig, mehr zu hören, und so vernahmen wir denn, was es mit dem Möskefest eigentlich sei. Da diese Feier der Stadt Rheinsberg eigentümlich ist, so darf ich wohl einen Augenblick dabei verweilen. Das Möskefest ist ein Kinderfest, das alljährlich am Sonntage vor Pfingsten gefeiert wird. Möske bedeutet »Waldmeister« (asperula odorata), und in alten Zeiten lief die Festlichkeit einfach darauf hinaus, daß die Stadtkinder frühmorgens in den Wald zogen, Waldmeister pflückten und damit heimkehrend den Altar und die Pfeiler der Kirche schmückten. Erst im Jahre 1757 nahm die Feier einen andern Charakter an. Am 6. Mai war die Schlacht bei Prag geschlagen worden, und am 20. Mai traf die Nachricht davon in Rheinsberg ein. Es war Sonntag vor Pfingsten, also der Tag des Möskefestes. Die Siegesfreude, vielleicht auch der Umstand, daß der damals schon in Rheinsberg residierende Prinz Heinrich zu dem glücklichen Ausgange der Bataille sehr wesentlich beigetragen hatte, schuf auf einen Schlag die bis dahin rein kirchliche Feier in eine militärisch-patriotische Feier um. Und was damals Impromptu war, blieb. Das Möskefest ist ein Soldatenspiel geworden, das die Rheinsberger Jugend aufführt. Früh am Morgen schon ziehen vier Trommler durch die Straßen und schlagen Reveille, die jungen Soldaten sammeln sich, und so geht's mit Musik vor das Haus des »Generals«. Hier dreimaliges Vivat, dem General und seinen Angehörigen ausgebracht, dann zieht alles, militärisch in Sektionen aufmarschiert, in den schönen Boberow-Wald hinaus, wo nun das Waldmeisterpflücken beginnt. Nachmittags kommen die jungen Mädchen und besuchen mit ihren Angehörigen die mittlerweile zu Turnen und Wettlauf übergegangenen Soldaten in ihrem Waldbivouac, Preise werden verteilt, Pfänderspiele gespielt, und spät am Abend erst erfolgt unter Trommelschlag und Liedersingen der allgemeine Rückmarsch in die Stadt.
Unser Frühstück war abgetan, und wir schickten uns nunmehr an, dem Schlosse, dessen gelbe Rückwände schon überall durch das Baum- und Strauchwerk hindurchschimmerten, unsern Besuch zu machen. Die vertrauliche Mitteilung beider Herren indes, »daß der alte Kastellan um diese Zeit seinen Mittagsschlaf zu halten pflege«, bewog uns, zuvor einen Umweg zu machen und erst noch in die alte Rheinsberger Kirche hineinzugehen.
2. Die Rheinsberger Kirche
Wir hatten bald guten Grund, uns bei dem Mittagsschlafe des alten Kastellans zu bedanken, denn sehr wahrscheinlich, daß wir ohne denselben an der Rheinsberger Kirche vorübergegangen wären. Und doch ist es ein alter und in mehr als einer Beziehung interessanter Bau. Die erste Anlage desselben datiert weit zurück, und erst 1568 war es, daß er durch Achim von Bredow um zwei Drittel vergrößert wurde. Man kann den Anbau noch jetzt von dem älteren Teile deutlich unterscheiden.
Diese Kirche ist der einzige Punkt in Rheinsberg, wo man auf Schritt und Tritt den Bildern zweier völlig entgegengesetzter Epochen, der Bredow- und der Prinz-Heinrich-Zeit, begegnet und diesen Gegensatz als solchen empfindet. In Schloß und Park stören die französischen Inschriften nicht, wohl aber hier in der Kirche, darin deutsche Kunst und deutsche Sprache längst vorher Hausrecht geübt hatten.
Wir treten durch einen Vorbau von der Seite her ein. Gleich dieser Vorbau, der sein spärliches Licht nur mittelst der offenstehenden Tür empfängt, zeichnet sich durch den angedeuteten Gegensatz aus. Zur Linken, fast ein Viertel des ganzen Raumes einnehmend, erhebt sich hier ein grau getünchtes Monument, das genau die Form eines aus Backstein aufgemauerten Kachelofens hat. Es ist dies das Grabmal, das Prinz Heinrich dem Andenken seines Violinisten Ludwig Christoph Pitschner, geboren 5. März 1743, gestorben 3. Dezember 1765, errichten ließ, und trägt folgende Inschrift:
Un prince, ami des arts, secondant mon génie –
Déjà l'école d'Italie
A l'Allemagne mon berceau
Promet un Amphion nouveau:
Mais comme j'avançois dans ma carrière illustre
J'ai vu de mes beaux jours s'éteindre le flambeau
Sans passer le milieu de mon cinquième lustre;
Muses! pleurez sur mon tombeau.
Also etwa in freier Übersetzung:
Gepflegt, getragen durch fürstliche Gunst,
Versprach ich, ausübend italische Kunst,
Meiner Heimat zwischen Rhin und Rhein
Demnächst ein neuer Amphion zu sein.
Doch während ich leuchtend wuchs und stieg,
Stieg die Sonne meines Lebens herab.
Dem Tode gehört der letzte Sieg,
Und die Muse weint an meinem Grab.
So reimte man damals in Rheinsberg. Dem Pitschnerschen Monument gegenüber aber stehen an der Wand entlang sechs aufgerichtete Grabsteine der Bredowschen Familie, drei Männlein und drei Fräulein, die bis vor kurzem im Schiff der Kirche lagen, und blicken ernst verwundert zu dem Kachelofen hinüber, an dem sie mit Mühe den Namen Pitschner entziffern. Zum Glück verstehen sie nicht Französisch, sie würden sonst noch ernsthafter dreinschauen.
Wir treten nun in die freundliche, vor kurzem erst restaurierte Kirche. Die Hauptsehenswürdigkeit derselben ist das große, kunstvoll gearbeitete Grabmonument Achims von Bredow, desselben Achim von Bredow, der im Jahre 1568 die Kirche erneute und erweiterte. Es ist ein Denkmal von ganz ungewöhnlichen Dimensionen, das bei wenigstens zehn Fuß Breite gewiß die doppelte Höhe hat. Es beginnt über der Holzeinfassung des Chorstuhls, reicht bis fast an die Decke hinauf und besteht aus vier klar gegliederten Teilen. Oben das Bredowsche Wappen, zu beiden Seiten von allegorischen Figuren eingefaßt; darunter zwei Basreliefs, von denen das eine, nach links hin, die Auswerfung des Jonas aus dem Walfischbauche, das andere, nach rechts hin, die Auferstehung Christi darstellt; darunter in Lebensgröße die Figuren Achim von Bredows und seiner Gemahlin, einer gebornen Anna von Arnim; und endlich viertens unter diesen beiden Bildnissen folgende Inschrift:
O frommer Christ, urteile mild,
Der du anschauest dieses Bild.
Fragst du, wer ich sei im Grab?
Gewesen bin ich und itzt ab;
Verfolgung, Sorge, Kreuz ohn' Zahl,
Die mir begegnet überall,
Ich ritterlich obwunden hab
Und ruhe nun in meinem Grab.
Auch mit Geduld der Welt Bosheit
Hab ich ertragen allezeit
Nach Gottes Willen, welcher ist
Der allerbest zu jeder Frist –
Gelobet seist du, Jesu Christ.
Welch einfach schöne Worte. Die ganze Kernigkeit jener großen Zeit tritt einem daraus entgegen.
Wie klein und marklos daneben die französischen Verse, die, seitens eines der Hofpoeten des Prinzen Heinrich, zu Ehren eines Fräulein Elseners (einer Tochter des damaligen Rheinsberger Geistlichen) gedichtet und mit dünnen Buchstaben an den Fuß eines Aschenkrugs geschrieben wurden.
La vertu, la douceur, les charmes,
La firent aimer ici bas;
Aussi voit-on que son trépas
A chacun fait verser des larmes.
Wir liebten sie, weil sie lieblich vereint
Tugend, Sanftmut und Zauber der Wangen;
Jetzt nun, wo sie hinübergegangen,
Folgt ihr die Klage, und jeder weint.
Wir werden noch an andrer Stelle Versen der Art begegnen. Inmitten des Parks, der reich daran ist, erfreuen sie; hier aber, unter deutschen Liedern und Kernsprüchen, stören sie bloß und würden auch dann noch stören, wenn sie bedeutender wären, als sie sind. Es zeigt sich deutlich, daß die Kirche der gemiedene Schauplatz der Voltairianer war, ein unheimlicher, gotisch gewölbter Keller, für den es sich nicht verlohnte, wenn eine Elsener oder ein Pitschner starb, eine besonders poetische Kraftanstrengung zu machen.
Die Rheinsberger Kirche weist noch eine Reihe kleiner Sehenswürdigkeiten auf, die hier wenigstens in Kürze namhaft gemacht werden sollen. Unter diesen ist ein Kristallglas-Kronleuchter, den die Rheinsberger Jungfrauen hier aufhingen und zum ersten Male mit Lichtern schmückten, als im Sommer 1763, in Gegenwart des Prinzen Heinrich, das Friedensfest gefeiert wurde. Da begegnen wir weiterhin einem alten, aus gebranntem Tone gefertigten und mit Wappen und Malereien reich verzierten Taufsteine, den drei Geschwister Sparr (Franz, Anna und Sabina) der Kirche schenkten, und da fesselt uns drittens eine der Renaissancezeit angehörige Kanzel, die »Jobst von Bredows getreue Witwe«, mit allerhand Wappen der Bredows, Hahns und Schulenburgs ausgestattet, der Rheinsberger Kirche stiftete. Gegenüber dieser Kanzel, an der schweren alten Eichentür, die, von dem eingangs beschriebenen Vorbau her, in die Mitte der Kirche führt, stand am Pfingstsonntage 1737 König Friedrich Wilhelm I., eben erst von Berlin her in Rheinsberg eingetroffen. Als ein frommer Christ, der nicht leicht einer Predigt vorüberging, war er, eh er den kronprinzlichen Sohn im Schloß drüben überraschte, zuvor noch in die Kirche getreten. Und das war gut. Aber freilich, ein so frommer Herr er war, ein so strenger Herr war er auch, und der alte Geistliche Johann Rossow, der das Glück oder Unglück hatte, den König schon von früher her zu kennen, erschrak beim Anblick Seiner Majestät dermaßen, daß er nur noch fähig war, mit zitternder Stimme den Segen zu sprechen. Worauf der König mit dem Stock nach der Kanzel hinauf drohte, eine Form der Aufmunterung, die begreiflicherweise völlig ihres Zwecks verfehlte. Johann Rossow starb bald nachher infolge des Schrecks. Im übrigen aber muß Rheinsberg und ganz besonders sein Pfarrhaus immer eine gesunde Luft gehabt haben. Von 1695 bis 1848, also in mehr als 150 Jahren, finden wir daselbst nur vier Prediger.
Noch eines Kindergrabmals sei gedacht. Es stammt ebenfalls aus der alt-Bredowschen Zeit her und steht rechtwinklig auf das umfangreiche Monument des Achim von Bredowschen Ehepaars, das ich oben beschrieben. Ich würde dieses kleineren Denkmals, das die mittelmäßigen Bildnisse zweier Kinder, eines Mädchens und eines Knaben von drei bis vier Jahren, aufweist, an dieser Stelle gar nicht Erwähnung tun, wenn sich nicht, als an einem Musterbeispiele, daran zeigen ließe, wie und woraus Geschichten entstehn. Es wird einem nämlich erzählt, beide Kinder hätten am See gespielt und wären durch einen nicht aufgeklärten Zufall ertrunken. In der Hoffnung auf näheren Aufschluß unterzog ich mich einer Entzifferung der Umschrift. Und was fand ich? Das Mädchen war am 25. Februar, der Knabe am 4. März 1586, also acht Tage später, gestorben. Die bloße Datenangabe genügte hier völlig, alles das, was erzählt wird, als ein Märchen erkennen zu lassen. Aber eine Prüfung der Bildnisse selbst ergab mir auch den Ursprung der Fabel. Das lang herabhängende blonde Haar des Mädchens sah täuschend aus wie halbkrauses Lockenhaar, das im Wasser seine Krause verloren hat und nur noch leise gewellt, wie eine kompakte Masse, über den Nacken fällt. Einfach der Anblick dieses Haares, das nur deshalb wie vom Wasser zusammengehalten aussieht, weil es der Steinmetz nicht besser und natürlicher machen konnte, hat der kleinen Erzählung von den im See ertrunkenen Geschwistern die Entstehung gegeben.
Ihre größte Sehenswürdigkeit hat die Rheinsberger Kirche seit einem Menschenalter eingebüßt. Es war dies das alte Grabgewölbe, darin sich die Särge der Familien von Eichstädt und Sparr und besonders der Familie von Bredow befanden. Damals war die jetzt zugemauerte Gruft jedermann zugänglich, und nur am Schall des Tritts erkennt man auch heute noch, daß der Boden hohl ist, über den man hinschreitet. Ehe mit der Zumauerung begonnen wurde, schaffte man die drunten stehenden vierzig Särge noch einmal ans Tageslicht und öffnete die Deckel. Und so paradierten sie wochenlang im Schiff der Kirche. Vor demselben Altare, vor dem die Gesichter einiger Bredows in die großen Sandsteinplatten eingegraben waren, standen jetzt die Toten in ihren halbaufgerichteten Särgen und blickten geschlossenen Auges auf ihre eigenen Bildnisse herab. Endlich aber war die Zeit da, wo die Toten wieder in ihre mittlerweile gelüftete Gruft zurück mußten, und Achim von Bredow, dem man, als dem Vornehmsten, eine Flasche mit einem beschriebenen Zettel darin mit in den Sarg gegeben, eröffnete den Reigen. Auf dem Zettel aber stand, daß Träger dieses Herr Achim von Bredow sei, der in Genossenschaft vieler Bredows, Eichstädts und Sparrs hier 300 Jahre lang geschlummert dann behufs Lüftung der Gewölbe vier Wochen lang im Kirchenschiffe zu Rheinsberg ausgestanden und im Maimonat 1844 seine alte Wohnung wieder bezogen habe. Daran schloß sich eine Chronik und die Namensunterschrift von Bürgermeister und Rat.
Und nun noch eins.
Während der Zeit, daß die Särge geöffnet im Kirchenschiffe standen, trug sich eine Geschichte zu, die, mit ihrem gespenstischem Anfluge, die Gemüter der Rheinsberger allerdings auf Wochen hin beschäftigen durfte. Unter den Toten befand sich nämlich auch eine Margarete von Eichstädt, eine schöne Frau, die bei jungen Jahren gestorben war. Ihre weißen Grabgewänder waren noch wohlerhalten, um den Hals trug sie reiches Geschmeide und endlich auch einen schmalen Trauring am Ringfinger der rechten Hand. Tag und Nacht hatten Wächter in der Kirche gestanden. Als nun die Zeit kam, wo die Särge wieder geschlossen werden sollten, bemerkte man, daß der Ring am Ringfinger Margaretes von Eichstädt fort war. Ein gewöhnlicher Diebstahl konnte nicht vorliegen, das reiche Halsgeschmeide war unberührt geblieben, und nur eben der Ring fehlte.
Wer trug ihn jetzt?
3. Das Schloß in Rheinsberg. Anblick vom See aus.
Die Reihenfolge der Besitzer. Die Zimmer des Kronprinzen.
Die Zimmer des Prinzen Heinrich
Die alte Glocke zu Rheinsberg, die in mehr charakteristischen als poetischen Alexandrinern die Inschrift trägt:
Des Feuers starke Wut riß mich in Stücken nieder,
Mit Gott durch Meyers Hand ruf ich doch Menschen wieder –
schlägt eben vier und läßt uns die Vermutung aussprechen, daß selbst der Nachmittagsschlaf eines vierundachtzigjährigen Kastellans nunmehr zu Ende sein könne. Unser heiterer Freund antwortet mit einem ungläubigen »wer weiß«, ist aber nichtsdestoweniger bereit, die Führung bis ins Schloß zu übernehmen und uns seinem »Gevatter« vorzustellen. Unterwegs warnt er uns in humoristischer Weise vor den Bildererklärungen und Namensunterstellungen des Alten. »Sehen Sie, meine Herren, er hat eine Liste, auf der die Namen sämtlicher Portraits verzeichnet stehen, aber er nimmt es nicht genau mit der Verteilung dieser Namen. Einige Portraits sind fortgenommen und in die Berliner Galerien gebracht worden, was unsern Gevatter aber wenig kümmert; er stellt ihnen, nach wie vor, Personen vor, die sich gar nicht mehr im Schlosse zu Rheinsberg befinden. Prinzeß Amalie namentlich, die schon bei Lebzeiten soviel Schweres tragen mußte, muß auch im Tode noch allerlei Unbill über sich ergehen lassen, und jedes Frauenportrait, das der Wissenschaft der Kunstkenner und Antiquare bisher gespottet hat, ist sicher, als ›Schwester Friedrichs des Großen‹ genannt zu werden. Sie werden sie in Hofkostüm, in Phantasiekostüm und in Maskenkostüm kennenlernen; besonders mach ich Sie auf ein Kniestück aufmerksam, wo sie in Federhut und schwarzem Muff erscheint. Die Kehrseite des Bildes wäre Wohltat gewesen.«
Unter solchem Geplauder haben wir die der Stadt zu gelegene Rückseite des Schlosses erreicht, passieren den Schloßhof, steigen in ein bereitliegendes Boot und fahren bis mitten auf den See hinauf. Nun erst machen wir kehrt und haben ein Bild von nicht gewöhnlicher Schönheit vor uns. Erst der glatte Wasserspiegel, an seinem Ufer ein Kranz von Schilf und Nymphäen, dahinter ansteigend ein frischer Gartenrasen und endlich das Schloß selbst, die Fernsicht schließend. Nach links hin dehnt sich der See; wohin wir blicken, ein Reichtum von Wasser und Wald, die Bäume nur manchmal gelichtet, um uns irgendein Denkmal auf den stillen Grasplätzen des Parks oder eine Marmorfigur oder einen »Tempel« zu zeigen.
Das Schloß war in alten Tagen ein gotischer Bau mit Turm und Giebeldach. Erst zu Anfang des vorigen Jahrhunderts trat ein Schloßbau in französischem Geschmack an die Stelle der alten Gotik und nahm dreißig Jahre später unter Knobelsdorffs Leitung im wesentlichen die Formen an, die er noch jetzt zeigt. Eine Beschreibung des Schlosses versuch ich nur in allgemeinsten Zügen. Es besteht aus einem Mittelstück (corps de logis) und zwei durch eine Kolonnade verbundenen Seitenflügeln. In Front der See. Mehr eine Eigentümlichkeit als eine Schönheit bilden ein paar abgestumpfte Rundtürme, die sich an die Giebel der Seitenflügel anlehnen und deren einem es vorbehalten war, zu besonderer Berühmtheit zu gelangen.
Langsam nähern wir uns wieder dem Ufer, befestigen den Kahn am Wassersteg und schreiten nun plaudernd unsren Weg zurück. Unter der Kolonnade machen wir halt und rekapitulieren die Geschichte des Orts. Es ist nötig, sie gegenwärtig zu haben.
Die Herrschaft Rheinsberg war ein altes Besitztum der Bredows. Seit 1618 sind die Hauptdaten folgende:
Jobst von Bredow verkauft Rheinsberg an Kuno von Lochow, Domherrn zu Magdeburg. 1618.
Der Große Kurfürst nimmt, nach dem Erlöschen dieser Familie von Lochow, Rheinsberg in Besitz und schenkt es dem General Duhamel. 1685.
General Duhamel verkauft es sofort an den Hofrat de Beville.
Die Bevilles besitzen es, Vater und Sohn, bis 1734. Vom Sohne, dem Oberstlieutenant Heinrich von Beville, kauft es König Friedrich Wilhelm I. und schenkt es an den Kronprinzen Friedrich 1734.
Der Kronprinz (Friedrich der Große), obschon nur bis 1740 dort, behält es als Eigentum bis 1744.
Im Jahre 1744 erhält es Prinz Heinrich von seinem Bruder als Geschenk, übersiedelt aber erst 1753 nach Rheinsberg.
Prinz Heinrich von 1753 bis 1802 († 3. August).
Prinz Ferdinand von 1802 bis 1813 († 2. Mai).
Prinz August von 1813 bis 1843 († 19. Juli).
Seit 1843 ist es wieder königlicher Besitz. –
Wir nähern uns jetzt von der Kolonnade her dem linken Flügel des Schlosses, treten auf einen großen Flur und ziehen leise mit der Hand des Bittstellers an der Klingel des Kastellans. Er schläft wirklich noch, aber seine Frau nimmt unverdrossen das große Schlüsselbund von der Wand und schreitet treppauf vor uns her.
Wollt ich dem Leser zumuten, uns auf diesem Gange zu folgen, so würd ich ihn nur verwirren; ich begnüge mich deshalb damit (ohne Rücksicht auf die Reihenfolge, darin wir die Zimmer sahen), in nachstehendem erst von den Zimmern des Kronprinzen Friedrich und danach von denen des Prinzen Heinrich zu sprechen.
Zunächst also die Zimmer des Kronprinzen, des nachmaligen »großen Königs«. Sie befinden sich in beiden Flügeln, wenn man, wie billig, den großen Konzertsaal mit hinzurechnet, den Konzertsaal, in welchem unter Leitung Grauns und unter Mitwirkung des Kronprinzen die klassischen Kompositionen jener Epoche zur Aufführung kamen. Dieser Konzertsaal befindet sich (immer von der Seefront aus) im linken Flügel des Schlosses, von dem aus seine hohen Fenster einerseits auf den Schloßhof, andrerseits auf das »Kavalierhaus« und einen vorgeschobenen Teil der Stadt herniederblicken. Er ist etwa vierzig Fuß lang, fast ebenso breit und vortrefflich erhalten. Die Wände sind von Stuck und die Fensterpfeiler mit Spiegeln und Goldrahmen reich verziert; eine Hauptsehenswürdigkeit aber ist das große Deckengemälde von Pesne, das dieser, nach einem den Ovidschen »Metamorphosen« entlehnten Vorwurf, im Jahre 1739 hier ausführte. Der Grundgedanke ist: »die aufgehende Sonne vertreibt die Schatten der Finsternis« oder, wie einige es ausgelegt haben, »der junge Leuchteprinz vertreibt den König Griesegram«. Die Technik ist vortrefflich, und wie immer man auch über pausbäckige Genien und halbbekleidete Göttinnen denken mag, in dem Ganzen lebt und webt eine künstlerische Potenz, gegen die es nicht gut möglich ist sich zu verschließen. Schinkel soll unter dem Einfluß dieses Deckengemäldes die große Komposition entworfen haben, die sich jetzt al fresco in der Säulenhalle des Berliner Alten Museums befindet. Was übrigens den Konzertsaal selber angeht, so fand innerhalb desselben, im Sommer 1848, ein etwas in Rot getauchtes Ruppin-Rheinsbergisches Gesangfest statt, das eigentümlich gestört wurde. Man war eben auf der »Höhe der Situation«, als sich plötzlich eine halbe Stuckwand loslöste und mitten in den entsetzten Sängerkreis hineinfiel. Alles stob auseinander. Das Mauerwerk des alten Schlosses hatte sich aus seinen friderizianischen Erinnerungen heraus empört.
Dieser linke Flügel enthält außer dem Konzertsaal noch zehn oder zwölf kleinere Räume, von denen einige die Zimmer der Prinzeß Amalie heißen, während der Rest sich ohne jeden Namen begnügen muß. Diese »Namenlosen« sind die einzigen Räume des Schlosses, die noch eine praktische Verwendung finden. In ihnen logieren die Hausministerialbeamten, die hier gelegentlich eintreffen, um nach dem Rechten zu sehen. Es macht einen ganz eigentümlichen Eindruck, wenn man nach Passierung einer langen Reihe von Zimmern, die nur immer die Vorstellung in uns wachriefen, »hier muß der oder der gestorben sein«, plötzlich in ein paar Räume tritt, die liebe Rückerinnerungen an die Tage eigenen Chambre-garnie-Lebens in uns wecken. Die kleinen Bettstellen von Birkenmaserholz, die roten Steppdecken von allersimpelstem Kattun, die Waschtoiletten mit dem Klappdeckel und die beinah faltenlosen Zitzgardinen, als habe das Zeug nicht ganz gereicht, alles hat den schlichtbürgerlichsten Charakter von der Welt, und das eitle Herz freut sich der Wahrnehmung, daß man in Schlössern schläft wie anderswo.
Doch vergessen wir über diesem stillen Behagen nicht unsere eigentliche Aufgabe, und wenden wir uns lieber jenem kleinen Arbeitszimmer zu, das, mit noch größerem Recht als der Konzertsaal, den Namen des großen Königs führt.
Dies Arbeitszimmer liegt im rechten Flügel des Schlosses, und zwar in dem kleinen Rundturm, der den Hügel nach vorn hin abschließt. Wir passieren abermals eine lange Zimmerreihe, bis wir endlich in ein kleines und halbdunkles Vorgemach treten, das sein Licht nur durch eine Glastür empfängt. Dies halbdunkle Vorgemach enthielt die kleine Bibliothek, die Friedrich der Große bald nach seiner Thronbesteigung nach Potsdam schaffen ließ; das davorliegende Zimmer aber, von dem uns nur noch die Glastür trennt, ist das Arbeitszimmer selbst. Nur sehr klein (höchstens zwölf Fuß im Quadrat), hat es nach drei Seiten hin eine entzückende Aussicht über Wald und See. Vor 140 Jahren muß es auch in seiner Ausstattung einen durchaus heiteren und angenehmen Eindruck gemacht haben. Es ist ein Achteck, das mit drei Seiten in der Mauer steckt, während fünf Seiten frei und losgelöst nach vorn hin liegen. Das Ganze setzt sich abwechselnd aus Wand- und Glasflächen zusammen: vier Paneelwände, drei Nischenfenster und eine Glastür. Die Fensternischen sind sehr tief und boten deshalb Raum zur Aufstellung von Polsterbänken, die sich an beiden Seiten entlangziehen. An den Paneelwänden stehen altmodische Lehnstühle mit versilberten Beinen und schlechten, dunklen Kattunüberzügen. Über den Lehnstühlen aber, in ziemlicher Höhe, sind Konsolen mit den Büsten Ciceros, Voltaires, Diderots und Rousseaus angebracht. In die Holzbekleidung ist vielfach Spiegelglas eingelassen, während sich zu Häupten der Eingangstür allerlei Zeichen des Freimaurerordens befinden und abermals ein Pesnesches Deckengemälde den Plafond bedeckt. Dasselbe zeigt die Ruhe beim Studieren; ein Genius überreicht der sitzenden Minerva ein Buch, auf dessen Blättern man die Namen Horaz und Voltaire liest. Das Bild hat verhältnismäßig gelitten und kann überhaupt mit der glänzenden Schöpfung desselben Meisters im Konzertsaale nicht verglichen werden. In der Mitte des Zimmers steht auf vergoldeten Rokokofüßen und etwa von der Größe moderner Damenschreibtische der Arbeitstisch des Prinzen. Seine Schreibplatte liegt schräg und kann aufgeklappt werden. Sie war ehedem mit rotem Samt überzogen, hat aber nicht nur die Farbe, sondern auch den ganzen Samtstoff längst verloren. Der Samt wird bekanntlich auf eine Unterschicht von festem Zeug aufgetragen. Diese Unterschicht war 1853, als ich Rheinsberg zum ersten Male besuchte, noch ziemlich intakt vorhanden. Seitdem aber haben sich die Dinge sehr zum Schlimmeren verändert. Nicht die Hälfte mehr existiert von diesem Unterzeug, und man kann deutlich sehen, wie die Federmesser, je nach der Charakteranlage der Besucher, mal größere, mal kleinere Karos herausgeschnitten haben. Ich liebe nicht die Kastellane, die einen durch ihren Diensteifer um die Möglichkeit eines ruhigen Genusses bringen, aber ebensowenig mag ich jenen das Wort reden, die voll mißverstandener Nachsicht ein Auge da zudrücken, wo sie's aufmachen sollten.
Wir nehmen zögernd Abschied von diesem interessanten Zimmer, um uns nun den Zimmern des Prinzen Heinrich zuzuwenden. Sie liegen im ersten Stock des corps de logis und bilden eine ununterbrochene Reihenfolge. Den Anfang machen die sogenannten Prinz-Ferdinands-Zimmer, das heißt diejenigen, die Prinz Ferdinand zu bewohnen pflegte, wenn er bei seinem älteren Bruder, dem Prinzen Heinrich, zum Besuche war. Vielleicht auch residierte der erstgenannte Prinz in der Zeit von 1802 bis 1813 wenigstens zeitweilig hier und bewohnte dann diese Räume.
Hinter diesen sogenannten Prinz-Ferdinands-Zimmern folgt der Konzertsaal (nicht zu verwechseln mit dem kronprinzlichen im linken Hügel), alsdann der sehr gut erhaltene Muschelsaal und endlich das Bibliothekzimmer. Neben diesem befindet sich das Schlaf- und Sterbezimmer des Prinzen Heinrich. Es ist ein großes, ziemlich dunkles Gemach, durch ein Paar Säulen in zwei Hälften geteilt. In der dunkleren Hälfte, halb durch die Säulen verdeckt, steht das Sterbebett, ein stattlicher, mit schweren Seidenvorhängen reich ausgestatteter Bau. Derartige Staatsbetten, namentlich wenn alt geworden, machen in der Regel einen ängstlichen Eindruck und erfüllen uns mit Dank, nicht in ihnen schlafen zu müssen. Anders hier, weil sich nichts von Verschossenheit zeigt, vielmehr alles frisch und farbig und voll beweglich lebensvoller Falten. – Um dieses Schlaf- und Sterbezimmer her gruppieren sich einige kleinere, die nur durch ihre Schildereien interessieren, meist Bilder in chinesischer Tusche von der Hand des Prinzen Heinrich selbst. Im großen und ganzen aber herrscht Mangel an guten Bildern, und nur einige wenige hat man dieser Stelle gelassen. Unter diesen sind zwei Bildnisse des jungen Grafen Bogislaw von Tauentzien und ein Portrait der ersten Königin, Sophie Charlotte, bei weitem die besten.
Auch die Zimmer im Erdgeschoß sind nicht ohne Interesse. Bilder, Büsten, Ausschmückungsgegenstände, die sich teils noch aus der Zeit des Prinzen Heinrich her in diesen Zimmern befinden oder aber verschönerungshalber seitdem ihren Weg aus dem obern Stock ins untere genommen haben, fesseln hier den Beschauer. In einem dieser Räume befinden sich beispielsweise die Büsten des Marquis de la Roche-Aymon und seiner Gemahlin, daneben eine Büste des französischen Schauspielers Blainville. Der Marquis, auf den ich in einem späteren Kapitel zurückkomme, war nach Tauentziens Abgang Adjutant des Prinzen und nebenher eine Art Général en chef des prinzlichen Heeres, das heißt jener im Solde des Prinzen stehenden Leibhusarenschwadron, die in Rheinsberg ihre Garnison und im Schlosse den Dienst hatte. Der Schauspieler Blainville, ein besonderer Liebling des Prinzen, gab sich selbst den Tod, als es der Kabale seiner Genossen gelungen war, ihm momentan die Gunst seines Herrn zu entziehen. Der Prinz soll diesen Verlust nie verwunden haben.
Ein größerer Saal neben jenem büstengeschmückten Zimmer macht den Eindruck einer gewissen Wohnlichkeit, vielleicht weil er ein paar Spezialitäten enthält, die uns, wie ein Vogelbauer oder ein Tisch voll Nippsachen, die wohltuende Nähe von Menschen auch dann noch empfinden lassen, wenn diese lange vom Schauplatze abgetreten sind. Zu diesen Spezialitäten zähl ich hier ein würfelförmiges Postament von dem Umfang eines großen Tabakskastens, das auf einem halb versteckten Ecktisch steht. Dieser Kasten muß bei bestimmter Gelegenheit als Untersatz für eine kostbare Blume gedient haben und von dem einen oder andern seiner Verehrer dem Prinzen überreicht worden sein. Noch jetzt umschließt der Kasten einen Blumentopf, aber die Blumen selbst sind von Papier. Alle vier Wände des Kastens enthalten reizende Aquarellbildchen, zwei davon Schlachtenbilder en miniature, von denen das eine die Inschrift trägt: »Condé aux lignes de Fribourg«, das andere: »Henri à la bataille de Prague«. Die Verbindlichkeit ist sehr fein und die Parallele gut gezogen. »Condé aux lignes de Fribourg« ist vielleicht eine Kopie, wenigstens entsinn ich mich dunkel, im Louvre oder in den Sälen von Versailles etwas Verwandtes gesehen zu haben. Auf dem Frontbilde: »Henri á la bataille de Prague«, erhebt der Prinz eben den Degen, und den Kopf nach rechts hin zurückgewandt, um durch Wort und Blick die Nachfolgenden anzufeuern, führt er eine Grenadiercompagnie zum Sturm.
4. Prinz Heinrich. Der Rheinsberger Park.
Herr von Reitzenstein und der verschluckte Diamant.
Der Freundschaftstempel. Das Theater im Grünen.
Das Grabmal des Prinzen
Außer den im vorigen Kapitel beschriebenen Zimmern des Kronprinzen und des Prinzen Heinrich enthält das Rheinsberger Schloß nichts, was der Erwähnung wert wäre. Wenn man wieder ins Freie tritt, um, über den Schloßhof hin, dem Park und dem See zuzuschreiten, so kann man die Frage nicht abwehren: Wie kommt es, daß dieser kluge, geistvolle Prinz Heinrich, dieser Feldherr sans peur et sans reproche, dies von den nobelsten Empfindungen inspirierte Menschenherz so wenig populär geworden ist? Man geh in eine Dorfschule und mache die Probe. Jedes Tagelöhnerkind wird den Zieten, den Seydlitz, den »Schwerin mit der Fahne« kennen, aber der Herr Lehrer selbst wird nur stotternd zu sagen wissen, wer denn eigentlich Prinz Heinrich gewesen sei. Selbst in Rheinsberg, das der Prinz ein halbes Jahrhundert lang bewohnt hat, ist er verhältnismäßig ein Fremder. Natürlich, man kennt ihn, aber man weiß wenig von ihm. Einige von den Alten entsinnen sich seiner, erzählen dies und das, aber die lebende Generation lernt Geschichte wie wir, das heißt, liest lange Kapitel vom Kronprinzen Friedrich und seinem Rheinsberger Aufenthalt und hat sich daran gewöhnt, den Konzertsaal und das Studierzimmer als die alleinigen Sehenswürdigkeiten des Schlosses anzusehen. Die Zimmer des Prinzen Heinrich, Prinz Heinrich selbst, alles ist bloße Zugabe, Material für die Rumpelkammer. Das harte Los, das dem Prinzen bei Lebzeiten fiel, das Geschick, »durch ein helleres Licht verdunkelt zu werden«, verfolgt ihn auch im Tode noch. An derselben Stelle, wo er durch fast zwei Menschenalter hin gelebt und geherrscht, geschaffen und gestiftet hat, ist er ein halb Vergessener, bloß weil der Stern seines Bruders vor ihm ebendaselbst geleuchtet. Und ein Teil dieses Mißgeschicks wird auch bleiben. Aber es ist andrerseits nicht unwahrscheinlich, daß die nächsten fünfzig Jahre schon Verdienst und Klang des Namens mehr in Harmonie bringen werden. Um es mit einem Wort zu sagen: dem Prinzen hat der Dichter bis zu dieser Stunde gefehlt. Von dem Augenblick an, wo Lied, Erzählung, Schauspiel ihn unter ihre Gestalten aufnehmen werden, werden sich auch die Prinz-Heinrich-Zimmer im Rheinsberger Schlosse neu zu beleben anfangen, und die Kastellane der Zukunft werden zu berichten wissen, was in dieser und jener Fensternische geschah, wer den Blumenkasten übergab und unter welchem Kastanienbaum der Prinz seinen Tee trank und mit einem freudigen »Oh, soyez le bien venu« sich erhob, wenn Prinz Louis am Schloßtor hielt und lachend aus dem Sattel sprang.
Historische Gestalten teilen nicht selten das Schicksal alter Statuen. Einzelne stehen durch ein Jahrtausend hin immer leuchtend und immer bewundert auf dem Postament ihres Ruhmes; andere werden verschüttet oder in den Fluß geworfen. Aber endlich kommt der Moment ihrer Wiedererstehung, und nun erst – neben den glücklicheren neu aufgerichtet – erwächst der Nachwelt die Möglichkeit des Vergleichs.
Es muß zugegeben werden (und ich habe bereits in dem Kapitel »Die Kirche zu Rheinsberg« darauf hingewiesen), daß etwas prononciert Französisches in Sitte, Gewöhnung, Ausdruck sowie das geringe Maß jener kurbrandenburgischen Derbheit, die wir an Friedrich dem Großen, all seiner Voltaire-Schwärmerei zum Trotz, so deutlich erkennen und so sehr bewundern, der Volkstümlichkeit des Prinzen Heinrich immer hindernd im Wege stehen wird, es fehlt aber auch noch viel bis zu jenem bescheideneren Teile von Popularität, worauf er unbedingten Anspruch hat. Seine Repliken waren nicht im Stile des älteren Tauentzien, als dieser, unter Androhung, »daß man das Kind im Mutterleibe nicht schonen werde«, aufgefordert wurde, Breslau zu übergeben; aber wenn er in seinen Antworten auch nicht dem Richard Löwenherz glich, der mit seinem Schwert ein zolldickes Eisen zerhieb, so glich er doch dem Saladin, der mit seiner Halbmondklinge das in die Luft geworfene Seidentuch im Niederfallen durchschnitt. Nur selten war er derb, rauh nie.
Wir sind nun in den Park getreten. Er umzieht in weitem Halbkreise die linke Hälfte des Sees und geht am jenseitigen Ufer unmittelbar in die schönen Laubholzpartien des Boberow-Waldes über. Der Park ist eine glückliche Mischung von französischem und englischem Geschmack, zum Teil planvoll und absichtlich dadurch, daß man die Le Nôtreschen Anlagen durch Partien im entgegengesetzten Geschmack erweiterte, zum Teil aber planlos und unabsichtlich dadurch, daß sich das zwang- und kunstvoll Gemachte wieder in die Natur hineinwuchs. Die ursprüngliche Anlage soll das Werk eines Herrn von Reitzenstein gewesen sein, der schließlich (wie das zu geschehen pflegt) in verleumderischer Weise beschuldigt wurde, die Kriegsabwesenheit des Prinzen zu seinem Vorteil benutzt und unredlich gewirtschaftet zu haben. Als er von dieser gegen ihn umgehenden Verleumdung und beinahe gleichzeitig auch von der nahe bevorstehenden Rückkehr des Prinzen hörte, gab er sich den Tod, »indem er einen Diamanten verschluckte«. So das Volk. Es liegt auf der Hand, daß hier der nach dem Abenteuerlichen haschende Sinn desselben eine komische Substituierung geschaffen hat. Ein verschluckter Diamant ist um nichts schädlicher als ein verschluckter Pflaumenkern, und so glaub ich denn bis auf weiteres annehmen zu dürfen, daß sich von R. (wenn überhaupt) einfach durch Blausäure, durch essence d'amandes, getötet hat, aus welch letztrem Worte, lediglich nach dem Gleichklang, ein Diamant geworden ist.
Man passiert, abwechselnd dicht am See hin und mal wieder sich von ihm entfernend, die herkömmlichen Schaustücke solcher Parkanlage: Säulentempel, künstliche Ruinen, bemooste Steinbänke, Statuen (darunter einige von großer Schönheit), und gelangt endlich bis an den sogenannten Freundschaftstempel, der bereits am jenseitigen Ufer des Sees, im Boberow-Walde, gelegen ist. In diesem Freundschaftstempel pflegte der Prinz zu speisen, wenn das Wetter eine Fahrt über den See zuließ. Es war ein kleiner Kuppelbau, auf dessen Hauptkuppel noch ein Kuppelchen saß; über dem Eingang aber ein Frontispice. Frontispice und Kuppeln existieren nicht mehr; sie drohten mit Einsturz und wurden abgetragen. Aber das Innere des »Tempels« ist noch wohlerhalten und besteht aus einem einzigen achteckigen Zimmer, um das sich, wie die Schale um die Mandel, ein etwas größerer achteckiger Außenbau legt. Genauso, wie wenn man eine kleine Schachtel in eine größere stellt und beide mit einem gemeinschaftlichen Deckel überdeckt. In dem achteckigen Einsatz befinden sich vier türbreite Einschnitte (die Türen selber fehlen), und mit Hülfe dieser Einschnitte wird es möglich, die sechzehn Inschriften zu lesen, die seinerzeit der Innenwand des achteckigen Außenbaues, und zwar sehr wahrscheinlich vom Prinzen selber, gegeben wurden. Sie sind abwechselnd zwei und vier Zeilen lang und beziehen sich auf das Glück der Freundschaft. Ich zitiere zwei derselben:
Qui vit sans amitié, ne sauroit être heureux,
Quand il auroit pour lui la fortune et les Dieux.
oder
Pourquoi l'amour est-il donc le poison
Et l'amitié le charme de la vie?
C'est que l'amour est le fils de la folie
Et l'amitié fille de la raison.
So sind sie alle. Kleine Niedlichkeiten ohne tiefere Bedeutung, und doch an dieser Stelle ebenso ansprechend, wie sie als Grab- und Kircheninschriften uns widerstrebend sind.
Jetzt feiert die junge Welt ihr Möskefest hier, bei welcher Gelegenheit sicherlich alle philosophischen Betrachtungen über das Glück der Freundschaft unterbleiben und die sich »anbahnenden Verhältnisse« durchaus zugunsten des ewig im Schwunge bleibenden »fils de la folie« entschieden werden. Ein Möskefest an dieser Stelle bedeutet eine nicht üble Kritik und Ironie.
Vom Freundschaftstempel aus schreiten wir in den eigentlichen Park zurück, machen dem wohlerhaltenen »Theater im Grünen«, das lebendige Hecken statt der Coulissen hat, unsern Besuch und gelangen danach in allerhand schmale Gänge, deren Windungen uns schließlich bis an das Grabmal des Prinzen Heinrich führen. Es besteht aus einer Pyramide von Backstein, um die sich ein schlichtes Eisengitter zieht. Der Prinz, in seinem Testamente, hatte die völlige Vermauerung dieser Pyramide angeordnet; man ging aber von dieser Anordnung ab und ließ einen Eingang offen. Im Jahre 1853 sah ich noch deutlich den großen Zinksarg stehen, auf dem ein rostiger Helm lag. Seitdem ist ein brutaler Versuch gemacht worden, ebendiesen Sarg, in dem man Schätze vermutete, zu berauben, was nun, nachträglich noch, zur Erfüllung der Testamentsanordnung, will also sagen zur Vermauerung der Pyramide, geführt hat.
Wo früher der Eingang war, befindet sich jetzt eine große Steintafel mit der von Prinz Heinrich selbst verfaßten Grabschrift Sie lautet:
Jetté par sa naissance dans ce tourbillon de vaine fumée
Que le vulgaire appelle
Gloire et grandeur,
Mais dont le sage connoit le néant;
En proie à tous les maux de l'humanité;
Tourmenté par les passions des autres,
Agité par les siennes;
Souvent exposé à la calomnie;
En butte à l'injustice;
Et accablé même par la perte
De parens chéris,
D'amis sûrs et fidèles;
Mais aussi, souvent consolé par l'amitié;
Heureux dans le recueillement de ses pensées,
Plus heureux
Quand ses services purent être utiles à la patrie
Ou à l'humanité souffrante:
Tel est l'abrégé de la vie de
Frédéric-Henri-Louis,
Fils de Frédéric-Guillaume, roi de Prusse,
Et de Sophie-Dorothtée,
Fille de George I er, roi de la Grande-Bretagne.
Passant
Souviens-toi que la perfection n'est point sur la terre.
Si je n'ai pu être le meilleur des hommes,
Je ne suis point au nombre des méchans;
L'éloge ou le blâme
Ne touchent plus celui
Qui repose dans l'éternité;
Mais la douce espérance
Embellit les derniers moments
De celui qui remplit ses devoirs;
Elle m'accompagne en mourant.
Né le 18. Janvier 1726.
Décédé le 3. août 1802.
So dachte, so schrieb man damals. Die »naissance« war ein Spiel des Zufalls, und man war es müd, »über Sklaven zu herrschen«.
Aus dieser Welt der Freiheits phrase sind wir heraus, aber, Gott sei Dank, dem Wesen der Freiheit sind wir nähergekommen.
5. Der große Obelisk in Rheinsberg und seine Inschriften
Vielleicht die größte Sehenswürdigkeit Rheinsbergs ist der Obelisk, der sich, gegenüber dem Schlosse, am jenseitigen Seeufer auf einem zwischen dem Park und dem Boberow-Walde gelegenen Hügel erhebt. Er wurde zu Anfang der neunziger Jahre vom Prinzen Heinrich »dem Andenken seines Bruders August Wilhelm« errichtet und trägt an seiner Vorderfront das vortrefflich ausgeführte Reliefportrait ebendieses Prinzen und darunter die Worte:
A l'éternelle mémoire d'Auguste Guillaume,
Prince de Prusse, second fils du roi
Frédéric Guillaume.
Aber nicht dem Prinzen allein ist das Monument errichtet, vielmehr den preußischen Helden des Siebenjährigen Krieges überhaupt, allen jenen, die, wie eine zweite Inschrift ausspricht, »durch ihre Tapferkeit und Einsicht verdient haben, daß man sich ihrer auf immer erinnere«.
Da nun solcher preußischen Helden in jener Ruhmeszeit unzweifelhaft sehr viele waren, so lag es dem Prinzen ob, unter den vielen eine Wahl zu treffen. Diese Wahl geschah, und achtundzwanzig wurden schließlich der Ehre teilhaftig, ihre Namen auf dem Rheinsberger Obelisken genannt zu sehen. Jeder Name steht in einem Medaillon und ist von einer kurzen, in französischer Sprache abgefaßten Charakteristik begleitet. Nachstehend geb ich dieselben in Übersetzung.
Vorderfront
Marschall von Keith. Mit der größten Biederkeit vereinigte er die ausgebreitetsten und gründlichsten Kenntnisse. In Rußland, während des Krieges gegen die Türken, erwarb er sich einen wohlverdienten Ruhm, welchen er im preußischen Dienste bestätigte. Das Bedauern aller gefühlvollen Herzen, die Tränen aller Krieger verewigten auf immer sein Andenken. Er blieb bei dem Überfall zu Hochkirch, den 14. Oktober 1758.
Marschall von Schwerin. Die Ehre seines Jahrhunderts und der Schild des Vaterlandes. Er vereinigte alle bürgerlichen und kriegerischen Tugenden. Die Feinde, welche er bekämpfte, konnten ihm ihre Bewunderung nicht versagen. Am 10. April 1741 gewann er die Schlacht bei Mollwitz. Im Jahr 1744 befehligte er die Armee, welche Prag belagerte, und nahm die Festung Ziškaberg. Im Jahre 1756 war er an der Spitze der preußischen Armee, welche durch Schlesien in Böhmen eindrang. Und obgleich das feindliche Heer ihm überlegen war, führte er dennoch einen Angriffskrieg gegen die von Piccolomini befehligten Österreicher. Die Völker, gesichert durch seine Menschlichkeit, verehrten seinen Heldenmut. Die Fahne in der Hand, fiel er als Opfer seines Eifers bei Prag am 6. Mai 1757.
Leopold, regierender Fürst von Anhalt-Dessau, einer der vollkommensten Feldherren; er zeichnete sich im Spanischen Erbfolgekriege aus. Turin war Zeuge seiner Kriegstaten. Er kämpfte dort an der Spitze der Preußen, welche er auch im Kriege 1742 in Oberschlesien anführte. Im Jahre 1745 schlug er die Sachsen bei Kesselsdorf und bahnte sich den Weg nach Dresden. Sein militärisches Genie und sein Mut werden ihn auf immer unsterblich machen.
August Ferdinand, vierter Sohn des Königs Friedrich Wilhelm, war 1757 bei der Einschließung von Prag und wurde bei einem Ausfall der Feinde verwundet. In der Schlacht bei Breslau, den 22. November desselben Jahres, behauptete er bis zu Ende der Schlacht einen wichtigen Posten. In der Schlacht bei Leuthen erwarb er sich neue Lorbeern. Ebenso schätzbar durch seine Tugenden als durch seine Taten.
General von Seydlitz zeichnete sich aus von Jugend auf. Er war bei allen Feldzügen des Siebenjährigen Krieges zugegen, und stets mit Ehre und Ruhm. Durch Geschicklichkeit, Unerschrockenheit, vereinigt mit Schnelligkeit und Geistesgegenwart, wurden alle seine Kriegstaten den Feinden verderblich. Lobositz, Kolin, Hoßbach, Hochkirch, Zorndorf, Kunersdorf und Freiberg sind ihm Denkmäler des Sieges. Oft wurde er gefährlich verwundet. Die preußische Reiterei verdankt ihm den Grad der Vollkommenheit, welchen der Fremde bewundert. Dieser seltene Mann, alle Gefahren überlebend, verschied im Arme des Friedens.
General von Zieten erreichte ein ebenso glückliches als ehrenvolles Alter. Er siegte in jedem Gefechte. Sein kriegerischer Scharfblick, vereinigt mit einer heroischen Tapferkeit, sicherten ihm den glücklichen Ausgang jeden Kampfes. Aber was ihn über alles erhob, waren seine Redlichkeit, seine Uneigennützigkeit und seine Verachtung aller derer, welche auf Kosten der unterdrückten Völker sich bereicherten.
Der Herzog von Bevern. Er entschied 1756 den Sieg bei Lobositz. Im Jahre 1757 drang er aus Schlesien in Böhmen ein, und seine weisen Maßregeln verschafften ihm bei Reichenberg den Sieg über die Österreicher. In demselben Jahre widerstand er mit 22 000 Mann der Daunschen Armee, welche 80 000 Mann stark war, und nur nach der mutigsten Gegenwehr unterlag er bei Breslau. 1762 mit einem Corps bei Reichenbach aufgestellt, wurde er in Front und Rücken durch überlegene Macht angegriffen. Er schlug sie zurück und behauptete das Schlachtfeld.
General von Platen. Er diente mit Auszeichnung in allen Kriegen und war bei vielen Schlachten zugegen. Nach der Niederlage bei Kunersdorf sammelte er die zerstreuten Heereshaufen, deckte den Rückzug, blieb während der Nacht auf seinem Posten und ging erst am andern Morgen über die Oder zurück. Im Jahr 1762 wurde er mit einem Corps von dem König abgesendet; er schlug bei Posen 6000 Russen, machte viele Gefangene und vernichtete ihre Magazine. Er starb 1787.
Rechtsfront
Oberstlieutenant von Wedell. Mit einem Bataillon Grenadiere, aus zwei Compagnien der Garde und zwei vom Regiment Kronprinz zusammengesetzt, verteidigte er bei Selmitz in Böhmen mehrere Stunden lang, gegen die ganze österreichische Armee, den Übergang über die Elbe. So verschaffte er dem preußischen Heere die nötige Zeit, seine Quartiere zu erreichen. Nach fünf Stunden nötigten ihn die zahlreichen Batterien der Feinde zum Rückzuge. Als Prinz Karl über den Fluß gegangen war, in der Meinung, ein zahlreiches Heer bekämpft zu haben, erfuhr er durch einen Gefangenen, daß ein einziges Bataillon, aber von einem Helden angeführt, diese schöne Verteidigung gemacht habe. Mit demselben Bataillon griff er in der Schlacht bei Soor, am 30. September 1745, den linken Flügel der Österreicher an und endigte hier sein Heldenleben.
Generallieutenant von Hülsen. Sehr geschätzt durch seine militärischen Talente. Fast in allen Schlachten war er zugegen, oft verwundet und durch seine Unerschrockenheit stets ausgezeichnet. Im Jahre 1760 in der Schlacht bei Torgau wurde der linke Flügel, bei welchem er sich befand, zurückgetrieben. Er sammelte einige Flüchtlinge. Da aber seine Pferde getötet waren und sein Alter und seine Wunden ihm nicht erlaubten, zu Fuß sein Corps anzuführen, so setzte er sich auf eine Kanone und gelangte so, mitten im feindlichen Feuer, zum rechten Flügel.
von Tauentzien, General der Infanterie. In allen Feldzügen zugegen; seine Wunden sind rühmliche Denkmäler seines Mutes. 1760 verteidigte er Breslau gegen Laudon. Er befehligte 1762 die Belagerung von Schweidnitz und erfreut sich gegenwärtig eines ehrenvollen Alters.
von Möllendorf, General der Infanterie, war bei allen Feldzügen von 1740 bis 1778. Bei Torgau, 1760, bemächtigte er sich der Anhöhen von Siptitz und entriß dadurch dem Feinde den Sieg. Im Jahre 1762, als er auf gleiche Art die Anhöhen von Burkersdorf gewonnen hatte, nötigte dies den Marschall Daun, seine Stellung zu verändern, welches die Belagerung von Schweidnitz erleichterte. Im Winter von 1778 bis 1779 befehligte er bei der in Sachsen stehenden Armee ein besonderes Corps und schlug den Feind bei Brixen.
Generallieutenant von Haucharmoi. Aus Frankreich herstammend. Er war während des Spanischen Erbfolgekrieges in Italien und Flandern bei dem preußischen Heere zugegen. Im Kriege 1740 zeigte er sich wie ein zweiter Bayard, ohne Furcht und ohne Tadel. In der Schlacht bei Prag, den 6. Mai 1757, starb er auf dem Bette der Ehren.
General von Retzow, Intendant der Armee. 1758 befehligte er ein von der Armee des Königs getrenntes Corps. Er war bei Weißenberg gelagert, wo der rechte Flügel der Daunschen Armee ihm gegenüberstand. Am Tage des unglücklichen Überfalls bei Hochkirch, den 14. Oktober 1758, besetzte er eine Anhöhe hinter der Armee des Königs, und wurde so durch seine Klugheit und Tapferkeit der Rückzug gedeckt. Er starb einen Monat darauf, als er seinem Vaterlande einen so wichtigen Dienst geleistet hatte.
Oberst von Wobersnow, Erster Adjutant des Königs. Er zeichnete sich aus durch lebhaftes Ehrgefühl und große militärische Kenntnisse. 1757 in der Schlacht bei Prag, als er den preußischen linken Flügel sammelte, um solchen aufs neue gegen den Feind zu führen, wurde er verwundet. Er war bei allen Feldzügen gegen die Russen. Die Schlacht bei Kay wurde wider seinen Willen geliefert; die Preußen verloren sie, und er fiel als Held.
Linksfront
von Wunsch, General der Infanterie. Er trat in Dienst 1756 als Offizier bei einem Freicorps und erhob sich zu höheren Graden durch sein Genie und seine militärischen Talente. Im Kleinen Krieg waren alle seine Unternehmungen glücklich und erwarben ihm allgemeine Achtung. 1759 schlug er mit einem kleinen Corps bei Torgau die weit überlegenen Feinde. Im nämlichen Jahre, nahe bei Düben, schlug er das Vordertreffen der Feinde. Ein gefangener General, Fahnen und Kanonen waren die Denkmäler seines Sieges. Er starb 1788.
von Saldern, Generallieutenant. In allen Feldzügen zugegen. In taktischen Kenntnissen hochberühmt. Gleichermaßen geschätzt wegen seiner Tapferkeit und seiner Biederkeit. Er zeichnete sich aus bei der Torgauer Schlacht. Starb im Jahre 1785.
von Prittwitz, General der Kavallerie. Er diente sowohl unter den Dragonern als Husaren und zeichnete sich aus durch seine Tapferkeit in mehreren Schlachten, wo er zugegen war. Dieses erwarb ihm die besondere Achtung des Königs, der ihm das Regiment Gensdarmes erteilte, das er noch jetzt befehligt und sich immer schätzbarer macht durch seinen Eifer und seine Tätigkeit.
von Kleist, General der Husaren. Erwarb sich im Siebenjährigen Kriege hohen Ruhm. Geschickt in allen Gewandtheiten des Kleinen Krieges, war er auch zu großen Unternehmungen sehr geeignet, deren Erfolg seine Talente dem Feinde furchtbar machten. Stets geliebt von den Truppen, die er befehligte, machte er durch seine Taten seinen Namen unsterblich. Im sechsunddreißigsten Jahre seines Alters, 1767, endigte er seine Laufbahn.
von Dieskau, Generallieutenant der Artillerie, diente von Jugend auf und erwarb sich die höchste Achtung seines Corps, welches er während des Siebenjährigen Krieges als Chef befehligte. Er war tätig, wachsam, arbeitsam. Bei allen Belagerungen zugegen. Auch in den Schlachten, bei welchen er war, leistete er wichtige Dienste. Er starb in einem hohen Alter.
von Ingersleben, Generalmajor. Von einer geprüften Tapferkeit hat er die stärksten Beweise gegeben. In der Schlacht bei Prag, 1757, wurde er mit Wunden bedeckt, deren indes keine tödlich war. In demselben Jahre aber verlor er sein Leben in der Schlacht bei Breslau, am 22. November, wo er als Held focht.
von Henckel, Generallieutenant. Graf von Henckel, Adjutant des Prinzen Heinrich von Preußen während der Feldzüge von 1757 und 1758, zeichnete sich aus in den Schlachten bei Prag und Roßbach. Im Winter 1757 und 1758 unterstützte er den General von Tauentzien beim Überfall von Horneburg. In der Schlacht bei Torgau, im Jahre 1760, an der Spitze des Regiments Prinz von Preußen, gab er neue Beweise seiner Tapferkeit.
Rückfront
von Goltz, Adjutant des Königs. Er wurde 1756 nach Preußen gesendet, um den Marschall Lehwald, welcher die Armee gegen die Russen befehligte, mit seinem Rat zu unterstützen. Ein umfassender, tiefblickender Geist, mit militärischen Kenntnissen vereint, würde seinen Namen verherrlicht haben, wenn sein alle Gefahren verachtender Mut in der Schlacht bei Jägerndorf ihn nicht dem Vaterland entrissen hätte.
von Blumenthal, Major im Regiment Prinz Heinrich. Sein heller Geist, sein rechtliches Gemüt führten ihn Hand in Hand der Vollkommenheit entgegen, als er bei Verteidigung eines Postens bei Ostritz in der Lausitz getötet wurde, am 31. September 1756.
von Reder, Chef eines Kavallerieregiments. Als Kommandeur des Kürassierregiments Schmettau durchbrach er die österreichische Infanterie und nahm ein ganzes Regiment gefangen. Am 29. Oktober 1762, in der Schlacht bei Freiberg in Sachsen, erwarb er sich neuen Ruhm.
von Marwitz, Quartiermeister bei der Armee des Königs. Erwarb sich große Verdienste in allen Kriegen, war bei allen Schlachten zugegen und zeichnete sich aus bei mehreren Vorfällen. Er starb 1759 im sechsunddreißigsten Jahre seines Alters. Vielleicht wären sein Wert und seine Verdienste vergessen, wenn dieses Denkmal sein Andenken nicht aufbewahrte.
Dequede, Adjutant beim Prinzen von Preußen, Bruder des Königs, Major im Regiment Prinz Heinrich. Seine richtige Urteilskraft, sein fester Charakter, seine Unerschrockenheit ließen wünschen, er möchte auf lange Zeit dem Staate nützlich werden. Aber 1757, in der Schlacht bei Prag, wurden ihm durch eine Kanonenkugel beide Füße weggeschossen. Er lebte noch einige Stunden, und unter den heftigsten Schmerzen verleugnete sich sein Heldenmut nicht, bis zum letzten Hauch.
von Platen, Adjutant des Marschalls von Schwerin. Er vereinigte alle Eigenschaften, welche Hoffnung gaben, er würde diesen großen Mann ersetzen. Er fiel ihm zur Seite am 6. Mai 1757.
So die Namen der achtundzwanzig, die die Wahl des Prinzen traf, eine Wahl, hinsichtlich deren dieser selbst empfand, daß sie parteiisch getroffen sei. Weshalb er auch der schon vorzitierten, von den »preußischen Helden« sprechenden Widmung noch folgende Zeilen hinzufügte:
Leurs noms gravés sur le marbre
Par les mains de l'amitié,
Sont le choix d'une estime particulière
Qui ne porte aucun préjudice
A tout ceux qui comme eux
Ont bien merité de la patrie
Et participent à l'estime publique.
Kein Präjudiz also gegen alle diejenigen, die außerdem noch an der »estime publique« teilgenommen haben. Diese Worte rücksichtsvoller Verwahrung sind ganz im Geiste des Prinzen Heinrich gesprochen. Er gibt seine Meinung und gibt sie zum Teil (diplomatisch genug) ausschließlich dadurch, daß er schweigt, aber selbst dies Schweigen erscheint ihm noch wieder zu verletzend, und er fügt ein milderndes »Ohne Präjudiz« hinzu. Dies bezieht sich auf das Fehlen besonders dreier Namen: von Winterfeldt, von Fouqué und von Wedell. Auf der einen Seitenfront befindet sich zwar ein »Wedell«, doch ist dies ein älterer General desselben Namens, der schon 1745 bei Soor fiel, nicht der Wedell, der als Liebling und Vertrauensmann des Königs abgeschickt wurde, um gegen die anrückenden Russen den Grafen Dohna im Kommando zu ersetzen, und der tags darauf, trotz all seiner Tapferkeit, bei Kay geschlagen wurde. Dieser fehlt, wie vor allem, um es zu wiederholen, Winterfeldt fehlt, wogegen alle diejenigen, die bei der einen oder anderen Gelegenheit von der Ungnade des Königs betroffen wurden, ziemlich sicher sein dürfen, an diesem Obelisken ihr Konto in Balance gebracht zu sehen. So der Herzog von Bevern, von der Marwitz, Oberst von Wobersnow, Prinz August Wilhelm selbst. Eine jede dieser Medailloninschriften ist von Bedeutung und kann uns, solange der »kritische Kommentar«, den der frondierende Prinz zu dem großen Geschichtsbuche seines Bruders geschrieben haben soll, ein Geheimnis bleibt, als Fingerzeig und kurzer Abriß dessen gelten, was in jenem »Kommentar« an Ansichten niedergelegt wurde.
Der Obelisk richtet sich in seiner Kritik in erster Reihe gegen den König, aber an manchen Stellen, und zwar gleichzeitig ausgesprochener Anerkennung unerachtet, doch auch gegen den einen oder andere der berühmtesten Generale. So scheint ihm beispielsweise der schon damals im Volke lebende Glaube, daß »Schwerin mit der Fahne« die Prager Schlacht entschieden habe, vielleicht im Gefühl dessen, was er selbst geleistet hatte, nicht angenehm gewesen zu sein, weshalb er, nachdem er die früheren Taten Schwerins mit großer Wärme des Ausdrucks aufgezählt hat, in ziemlich nüchterner Weise schließt: »Un drapeau à la main il fut la victime de son zèle devant Prague le 6 de mai 1757.« Er rühmt nur den »Eifer«, weiter nichts.
Die schönsten Worte richten sich unzweifelhaft an Zieten, weshalb ich nicht umhin kann, sie hier noch einmal, und zwar in ihrer originalen Fassung, zu wiederholen:
Toutes les fois qu'il combattit, il triompha.
Son coup d'œl militaire joint
A sa valeur héroïque
Decidoit su succès des combats;
Mais ce qui le distinguait encore plus
Ce furent son intégrité, son desintéressement
Et son mépris pour tous ceux
Qui s'enrichissaient aux dépens
Des peuples opprimés.
Innigkeit und wahre Verehrung spricht aus jeder Zeile. Der alte Husar ist auch hier Sieger geblieben.