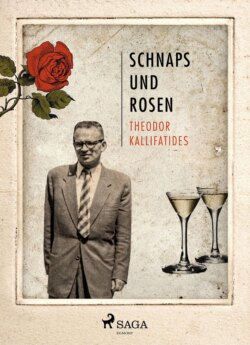Читать книгу Schnaps und Rosen - Theodor Kallifatides - Страница 6
2
ОглавлениеIch habe den Sinn meiner Mutter für Details geerbt, aber habe ich auch ihre Warmherzigkeit geerbt?
Das wußte ich nicht. Manchmal erlebte ich meine Erinnerung als eine Art unabhängige Perversität, eine Art dritter Arm, mit dem ich zupacken, aber nicht streicheln konnte.
Nach dem Telefongespräch mit meinem Bruder setzte ich mich zu meiner Ehefrau Bella. Sie legte Vittorios Fußballdress zur Seite und nahm theatralisch meinen Kopf in ihre Hände.
«Warum fährst du nicht morgen?»
«Ich muß mich ja mit dem Steuerprüfer treffen!»
«Er kann warten...»
«Er schon, aber ich nicht. Das kann mich zwischen 30 und 40 000 kosten. Er wartet nur auf eine Gelegenheit, mich zu schätzen.»
«Woher weißt du das?»
«Nach den Briefen zu urteilen, ist sie scharf auf eine Schätzung.»
«Ach so», sagte Bella. «Es ist eine Sie!»
«Weiß ich nicht sicher. Ihr Name kann sowohl männlich wie weiblich sein. Sie heißt Inge Tamej. Sie scheint mit einem Ausländer verheiratet zu sein...»
«Oder ist von einem geschieden!»
«Genau!»
«Du weißt nicht das Alter?»
«Über neunzig...»
«Ich meine die Steuerprüferin.»
«Woher soll ich das wissen?»
«Ich dachte nur, ob...»
«Was ist los? Glaubst du, ich will dich mit einer Steuerprüferin betrügen?»
«Nein! So weit gehst du nicht, nehme ich an!» lachte Bella hart. Ich war mir nicht so sicher, wie weit ich gerade hier gehen würde. Ich küßte Bellas Ohrläppchen, das die merkwürdige Eigenschaft besaß, sich zusammenzurollen und in die Ohrmuschel zu drücken, und ich biß in die Ohrringe, die ich ihr vor einigen Jahren zu Weihnachten geschenkt habe.
Ich dachte daran, welche Intimität wir uns durch Dinge schaffen, das sind die Intimitäten und die gemeinsamen Erfahrungen der neuen Zeit: «Weißt du noch, wann wir dies oder das gekauft haben?»
Die Intimität meines Vaters und meiner Mutter war anderer Art. Wann hatte Vater im Gefängnis gesessen, oder wann ist der jüngste Sohn allein in das Krankenhaus gegangen, um sich die Mandeln herausnehmen zu lassen, die aussahen wie gebrannte Kastanien. Daran erinnerten sich die Menschen, und ihre Intimität bezog sich nicht auf Dinge, sondern auf ihr Zusammensein.
Ich küßte meine Frau noch einmal und verwarf den Gedanken. Gleichzeitig versetzte mir Bella einen scherzhaft gemeinten Rippenstoß:
«Dein Vater liegt im Sterben, und du hast nur schlechte Gedanken!» kokettierte sie.
Ich antwortete nicht. Mein Vater lag nicht im Sterben, mein Vater war unsterblich. Mir fiel nur ein, daß auch wir andere gemeinsame Erfahrungen hatten. Ich habe gesehen, wie sich ihr Schoß wie eine fleischfressende Pflanze öffnete, aber nicht, um Leben zu nehmen, sondern um es zu geben.
Ich küßte Bella erneut, und ich kroch mit den Lippen über ihren Nacken – ich wußte, daß sie da nicht widerstehen kann –, da läutete wieder das Telefon. Diesmal war es eine Journalistin der Zeitung Expressen, die zu dieser relativ späten Stunde wissen wollte, was ich zur Situation der modernen Frau meinte.
Auf meine Frage, warum gerade ich irgend etwas zu diesem heiklen Problem meinen sollte, antwortete sie, daß man von einem Literaturpreisträger erwarte, über alles eine Meinung zu haben.
Diese Antwort, vorgebracht von einer intelligenten und zugleich einschmeichelnden Stimme, gefiel mir, und ich erklärte mich bereit, die Frage am nächsten Tag nach elf Uhr umfassend in meinem Arbeitszimmer zu beantworten.
«Aber ich brauche die Antwort heute!»
«Heute können Sie überhaupt keine Antworten bekommen! Ich bin völlig damit beschäftigt, meine Frau zu verführen», flüsterte ich in ihr Ohr. Die Journalistin lachte und gab nach. Sie würde sich dann morgen wieder melden.
Währenddessen hatte Bella meine Küsse mit einer Kopfbewegung abgeschüttelt und war in das eheliche Schlafgemach gegangen, das in den letzten Jahren mehr und mehr zum Übernachtungsraum geworden war. Ich stellte mir vor, wie sie sich entkleidete, wie sie den Bademantel überzog und mit geheimnisvoller Miene im Bad verschwand. Ich wußte, daß sie im Bett liegend auf mich warten würde, den neuesten feministischen Roman vor der Nase.
Ihre «Entpuppung» dauerte bereits einige Zeit an. Ich war einst verliebt in ein zwanzigjähriges Mädchen, das durch seine schüchterne Lebensfreude daran gehindert wurde, mit dem Studium zurechtzukommen, das sich aber nach zehn Jahren ehelichen Zusammenlebens in eine äußerst effektive Chefsekretärin in irgendeiner staatlichen Institution verwandelt hatte.
Inzwischen hatten wir uns ein Kind zugelegt, den dunkelhaarigen, dunkeläugigen und ziemlich hysterischen Sohn. Er ist während eines Besuches bei ihren Verwandten in der neureichen Stadt nördlich von Mailand entstanden. Dort hatten italienische Mafiosi einen von Polizisten unberührten Zufluchtsort, wo sie sich ungestört damit beschäftigen konnten, ihre Kinder und Kindeskinder zu verheiraten und zu Gott zu beten.
Eines Nachmittags machten Bella und ich einen Spaziergang – ich brauchte nach so vielen frommen Gangstern um mich herum frische Luft –, und wir gingen hinauf in die Berge in ein Dorf mit dem seltsamen Namen Latona. Wir waren kaum angekommen, als ein gewaltiges alpines Unwetter einsetzte. Der Wind pfiff, Schneeflocken wirbelten um uns, und Bellas kunstvolle Frisur ging zum Teufel. Wir waren gezwungen, in Latona in einem elenden, kalten Hotel zu übernachten. Es war so kalt im Zimmer, daß wir die ganze Nacht nicht schlafen konnten, und wenn man außerdem frisch verheiratet ist und einen vortrefflichen französischen Cognac neben dem Bett stehen hat, dann dürfte klar sein, was wir alles angestellt haben, um uns warm zu halten.
Neun Monate später wurde Bella im Danderyds-Krankenhaus von unserem Vittorio entbunden. Vittorio scheint seine Anlagen weder von mir noch von Bella geerbt zu haben, sondern eher von dem alpinen Sturm, in dessen Winden er konzipiert wurde, und vom ersten Augenblick an konnte er mich nicht leiden.
Ich war natürlich dabei, als er an das Licht der Welt gezogen wurde, und sein markerschütternder Schrei war so fürchterlich, daß ich die ganze Zeit Bella ansehen mußte, die mit rotem Gesicht und Schweiß auf der Stirn auf dem Entbindungstisch lag, um mir zu versichern, daß das, was sie gebar, ein Kind war.
Später, als Vittorio auf Bellas Brust lag und zufrieden schnorchelte, brüllte er jedesmal, wenn ich in seine Nähe kam. Bella zwang ihren Sohn, mich anzusehen, aber der dunkle, wäßrige Blick des Kindes verfluchte mich ein für allemal. Er brüllte noch mehr und beruhigte sich erst, als ich den Raum verlassen hatte.
Meine Schwiegermutter, die fromme Gangsterfrau Sofia Monarka, bekreuzigte sich und murmelte unzusammenhängende Tiraden auf Latein. Doch mein Schwiegervater Cosimo M. Monarka, der sich noch nicht in das Zimmer gewagt hatte und auf dem Flur in der alten Männern typischen Art mit den jungen finnischen Hilfsschwestern flirtete, tröstete mich.
«Alle gesunden Söhne hassen ihre Väter!» erklärte er mir und betrachtete kritisch einen schwesterlichen Hintern, der auf klappernden Holzschuhen vorbeiging. Und dann fuhr er fort:
«Als Vittorio Emanuele Kronprinz war, versäumte er es nie, seinen Vater, den König, anzupinkeln, wenn er auf seinem Schoß saß. Oh, ich weiß es noch, als sei es gestern gewesen, es stand in allen Zeitungen!»
Und er würde tagelang seine Königsgeschichten fortspinnen – sein Entsetzen vor dem Zimmer mit den Frauen war größer als der Wunsch, seinen Enkel zu sehen –, wenn nicht meine Schwiegermutter, eine hochgewachsene, norditalienische Gräfin, die ihren Mann so mitleidig, ach so mitleidig verachtete, daß ihm Tränen in die Augen stiegen, wenn er daran dachte, herausgekommen wäre und ihn an das Lager der Tochter, die in ihrem Bett thronte und vor Glück heulte, gezogen hätte. Ich kenne niemanden, weder unter den Lebenden noch unter den Toten, der eine solche Vorliebe für heruntergekommene Adelige und königliche Hoheiten im Exil hat wie mein Schwiegervater. Er verließ Italien, als Mussolini die Macht übernahm, nicht aus Protest gegen den Faschismus – Faschist war er von Geburt, durch die Erziehung und aus alter Gewohnheit –, sondern deshalb, weil Mussolini sich seines Vittorio Emanuele entledigt hatte.
Cosimo M. Monarka irrte quer durch Europa auf der Suche nach dem Land, wo ihn die Behörden am wenigsten verfolgten, das war die eine Bedingung, die andere war, einen sicher auf seinem Thron sitzenden König zu finden. Den gab es nur in Norwegen und Schweden, und er entschied sich für Schweden, dessen König Archäologe war und in Italien Ausgrabungen machte.
Cosimo M. Monarka hatte genug Geld. Er begann seine Laufbahn in dem schmutzigen süditalienischen Dorf San Domenico unter seinem richtigen Namen Cosimo Vighliaco, und mit dreißig Jahren war er Bankier in Mailand und frisch verheiratet mit der verarmten Gräfin Sofia Medici, die in einem Schloß wohnte und tagaus, tagein Spaghetti aß.
Niemand wußte, wie ihm das so schnell geglückt war, alle sprachen sie von seinen Verbindungen zur Mafia, aber keiner wußte oder sagte Genaueres. Von sich aus erzählte er niemandem etwas, am wenigsten seiner Ehefrau, aber ich habe ab und zu beobachtet, wie junge, dunkelhaarige Männer sein unscheinbares Büro in Gamla Stan (Altstadt von Stockholm) aufsuchten, wo er Antiquitäten per Post verkaufte. Alle küßten ihm die Hand und nannten ihn «nonno».
Ich redete ihn mit seinem Vornamen Cosimo an, obwohl er gerne von mir als «Papa» tituliert worden wäre. Doch er ertrug meine Unart, das einzige, was er nicht vertragen konnte, war, wenn ich Fragen stellte nach dem mystischen Buchstaben zwischen dem Vor- und dem Nachnamen. Er nannte sich ja Cosimo M. Monarka.
Einmal fragte ich seine Tochter, also meine Frau Bella, was dieses «M» bedeuten solle. Es stand für Medici, dem Namen der Gräfin, und mein Mafioso von Schwiegervater strebte nach dem adeligen Namen, aber so weit zu gehen, den Namen seiner Frau anzunehmen, wagte er nicht.
Dabei bestand eine verblüffende Ähnlichkeit zu Cosimo Medici, dem großen florentinischen Bankier und Mäzen, der Henrik Tikkanen zufolge «die Schönheit überall außer im Spiegel» sehen konnte. Mein Schwiegervater war ganz einfach ungewöhnlich häßlich. Sein Gesicht war rund wie eine Wassermelone, die Augen waren schmutziggrau, klein und so eng beieinander, wie bei einem Schwein; die Augenbrauen waren breit und buschig, und mitten in dem Ganzen thronte die Nase wie ein Felsvorsprung, zu dessen Füßen sich zwei tiefe, dunkle Höhlen auftaten: die Nasenlöcher, voller weißgrauer Haarbüschel, die sich bewegten, wenn er den Rauch seiner stinkenden Zigarren ausblies.
Der Oberkörper war lang und kräftig, doch die Beine waren kurz und krumm. Wenn er ging, erinnerte er an die Broadwaymaschinen, mit denen man die Trottoirs sauberhält. Aber seine Anzüge waren maßgeschneidert in Florenz, seine Schuhe entweder Murati oder Bally, und seine Hemden kamen in Dutzendpackungen von Madame Rinaldi aus Ravenna. Nur Seide durfte die Teile seines Körpers berühren, die nicht von dem ewigen Wollunterhemd bedeckt waren, eine Angewohnheit aus den kalten sardischen Nächten, als er nicht nur einmal unter freiem Himmel übernachtete.
«Wer ein Bauerntölpel ist, bleibt einer!» gackerte er, wenn seine Frau oder seine Tochter versuchten, ihm das Unterhemd abzugewöhnen. Aber mir pflegte er Lektionen zu erteilen in der Kunst, sich elegant zu kleiden.
«Ein Hemd muß so lang sein, daß man es unter den Arsch schieben kann!» schrie er am Mittagstisch. Er verabscheute kurze Hemden, weite Jacken und enge Hosen.
«Ein Sakko darf nicht wie eine Trainingsjacke aussehen!» stellte er fest und, «enge Hosen sind für Schwule», und er zwang mich, ständig teurere Kleidung zu kaufen.
Seine Methode war ebenso einfach wie wirksam. Er kippte ganz einfach Tinte oder Ketchup auf die Anzüge, die sein Mißfallen erregten. Dann lachte er und entschuldigte sich mit einem Augenzwinkern.
Seine Tochter drohte, ihn von den gemeinsamen Sonntagsessen der Familie auszuschließen, aber der alte Mafioso wußte es besser. Wir lebten gut dank seines Geldes, und durch das Geld regierte er über seine Familie wie ein russischer Großfürst über seine leibeigenen Bauern. Vittorio, unser Sohn und Cosimos Enkel, verehrte ihn, und was Vittorio haben wollte, bekam er, sowohl von seiner Mutter wie von mir. Aber il pappo gegenüber benahm er sich wie ein Engel. Umgekehrt war der alte Cosimo sehr angetan von seinem Tochtersohn, und er wiegelte ihn heimlich auf gegen uns, seine wankelmütigen Eltern.
Cosimo und Vittorio waren sich in vielen Punkten einig, besonders aber in einem: Vittorio wollte Geschwister und Cosimo mehr Enkel.
«Ein Kind ist kein Kind», polterte Cosimo. Seine Frau Sofia sagte nichts, sie hatte es auch nicht besser gemacht.
«Dann bin ich wohl kein Kind?» beschwerte sich Bella.
«Du bist sogar nur ein Mädchen!» antwortete Cosimo ungerührt, und Bella wurde wütend.
Vittorio hatte sich frühzeitig gemerkt, wo seine Mutter ihre Pille versteckt hatte und ich meine Präservative. Einmal ertappte ich ihn auf frischer Tat, als er mit einem Hammer auf dem harten Boden im Bad Antibabypillen zerschlug und dabei ergrimmt flüsterte:
«Verfluchte Mörder! Verfluchte Mörder!»
Obwohl es eigentlich überflüssig war, fragte ich ihn, was er treibe, und er zögerte nicht mit der Antwort. Mit triumphierendem Lachen und blitzenden Augen rief er:
«Ich will einen kleinen Bruder haben!»
«Und was glaubst du, was wir sind? Eine Gebärfabrik?» Ich mußte mich offensichtlich jedesmal mit Vittorio streiten.
«Il pappo hat gesagt, daß ihr soviel Kinder bekommen könnt, wie ihr wollt!»
«Alles, was il pappo sagt, ist nicht wahr! Es fragt sich, ob jemals etwas wahr ist! Und außerdem hat er selber nur ein Kind. Hat er dir gesagt, daß du diese Pillen hier zertrümmern sollst?»
«Ja natürlich!»
«Ach so... Weißt du, was das für Pillen sind?»
«Glaubst du, ich bin blöde? Ich habe im Fernsehen gesehen, was es für Pillen sind!»
«Auch das noch!» entfuhr es mir. Da hatten wir neben Cosimo auch noch das Fernsehen gegen uns.
«Jedenfalls hörst du jetzt auf, hier auf dem Boden herumzuhämmern. Hast du übrigens das kleine Päckchen, das in der Schublade meines Nachttisches lag, weggeworfen?»
«Meinst du diese widerlichen Präservative?» fragte Vittorio herausfordernd.
«Ja!» sagte ich, schon nicht mehr wütend.
«Nein! Das war il pappo!»
Der große Vorteil an einem Sohn, der einen haßt, besteht darin, daß man von ihm immer die Wahrheit erfährt.
Am selben Abend ging ich in Cosimos Büro in Gamla Stan. Ich fand ihn zwischen seinen fiktiven Waren, fiktiv deshalb, weil er praktisch nie eine der ausgestellten Gegenstände verkaufte, und er wußte sofort, was mein Anliegen war. Mein Vittorio hatte ihn natürlich angerufen.
Wir hatten eine heftige Diskussion. Das heißt, ich war heftig, Cosimo verzog keine Miene. Geduldig hörte er sich alle meine Vorwürfe an, paffte seine «Romeo und Julia», eine Zigarre, die nicht mehr nach Schweden importiert wird, die er sich aber immer irgendwo besorgt, und als ich fertig war und etwas außer Atem, erhob er sich aus seinem Stuhl, ging drei Schritte in meine Richtung, und im Abstand von zwanzig Zentimetern vor meinem Gesicht detonierte ein gewaltiger Lippenfurz.
«Ist das alles, was du mir zu sagen hast?» fragte ich angewidert.
«Ja!» antwortete er und setzte sich wieder.