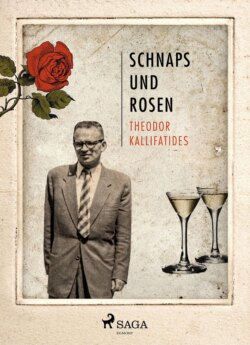Читать книгу Schnaps und Rosen - Theodor Kallifatides - Страница 8
4
ОглавлениеAm nächsten Tag kam ich mehr als eine halbe Stunde zu spät an meinen Arbeitsplatz in der Werbeagentur «Idee und Bild». Der Pendlerzug hatte wieder zugeschlagen. Zuerst blieb der Zug um 7.53 aus. Danach hörte man ein Lautsprechergesäusel, das wir mit gespannter Aufmerksamkeit zu entschlüsseln versuchten.
«Das wird unser Rätsel des Tages!» murmelte mein allmorgentlicher Reisebegleiter, ein anderer Grieche, der im Norden von Stockholm einen kleinen Betrieb hatte.
Wir trafen uns fast jeden Tag am Zug. Einer Frau, die in der Nähe stand, war es jedoch geglückt, die Ansage zu verstehen. Der Zug 8.04 war ausgefallen, der Zug 7.53 würde nie kommen, und der Zug 8.23 hatte fünf Minuten Verspätung.
Neue Busladungen von Menschen drängten sich in das kleine Bahnhofsgebäude, das aussah wie ein altes und nicht mehr brauchbares Sommerhaus. Wir hatten da drinnen keinen Platz mehr. Mein mitreisender Grieche und ich begaben uns hinaus in den kalten Wind. Es hatte aufgehört zu schneien.
«Neuigkeiten von zu Hause?» fragte er.
«Nichts Besonderes...»
Ich wollte eigentlich von dem nächtlichen Telefonanruf meines Bruders erzählen, ließ es aber bleiben.
«Und bei dir?» fragte ich.
Er rieb sich die Stirn, als müsse er nachdenken, und nach einer Weile antwortete er mit etwas heiserer Stimme:
«Alles wie es sein soll!»
Es entstand eine kurze Pause. Wir stampften auf den Boden, um die Füße warm zu halten, und dann schien mein Landsmann genug geschwiegen zu haben. Er stellte die unter uns verheirateten Griechen übliche Standardfrage. Er war mit einer Griechin verheiratet, und seine Kinder sprachen fließend griechisch, während mein Vittorio nicht mehr konnte als ein paar Flüche.
«Vögelst du irgendwo gastweise?» Damit ist gemeint, ob man sich neben der Ehe noch extra betätigte. Jeder anständig verheiratete Grieche mußte auf diese Frage mit einem geheimnisvollen Lachen antworten, begleitet von einem:
«So gut es geht!»
«Und du?»
«Ebenfalls!»
Natürlich logen wir beide.
Aber es war ein souveränes Gefühl, hier mitten unter Dutzenden von Schweden zu stehen und über unanständige Dinge zu reden, so als würden wir die innenpolitische Lage erörtern. Ich überlegte, was diese konspiratorische Verwendung der Sprache für eine Auswirkung hatte auf unser Verhältnis zur Sprache und, weitergehend, auf unser tiefstes «Ich».
Eine Geheimsprache ist eine Geheimwaffe. Menschen, die eine Geheimwaffe besitzen, wie werden sie davon beeinflußt?
Endlich kam der Zug. In der Zwischenzeit hatten sich alle Leute, die normalerweise auf drei verschiedene Züge verteilt werden, auf dem Bahnsteig versammelt. Zum erstenmal seit langer Zeit sah ich, daß ein Tumult ausbrach. Wir stürzten zu den Türen, die sadistischerweise noch einen Moment verschlossen blieben, und als sie sich öffneten, drängelten wir uns vorwärts, die Ellbogen wie spitze sizilianische Stilette benutzend.
Besonders mein Landsmann und ich drängelten. Ich sah, wie er von der vorwärtswallenden Masse verschluckt wurde und weit drinnen im Wagen verschwand, während ich noch zur Hälfte vor der Tür hing. Er versuchte zu winken, aber das war unmöglich, so lachte er nur, und ich lachte zurück.
Schließlich kam ich auch hinein. Vor mir war ein älterer Herr, der sofort seine Zeitung entfalten wollte, ohne Erfolg. Er fluchte leise und gab es auf. Da und dort im Waggon hörte man Gelächter und Gestöhne. Manche hatten sich bereits beruhigt. Leider war ich nicht unter ihnen.
Es roch nach nasser Wolle, und so ein Geruch ruft bei mir allergisches Niesen hervor. Wir sind eine Familie voller Allergien. Meine Mutter hat Ekzeme, der Bruder meiner Mutter hat Ekzeme, mein Bruder hat Asthma, mein Sohn hat sowohl Asthma als auch Ekzeme, ich niese und habe Migräne.
Der einzige, dem nichts fehlt, ist mein Schwiegervater Cosimo M. Monarka. Meine Schwiegermutter Sofia hatte sowohl Migräne als auch Allergien, Bella ist überwiegend gesund, hat aber ein kaputtes Kreuz und dauernd Schmerzen in der rechten Schulter. Und mein Vater hat seit fünfzig Jahren ein Magengeschwür.
Trotzdem war es nicht das Magengeschwür, das ihn jetzt quälte. Jetzt war es das Alter, das mit einem endgültigen Zusammenbruch drohte. Jetzt hatte der Feind unmittelbar die Lebenslust angegriffen.
Das Magengeschwür machte ihm seit langem zu schaffen. Mehrmals war es durchgebrochen und hatte ihn an den Rand des Todes gebracht, aber er ist jedesmal davongekommen. Beim letztenmal, als er mit offenem Magengeschwür eingeliefert wurde, war ich zufällig in Athen, um die Herausgabe eines meiner Bücher zu überwachen.
Ich hatte beschlossen, im Hotel zu wohnen statt zu Hause bei meinen Eltern. Ich wollte ungebunden sein, wollte nicht spät nachts nach Hause kommen und wissen, daß meine Mutter wach ist und wartet genau wie damals, als ich fünfzehn war. Ich bin vor einer Weile vierzig geworden, bin verheiratet und habe ein Kind. Doch meine Mutter weigert sich, mich als etwas anderes zu sehen als ihren jüngsten Sohn, der für immer jung bleibt.
Ich kann nicht einmal behaupten, daß mir die Rolle mißfiel. Sie hat viele Vorteile. Ich konnte Fehler machen, die meinen älteren Brüdern verboten waren, ich konnte mehr als sie aufschneiden, und es wurde als Ausdruck meines jugendlichen Charmes hingenommen. Meine Brüder wurden älter, ich blieb dagegen jung.
Gleichzeitig wollte ich wie ein erwachsener Mann leben. Ich wollte für mich sein können, wollte kommen und gehen nach eigenem Gutdünken, und das war zu Hause bei Mutter und Vater unmöglich. Also wohnte ich im Hotel, ein Hotel, das ich sehr sorgfältig ausgewählt hatte, um mir einen meiner sehnlichsten Wünsche der Jugend zu erfüllen: nämlich einmal in einem schönen Zimmer zu erwachen, das Fenster zu öffnen und zu sehen, wie sich die Akropolis erhebt aus dem ganz besonderen Morgennebel Athens, der die Stadt in einen geschäftigen und heiteren Traum verwandelt.
An einem solchen Morgen rief mein Bruder an und teilte mir mit, daß unser Vater wegen eines durchbrochenen Magengeschwürs in das Krankenhaus gebracht worden sei. Ich setzte mich sofort in ein Taxi und fuhr zum Krankenhaus.
Ein solches Krankenhaus hatte ich in Schweden seit zwanzig Jahren nicht mehr gesehen. Es war laut, schmutzig und verraucht und lag an einer stark befahrenen Straße. Es war Sommer, und alle Fenster waren geöffnet, um den Patienten die Hitze erträglicher zu machen.
Mein Vater lag in der vierten Etage ganz nahe am Fenster. Neben sich hatte er einen Mann, dem man ein Bein amputiert hatte und der unter höllischen Schmerzen litt. In dem kleinen Zimmer drängten sich seine Frau und zwei kleine Kinder, die ununterbrochen heulten.
Mich packte eine fürchterliche Wut, und ich verlangte, daß man meinen Vater sofort verlegen solle, aber die Krankenschwester reagierte auf meine Vorwürfe mit wehmütigem Erstaunen.
«Warum regen Sie sich unnötig auf? Der alte Mann merkt sowieso nichts!»
Erst da begriff ich, daß mein Vater im Koma lag. Mein Bruder, der neben mir stand, nickte bestätigend.
«Diesmal kann ihn nur ein Wunder retten!»
Ich betrachtete meinen Vater, der mit geschlossenen Augen dalag. Sein Gesicht war ganz bleich. Er hatte viel Blut verloren. Man ernährte ihn künstlich durch die Nase. Mein Bruder meinte, es sei sinnlos, daß wir blieben. Er würde in keinem Fall erwachen, und es war bereits eine private Krankenschwester bestellt. Außerdem sollte jeden Augenblick unsere Mutter kommen.
Wir verließen das Krankenhaus, setzten uns in ein Café und bestellten, soweit ich mich erinnere, Kaffee und Kuchen.
«Glaubst du, daß wir den Alten verlieren?» fragte ich.
«Er ist schon einmal mit so etwas fertig geworden!» antwortete mein Bruder und schob den Kuchenteller weg. Dafür trank er den Kaffee in einem Zug aus.
«Wir müssen uns um ein besseres Zimmer kümmern...»
»Es gibt kein besseres Zimmer! Wir können höchstens den andern Patienten fragen, ob er bereit ist umzuziehen. Dazu müßten wir natürlich die Krankenschwester und den Arzt schmieren!»
«Ach so läuft das!» bemerkte ich naiv.
«Wir sind hier nicht in Schweden!» stellte mein Bruder fest und lachte traurig.
Ich sah ihn an. Mein Gott, welche homerischen Kämpfe hatten wir ausgetragen. Er war sechs Jahre älter als ich. Er war der Große in der Familie, er war geschickt in allem, was er sich vornahm. Allerdings nahm er sich nie etwas vor, was meinen Eltern gefiel. Ich bewunderte meinen Bruder, aber er fing an, alt zu werden.
Nur in dem grünen Blick konnte ich noch den jungen Mann ahnen, der sich nach einem Mittagessen mit Bergen von Spaghetti für einen allgemeinen studentischen Wettkampf über 1500 Meter meldete, barfuß und mit den im Magen schlingernden Spaghetti loslief und gewann, mit dem besonderen Lachen, das ihm eigen war: die Welt gehört mir, und wenn die Welt 1500 Meter lang ist, soll mir keiner zuvorkommen.
Aber jetzt fing er an, alt zu werden, und die Welt ist nicht die seine geworden. Früh wurde er in einen Beruf hineingedrängt, der ihm nicht gefiel, seine flinken Beine schlugen Wurzeln an einem Schreibtisch, seine sensiblen Finger konnten nie auf der Gitarre üben, was seine Leidenschaft war, und sein großes Lachen war mehr und mehr zusammengeschrumpft zu einem kleinen, ein bißchen verbitterten Grinsen. Und ich stellte auf einmal erstaunt fest, daß meine Bewunderung überging in Liebe. Erst jetzt, wo wir beide anfingen, alt zu werden, und unser Vater dabei war, in einem schäbigen Krankenhaus zu sterben, erst jetzt vertauschten wir unsere Rollen: er war stolz auf mich, und ich liebte ihn.
Der Abstand zwischen uns in den vergangenen achtzehn Jahren hatte sich bemerkbar gemacht. Wir waren lange nicht mehr zusammen gewesen, aber dort in dem kleinen, lauten Café wurden wir wieder zu Brüdern, nicht langsam und zögernd, sondern mit einem Schlag, blitzartig. Ich fragte:
«Wie geht es dem Schwanz?» Mein Bruder war auch verheiratet.
«Wie einem König, der um der Liebe willen beabsichtigt abzudanken!» antwortete er, und wir kehrten zurück zu unserem sterbenden Vater, der damals doch nicht starb, sondern uns vielmehr eine Lektion erteilte, was es heißt, leben zu wollen. Zwei Krankenschwestern hielten ihn fest. Eine drückte seinen Kopf auf das Kissen, und die andere umschlang seine Beine auf eine Art, die mehr Kraft erforderte als Liebe. Der Schlauch an seiner Nase hatte sich gelöst, und die nährenden Tropfen fielen wie Tränen des Lebens auf sein Gesicht. Er versuchte sich loszureißen, er wollte aufstehen, und sein Blick war fremdartig und wütend. Er schrie unaufhörlich.
«Bringt ihn hinaus! Weg von hier! Er soll hier niemanden holen!»
Die Krankenschwestern waren ganz weiß vor Entsetzen. Eine von ihnen war noch sehr jung. Sie weinte und bat den Alten:
«Lieber Herr Kallides, hier ist niemand. Nur wir sind da, und gerade sind Ihre Söhne gekommen!»
Aber der Alte war unfähig zuzuhören. Er begann wieder zu schreien, er deutete mit seinen alten, aber sehr schönen Fingern – er hatte völlig symmetrische Halbmonde unter seinen stets weißen Nägeln, die er sorgfältigst pflegte –, er deutete auf einen dunklen Punkt im Zimmer und brüllte wieder:
«Werft ihn hinaus! Werft ihn hinaus! Er ist rabenschwarz!»
Die ältere Krankenschwester, deren Lippen blau waren, als würden sie frieren, schlug das Kreuzzeichen und murmelte fast unhörbar:
«Dieser Mensch hier will nicht sterben!»
Damals wollte er nicht sterben. Er war beinahe neunzig Jahre, aber er wollte nicht sterben. Das Blut rann aus ihm, aber sein Gehirn bekam noch genug.
Mein Bruder und ich sahen uns an. Er war bleich. Wie ich aussah, weiß ich nicht. Erschreckt vielleicht. Ich blickte zu dem dunklen Fleck im Zimmer, wohin der Alte mit seinen schönen Fingern deutete. Der Punkt war immer dort gewesen, und er würde immer dort sein.
Wir baten die Frauen, das Zimmer zu verlassen. Sie zögerten, aber mein Bruder versicherte ihnen, daß wir damit fertig werden würden. Sie gingen hinaus. Wir saßen jeder auf einer Seite des Bettes. Wir drückten sanft auf seine Brust. Wir flüsterten ihm ununterbrochen zu:
«Kennst du uns nicht? Wir sind deine Söhne.»
Vorsichtig steckten wir den Schlauch in sein Nasenloch.
Der Alte wurde müder und müder. Er schrie weiterhin, versuchte aber nicht mehr aufzustehen. Es war zwei Uhr nachmittags. Ich rief meine Mutter zu Hause an und sagte, daß es Papa gutginge und sie brauchte nicht zu kommen. Wir würden noch eine Weile bei ihm bleiben und danach käme die Nachtschwester. Sie beruhigte sich.
Ich wurde zuerst müde. Die Augen fielen mir immer wieder zu, aber mein Bruder hielt durch. Das habe ich seit jeher gewußt. Seine Psyche war stärker als sein Körper, genau wie bei meinem Vater.
Ich war der Sohn eines sehr starken Menschen, und ich war der jüngere Bruder eines ebenso starken Menschen.
Ich wüßte gerne, was das für mich bedeutet.
Die Stunden vergingen. Der Alte schlief ein. Er sprach wirr durcheinander, manchmal flüsterte er den Namen seiner ersten Frau, meine Mutter war seine zweite Frau. Manchmal redete er von seiner Heimat, der dunklen Küste an der türkischen Seite des Schwarzen Meeres, auf griechisch Efxinos Pontos, was in der derben Ironie der Griechen «die gastfreundliche Bucht» bedeutet.
Sie war überhaupt nicht gastfreundlich, von Anfang an hieß sie Axinos Pontos, «die ungastliche Bucht», aber die Griechen konnten einen Namen nicht ertragen, der etwas anderes als die einfache Wahrheit aussagt. Welcher Grieche hat sich jemals um die einfache Wahrheit gekümmert?
Gegen zwei Uhr morgens konnte ich nicht mehr. Mein Bruder sah es, und ohne den geringsten Vorwurf sagte er zu mir, ich solle mich unten in der Halle hinlegen, dort stünde ein Sofa.
«Aber du weckst mich, dann löse ich dich ab!» schlug ich vor.
Mein Bruder nickte zustimmend. Aber er weckte mich nicht vor sechs Uhr morgens. Sein Blick war glasig vor Müdigkeit und Kraft.
«Er hat es geschafft!» sagte er nur.
Ich ging mit verschlafenen Augen hinein zu meinem Vater. Er lag ruhig im Bett. Seine Wangen hatten wieder ihre dunkelgraue Farbe, der Bart war während der Nacht gewachsen. Er lächelte matt, und mit blinzelnden Augen, den Augen, die ich so liebte, begrüßte er mich mit den Worten:
«Willkommen zur Auferstehung!»
Mein Bruder lachte, und zum erstenmal seit langem erkannte ich sein großes Lachen wieder, seinen Schlüssel zur Welt. Ich sollte das Lachen nie mehr hören.