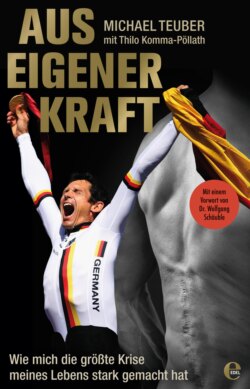Читать книгу Aus eigener Kraft - Thilo Komma-Pöllath - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2 Der 1. August 1987, 13.31 Uhr. Ende einer Jugend
Der Tag, der mein Leben in zwei ungleiche Hälften trennt, beginnt bereits in der Nacht davor. Der 31. Juli 1987 ist ein wunderschöner Sommertag und nichts deutet darauf hin, dass 24 Stunden später nichts mehr so sein wird wie zuvor. Am Morgen gibt es Zeugnisse, das Abitur ist nach Ende der 12. Klasse zur Hälfte in der Tasche. Gerade in meinen Leistungskursfächern Mathe und Kunst muss ich mir keine Sorgen machen. Am Abend ist bei Familie Teuber in Odelzhausen eine große Geburtstagsfeier geplant: Opa August, der nicht Gustl, sondern Fred genannt werden will, feiert seinen 75. Geburtstag. Ich habe andere Pläne. Mit Kumpel Daniel und dessen Freundin Susanne will ich zum Brandungssurfen nach Guincho in Portugal, dem berühmten Surfspot unweit von Lissabon. Von Odelzhausen bis zum Atlantik sind es knapp 2500 Kilometer, deshalb wollen wir noch in der Nacht aufbrechen. Wie man das eben so macht, wenn man keine Zeit zu verlieren hat und den Ferienstau umgehen will.
Unsere Eltern hatten im Prinzip nichts dagegen, obwohl Susanne noch nicht volljährig war und Daniel, 18, und ich noch nicht lange im Besitz eines Führerscheins. Mir den Trip ausreden zu wollen, wäre auch denkbar unglaubwürdig gewesen, war meine Mutter doch im selben Alter, also mit 19 Jahren, nach England abgehauen, um dort für ein Jahr als Au-pair zu arbeiten. Sie versuchten es erst gar nicht. Wir beluden Daniels weißen Golf GTI mit Segeltaschen voller Klamotten, Campingutensilien, Segeln, Masten und Gabelbäumen, ein Riesengewurschtel. Zuletzt schnallten wir meine Kunst-Facharbeit auf das Autodach: mein selbst gebautes Surfbrett. Ein Unikat, mein ganzer Stolz! Auch deshalb konnte ich die Abreise kaum erwarten. In der Nacht hatte ich von meinem Jungfernritt mit dem eigenen Brett auf den langen, harten Wellen im offenen Atlantik geträumt. Wir wollten die ganzen Sommerferien bleiben, sechs Wochen lang, noch einmal die Unbekümmertheit der Jugend in vollen Zügen genießen, die mit dem Abi vorbei sein würde. Ich war voller Vorfreude auf ein großes Abenteuer in meinem Leben, das sich schon bald in einen perfekten Albtraum verwandeln sollte.
Das Surfen ist bei Teubers Familienpassion. Vater Peter war schon als junger Mann Segler und später ein leidenschaftlicher Windsurfer der ersten Stunde, mein Bruder Christian und ich taten es ihm gleich. Mit zehn stand ich das erste Mal am Münchner Feringasee auf einem Brett. Zu Weihnachten hatte ich mir das Buch „Windsurfen lernen“ gewünscht, um mir die theoretischen Grundkenntnisse anzueignen. Typisch Michi – wenn schon, dann systematisch und von der Pike auf. Im darauffolgenden Frühjahr mein Jungfernritt. Ich machte auf Anhieb eine ganz ordentliche Figur auf dem Brett, wenn man einmal davon absah, dass ich abtrieb und der Wind mich auf den See hinaustrug. Weit draußen auf dem See aber drehte der Wind wieder und trug mich überraschend ans Ufer zurück. Mein erster Tag auf dem Brett war auch viel Anfängerglück, der Beginn meiner heilen Sonnyboy-Welt. Für den Anfang taugten uns die Seen in der Heimat, in den Schulferien suchte sich die Familie jedes Jahr neue Surfspots: Elba, Sardinien, Korsika, die Biskaya, die Etangs in Südfrankreich.
Als es auf das Abitur zuging, eiferte ich meinem eineinhalb Jahre älteren Bruder nach und baute im Kunst-Leistungskurs mein eigenes Surfbrett. Christian hatte für seines 14 Punkte bekommen. Der große Bruder – für mich in vielerlei Hinsicht ein Vorbild, eine Schablone für die Spuren, die ich selbst einmal im Leben hinterlassen wollte. Ein weiterer Held meiner Jugend war Sigi Pertramer, Chef der Firma “Lipsticks” in Dachau, einer Kultschmiede für handgefertigte Surfbretter. Nach Dienstschluss, wenn die Werkstatt frei war, weihten mich dieser bayerische Surfgott und sein amerikanischer Shaper Chris in die hohe Kunst des Board-Baus ein. Ich tauchte ein in die Tiefen der Werkstofftechnik und lernte den Unterschied zwischen Epoxyd- und Polyesterharz und die Vorteile eines Styrodur-, Styrofoam- oder Styroporkerns kennen. Vor allem schaute ich mir etliche ihrer Kniffe für eine harmonische Bug- und Heckaufbiegung ab, die sogenannte Scoop-Rocker-Linie für die perfekten Fahr- und Gleiteigenschaften. Wer sein Brett „vershapt“, der hat nichts kapiert, war Sigis Standardspruch. Ich wollte ihn nicht enttäuschen. Ich fertigte eine technische Skizze an, trug mithilfe einer Schablone die Outline auf den Rohling aus PU-Hartschaum auf und sägte die spätere Umrisslinie des Boards aus. Dann versuchte ich mich am Shapen, der harmonischen Abrundung von Kanten auf der Oberseite und der perfekten Formung des Unterwasserschiffs mit den scharfen Abrisskanten. Das war die Pflicht. Sollte das Brett aber zur Legende taugen, musste das Air-Brush-Design große Kunst werden. Ich ließ mich vom abstrakten Bild eines Fischs in den Farben grün und orange inspirieren, das bei uns zu Hause in der Küche hing. Das Design war für mich der Höhepunkt der Arbeit, die Verführung des Surfens schlechthin. Auf den fertig geshapten und designten PU-Kern brachte ich die Haut aus Polyester-Glasfaser-Laminat auf. Das Brett war rechtzeitig fertig, um es in den Ferien in Portugal einem ersten Praxistest unterziehen zu können. Danach wollte ich es bei meinem Kunstlehrer als Facharbeit einreichen. Dass es nach sechs Wochen Wellen, Salz und UV-Strahlung nicht mehr ganz taufrisch aussehen würde, nahm ich in Kauf, mehr noch, die Spuren des Ozeans würden es erst richtig adeln. Mit dem Brett wollte ich durch die Wogen des Abiturs und des Lebens reiten. Es kam anders.
Daniel und Susanne holten mich gegen 22 Uhr zu Hause ab, und sobald wir das Brett auf dem Autodach festgezurrt hatten, brachen wir auf. Daniel saß am Steuer, er wolle den ersten Teil der Strecke übernehmen. Wie immer hatte er die Rückenlehne des Fahrersitzes weit zurückgestellt. Er lag mehr im Auto als dass er saß, was für uns völlig in Ordnung war. Wir kannten es nicht anders. Mein Vater Peter war irritiert, er sagte zu Daniel: „Wie sitzt denn du am Steuer? Da pennst du doch ein!“ Daniel reagierte trocken: „So fahr’ ich immer!“ Die Route stand fest: Über Bordeaux und Biarritz nach Nordspanien und dann ab nach Guincho, dem westlichsten Punkt Europas. Daniel und ich wollten uns alle drei Stunden mit dem Fahren abwechseln. Susanne durfte noch nicht. Über Nacht waren wir gut vorangekommen, unsere Taktik, dem dichten Ferienverkehr vorauszufahren, war aufgegangen. Gegen 12 Uhr mittags am nächsten Tag, dem 1. August 1987, nach einem guten Drittel der Strecke, legten wir bei Clermont-Ferrand eine Kaffeepause ein. Daniel und ich diskutierten eine Weile, wer weiterfahren sollte. Daniel hatte das Steuer keine Stunde vor der Pause übernommen. Er sei nicht müde, sagte er, außerdem kenne er die Strecke gut, er sei mit der Familie in den Ferien schon öfter hier gewesen. Kurzum: „Ich fahre!“
Von Clermont-Ferrand führt die einspurige Landstraße D 1089 hinauf nach Tulle, mitten durch das französische Zentralmassiv. Links und rechts Felder, vereinzelt Schafe, im Hintergrund die mächtigen Schatten der Gebirgszüge. Wir sind seit gut einer Stunde unterwegs, ich schaue aus dem Fenster, döse vor mich hin, schließe die Augen, den Kopf voller Bilder. Der Michi am Strand. Der Michi auf seinem Board. Der Michi und das Meer. Plötzlich, ich versuche gerade, auf dem Beifahrersitz eine bequemere Schlafposition zu finden, bekommt unser Golf einen gewaltigen Schlag ab, so als hätte uns ein Lastwagen von der Seite gerammt. Es ist ein ohrenbetäubendes Rattern und Kratzen. Ich bin auf der Stelle hellwach. Etwa drei Kilometer vor Tulle kommt Daniel mit dem Auto von der Landstraße ab und fährt mit etwa 100 km/h in einen steil abfallenden Graben hinein. Er versucht zu bremsen und den Wagen wieder aus dem Graben herauszumanövrieren. Aber durch die Schräglage ist der Wagen, der überwiegend auf den beiden rechten Reifen aufliegt, kaum noch zu steuern. Auch ein deutliches Abbremsen gelingt nicht. Der Golf kracht, das wissen wir heute, mit einer Geschwindigkeit von etwa 70 Stundenkilometern gegen ein Abflussrohr, das sich uns in der ganzen Breite des Grabens in den Weg stellt. Ein lauter, dumpfer, knarziger Knall. So klingt es, wenn Metall auf Beton aufschlägt und zerbirst. Das Abwasserrohr ist so massiv, dass es nicht nachgibt. Hat es überhaupt einen Kratzer abbekommen? Die Gepäckstücke, die Zelte schießen katapultartig durch den Innenraum des Wagens, der Dachträger mit den Brettern und Masten fliegt etwa 20 Meter weiter in den Graben hinein, der Golf schiebt sich zusammen wie der Balg einer Ziehharmonika, nur dass der Sound ein anderer ist. Die Fahrzeugfront ist kaum noch als solche zu erkennen, gerade auf der Beifahrerseite hat sich der Wagen, durch die Wucht des Aufpralls, regelrecht um das Rohr gewickelt. Der Ticker meines Lebens notiert: Samstag, 1. August 1987, 13.31 Uhr, drei Kilometer vor Tulle, einer vergessenen Kleinstadt mitten in Frankreich, in der François Hollande im Gemeinderat sitzt, meteorologisch betrachtet ein perfekter Sommertag.
Stille.
Wohl nur ein paar Sekunden. Aber gefühlt? Zeit und Raum spielen in diesem Moment meines Lebens keine Rolle. Sie lösen sich auf. Die Stille nach einem solchen Knall ist ohrenbetäubend. Durch den Aufprall auf das Betonrohr bin ich mit dem Kopf ungebremst auf dem Armaturenbrett aufgeschlagen. Wegen der Schräglage des Autos im Graben sitze ich auf der Beifahrerseite in der Falle. Ich bin im Schock und gleichzeitig hellwach. Susanne, hinten im Auto, wird panisch, das bekomme ich sofort mit. Aus dem Kühler steigt Rauch auf, sie hat Angst, dass das Auto gleich zu brennen beginnt und explodieren könnte. Sie brüllt: „Los, raus, raus, raus!“ Daniel öffnet die Fahrertür und verlässt als Erster das Auto, Susanne stürzt von hinten über den Fahrersitz aus dem Wagen. Beide laufen hektisch 20, 30, vielleicht 40 Meter im Graben vom Auto weg nach vorne. Dann bleiben sie stehen. Einer fehlt. Langsam drehen sich beide um, schauen sich an, schauen zum Auto und realisieren, dass ich nicht mit gelaufen bin. Dass ich noch immer im Wagen sitze. Allein. Ich bin nicht weg oder bewusstlos. Ich sehe die beiden in einiger Entfernung vor dem Auto stehen als säße ich im Kino und schaute, umnebelt vom Rauch des Motors, durch die Reste einer Fensterscheibe auf eine Leinwand, die zwei Menschen zeigt, in deren Gesichter sich das Entsetzen spiegelt. Ich selbst bin immer noch ruhig, fast friedlich, als gehe mich das alles nichts an. Zum Glück, die beiden Freunde sind gerettet. Erst langsam begreife ich, was passiert ist. Was ist mit mir? Warum sitze ich hier noch rum? Meine Gedanken führen Selbstgespräche: Warum bin ich immer noch im Auto? Komm Michi, steig aus! Was ist los mit dir? Was ist dein Problem? Raus hier! KOMM SCHOOOON!!!
Pause.
Es geht nicht. Warum, verstehe ich in diesem Augenblick nicht. Seelenruhig zwicke ich mich an den Armen und in die Backen. Bin mir plötzlich nicht mehr ganz so sicher: Lebe ich noch? Die Sekunden im Auto, als ich Daniel und Susanne erwartungsvoll anblicke, sind bis heute gleichzeitig die klarsten, die einsamsten, die lautesten Sekunden meines Lebens. Ich kann nicht raus, ich bin eingequetscht, ich fühle nichts mehr. Susanne kommt zum Auto zurückgelaufen. Sie brüllt: „Michi, komm’ raus! Bitte!“ Aber Michi kommt nicht raus. Ich kann mich nicht bewegen, ich kann meine Beine nicht bewegen, denke ich. Habe ich es ihr auch so gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Susanne reagiert sofort. Sie will mich beruhigen, obwohl sie selbst im Adrenalinrausch ist. „Du hast dir wahrscheinlich die Beine gebrochen“, sagt sie. Sagen ihre angsterfüllten Augen das auch? Ich schaue an mir herab, meine Beine sind im Fußraum kaum noch zu sehen. Das eingedrückte Blech des Wagens hat sie mit der Sporttasche, die dort einmal zwischen meinen Beinen lag, merkwürdig miteinander verkeilt. Werde ich jetzt verschluckt von einem weißen Golf GTI?
Leben heißt auch, sich im Griff zu haben. Ich habe nichts mehr im Griff. Das Adrenalin schießt ein, ich verliere die Kontrolle. In diesen wichtigsten Minuten meines Lebens. Ich werte das so dramatisch, weil ich dem Tod wohl nie wieder so nahe kommen werde, ohne tatsächlich sterben zu müssen. Und ich hänge am Leben. Ich bin jetzt nur noch der Passagier im eigenen Körper. Ein surreales Melodram mit mir in der Hauptrolle und als einzigem Zuschauer: Ich schaue mir selbst beim Sterben zu. Oder was auch immer gleich passieren wird. Ich merke, dass ich das ganze Ausmaß der Situation nicht begreifen darf, sonst brächte es mich um. Das ganze existenzielle Notprogramm, dass die Natur in uns eingerichtet hat, wenn es um Leben und Tod geht, wird in mir hochgefahren: Schockstarre, Hormonausschüttung, Abspaltung, Rausch und Leere. Alles passiert unmittelbar, alles muss sofort wieder verdrängt werden. Dabei bin ich doch Kopfmensch, rational bis in die Haarspitzen. Ich versuche mir selbst die Faktenlage nüchtern zu erklären. Mein Kopfkino gerät ins Stottern: „Ich spüre meine Beine nicht!“ „Ich spüre meine Beine nicht!“ „ICH SPÜRE MEINE BEINE NICHT!“ Susanne beugt sich durch die Beifahrertür zu mir ins Auto. Wir reden banales Zeug und gleichzeitig wissen wir, dass etwas Schlimmes passiert sein muss.
Wie sich später herausstellt, ist Daniel auf kerzengerader Strecke übermüdet in einen Sekundenschlaf gefallen. Der Wagen ist von der Straße abgekommen und im Graben auf ein Betonabflussrohr geprallt. Es ist das einzige Rohr im Umfeld von 20 Kilometern.
Die sichtbaren Verletzungen sind überschaubar. Susanne, die hinten im Wagen saß, kommt mit dem Schrecken davon. Daniel hat einen Schlag aufs Knie und auf sein Handgelenk abbekommen, gebrochen ist nichts. Er war nicht angeschnallt, sagt er später, und wer kann schon mit Sicherheit sagen, ob seine spezielle Sitzposition ihm nicht – welche Ironie – das Leben gerettet hat. Dass ich angeschnallt war, hat mir auf der Beifahrerseite in jedem Fall das Leben gerettet. Ich wäre mit dem Kopf voraus durch die Frontscheibe geflogen. Das Brillenhämatom im Gesicht wird verheilen, der durch den Aufschlag auf den Armaturen verursachte Jochbeinbruch wird mich beim Blick in den Spiegel ein Leben lang an diesen Tag erinnern. Meine Physiognomie hat sich durch den Unfall unwiederbringlich verändert. Mein Gesicht, das nach dem Unfall eine lila-gelbe Färbung annahm, wirkt nicht mehr weich und rund, vielmehr knochig und flach, der Bereich zwischen Augen und Wangenknochen ist auf der linken Seite eingedellt.
Mit Daniels Hilfe kann Susanne die Beifahrertüre öffnen. Sie ahnt bereits, dass die sichtbaren Verletzungen nicht die entscheidenden sind. Der Unfall hat einen Stau auf der D 1089 verursacht. Die Menschen springen aus ihren Autos und kommen direkt auf uns zugelaufen. Zehn, fünfzehn Leute umringen in kürzester Zeit den weißen Golf mit dem Dachauer Kennzeichen. Ein Golf, der nicht mehr als solcher zu erkennen ist. Unter den Passanten ist ein Arzt aus dem Krankenhaus in Tulle, er saß im zweiten Auto hinter uns und war auf dem Weg zur Arbeit. Jetzt steht er neben mir, spricht mich auf Englisch an, ich sage ihm, dass ich mich nicht befreien, dass ich meine Beine nicht bewegen kann. Dass ich meine Beine nicht mehr spüre. Er begreift die Situation sofort. „Lasst die Finger von ihm“, herrscht er die Umstehenden an, die eine Traube um unser Fahrzeug bilden. „Er hat höchst wahrscheinlich etwas an der Wirbelsäule!“ Kurze Pause. Wirbelsäule – ich höre das Wort, doch ich überhöre, was er damit sagen will.
In der Sekunde des Unfalls mochte die Zeit still gestanden haben, jetzt verfliegt sie geradezu. Die Erstversorgung klappt reibungslos. Es dauert vielleicht zehn Minuten, bis der Krankenwagen kommt, den der Arzt aus Tulle mit seinem Pager gerufen hat. Gleich vier Rettungssanitäter kümmern sich rührend um mich. Acht Hände greifen vorsichtig unter Rücken und Beine, um mich so schonend wie möglich aus dem Auto zu hieven. Mein Glück, dass die Beifahrertür offen ist und ich nicht aus dem Fahrzeug rausgeschnitten werden muss. Ich werde auf eine Druckmatratze gelegt, die Sanitäter pumpen sie mit Luft auf und fixieren meinen Körper so, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Wichtig ist jetzt vor allem, dass die Verletzung, was auch immer es sein mag, nicht durch ruckartige Bewegungen noch weiter verschlimmert wird. Im Krankenwagen schneiden die Notärzte meine Hose auf, legen mir einen Zugang für einen Tropf, die Infusion soll eine Embolie verhindern, gleichzeitig tropfen Schmerz- und Beruhigungsmittel in meinen Körper hinein. Wir warten auf den Hubschrauber, er soll mich in die Universitätsklinik nach Limoges bringen. 20 Minuten später landet er auf dem offenen Feld.
Von hier an trennen sich die Wege der drei ziemlich besten Freunde, die einen unvergesslichen Sommer in Portugal verbringen, ein letztes Mal die Leichtigkeit des Seins genießen wollten. Sie sind bis Frankreich gekommen, aber mit Savoir-vivre hat das nichts zu tun. Während der Hubschrauber mich ins 90 Kilometer entfernte Limoges fliegt, nimmt der Arzt Daniel und Susanne mit in die Notaufnahme seines Krankenhauses nach Tulle. Er übernimmt die Kontrolluntersuchungen selbst, will sicher gehen, dass die beiden keine inneren Verletzungen erlitten haben, dass ihnen wirklich weiter nichts fehlt, und bietet ihnen an, die Nacht bei ihm zu Hause zu verbringen. Daniel und Susanne nehmen das Angebot an. Sie sind gerettet.
Eine halbe Stunde etwa dauert der Flug von der Unfallstelle nach Limoges. Glaube ich. Ganz sicher bin ich mir nicht. Ja, mir ist dieser Unfall passiert. Aber habe ich den Unfall tatsächlich so erlebt, wie er passiert ist? Oder reime ich mir heute den Ablauf zusammen, weil damals meine Sinne im existenziellen Hormonrausch verrücktspielten? Was habe ich verdrängt? Was weiß ich noch selbst, was haben andere erzählt? Welche Erinnerungen sind wahrhaftig nach der langen Zeit?
Wenn man sich den Ort für einen lebensgefährlichen Verkehrsunfall aussuchen könnte, dann würde ich die Landstraße D 1089 nach Tulle sehr empfehlen. Schon allein deshalb, weil die nahe gelegene neurochirurgische Klinik in Limoges einen exzellenten Ruf genießt und dafür bekannt ist, mit modernsten Operationstechniken Leben retten zu können. Das alles weiß ich damals natürlich nicht, aber im Nachhinein erweist sich der Unfallort als großer Glücksfall, der mein weiteres Leben maßgeblich beeinflussen sollte. Nach der Landung werde ich durch die Schleuse der Notaufnahme gerollt. Wie man es von der TV-Serie Emergency Room kennt, steht ein halbes Dutzend Ärzte und Krankenschwestern Spalier, um sich sofort um mich zu kümmern. Eine erste Befragung, die kaum noch Zweifel an der Schwere meiner Verletzungen offen lässt, eine Röntgenaufnahme, die Gewissheit bringt, danach sofort in den OP. Ich bin für die Ärzte eine Art Modellpatient: Ein junger deutscher Tourist mit einer schweren Rückenmarksverletzung – an dem zeigen wir jetzt mal, was wir hier so alles können. Heute weiß ich, dass die Franzosen eine Operation an mir vorgenommen haben, an die sich in Deutschland in den 1980er Jahren niemand herangewagt hätte. Man hätte mich nicht operiert, sondern den Bruch an der Wirbelsäule erst einmal ausheilen lassen. In Limoges, neben Paris eines der neurochirurgischen Zentren Frankreichs, ist das anders. Mein Operateur, Chefarzt Dr. Szapiro, Anfang 40, charmant, charismatisch, hat keinerlei Bedenken, einen „frischen“ Querschnitt aufzuschneiden. Über acht Stunden dauert der Eingriff an diesem schwülheißen späten Augustnachmittag, bei dem er mit acht Schrauben eine Titanplatte an meinen fünf Lendenwirbeln verschraubt. Dr. Szapiro, kein „Gott in Weiß“, sondern für mich der Retter, dem ich für den Rest meines Lebens dankbar sein werde. Ein unprätentiöser Fachmann, der seiner Freude und seinem Stolz über die schwierige, aber gelungene Operation selbstbewusst Ausdruck verleiht.
„Wir haben das Beste für Ihren Sohn getan“, sagt Dr. Szapiro zu meiner Mutter, die inzwischen an meinem Krankenbett im Zimmer 416 auf der vierten Etage der neurologischen Station wachte, während ich mit einer Batterie von Schmerz- und Beruhigungsmitteln ruhiggestellt wurde. Die Diagnose ist jedoch katastrophal. Im Medizinerlatein: Luxationsfraktur des zweiten und dritten Lendenwirbels, Knochensplitter im Rückenmark, Funktionsverlust der unteren Gliedmaßen. Inkomplette Querschnittslähmung. Auf gut Deutsch: Durch den Bruch der Lendenwirbel und die Quetschung des Rückenmarks Lähmung von der Hüfte abwärts. Das Horrorszenario am Horizont: ein Leben im Rollstuhl. Das sind die neuen Realitäten des Michael Teuber seit diesem 1. August 1987, 13.31 Uhr MEZ. Es mag bitter und zynisch klingen, aber ausgerechnet ein Abflussrohr beendet die viel zu kurze erste Hälfte meines Lebens. Das, was für den zweiten Teil noch übrig sein soll, liegt in Trümmern.
Für die allermeisten wohl kaum nachvollziehbar, fühle ich mich in diesen ersten Stunden meines noch kurzen neuen Lebens jedoch kaum zu Tode betrübt. Vielmehr ist es eine Art Galgenhumor, der meinen Überlebenswillen speist. Ich warte selbst darauf, dass mich meine Gefühle nach unten reißen, dass ich in einer Depression versinken werde. Aber nichts von alledem geschieht. „Die letzten zwei Wochen der Ferien bin ich beim Surfen dann wieder mit dabei. Bitte richte das Daniel und Susanne aus“, flüstere ich meiner Mutter bei fiebrigem Bewusstsein zu. Vielleicht sind es die hochdosierten Schmerzmittel und Psychopharmaka, vielleicht verhindert aber auch nur die Vorstellung von mir auf einem Surfbrett einen Nervenzusammenbruch. Die restliche Zeit bin ich vor allem eins: weggetreten. Einige Tage nach der Operation in Limoges, in einem der wenigen klaren Momente, impft mich Dr. Szapiro mit Hoffnung. Das letzte Wort darüber, ob ich jemals wieder würde gehen können, sei noch nicht gesprochen. Er glaube mir ohne Weiteres, dass ich im rechten Oberschenkel noch etwas spüre, dass ich das Gefühl habe, Muskeln ansteuern zu können, auch wenn sich jetzt noch wenig rege. Limoges ist so innovativ, dass ich nach der OP umgehend in physiotherapeutische Behandlung gegeben werde. Das bisschen Spiel im Muskel sind die Fasern, an die ich mich von jetzt an klammere. Gerade bei einem tiefen, inkompletten Querschnitt wie dem meinen sei es durchaus möglich, so Dr. Szapiro, dass – bei optimalem Rehabilitationsverlauf – Restfunktionen in den Beinen trainierbar und damit teilweise wieder herstellbar seien. Er bleibt im Ungefähren, er verspricht nichts, aber er lässt für mich die Tür, zurück in ein halbwegs normales Leben, einen Spalt breit offen. Mehr brauche ich nicht. Sein glaubwürdiger Optimismus beflügelt meine Lebensgeister.
Sehr schnell nach der Operation setzen mich die französischen Ärzte wieder aufrecht ins Krankenbett. Sie behandeln mich wie einen Patienten unter vielen. Das Gefühl, dass ich ein besonders schwerer Fall bin, verflüchtigt sich auf diese Weise von Tag zu Tag ein bisschen mehr. Angst, dass die Wirbelsäule nicht halten werde, hat niemand. „Wir haben das so sauber verschraubt, das hält“, sagt Dr. Szapiro selbstbewusst. Als ich jedoch nach einer Woche zur weiteren Behandlung in die Unfallklinik Murnau ausgeflogen werde, verfliegt auch mein Optimismus. Daniel und Susanne, die mich noch in Frankreich am Krankenbett besucht hatten, sind zu diesem Zeitpunkt längst zu Hause und können ihr altes Leben wieder aufnehmen. Im Fernseher meines Stationszimmers 416 läuft am letzten Abend Derrick auf Französisch. Merde!
Samstag, genau eine Woche nach dem Unfall, steht ein Rotkreuz-Learjet am Flughafen in Limoges bereit, um mich nach Deutschland zurückzubringen. Mit an Bord: Dr. Jan Vastmans, ein junger Unfallmediziner, und seine Freundin, die sich in ihrer Freizeit als Rettungssanitäter engagieren, sowie meine Mutter Annemie, die vier Tage nach dem Unfall mit dem Nachtzug aus Paris in Limoges eingetroffen war. Es war der erste Flug ihres Lebens. Zum Glück ist meine Familie Mitglied beim Roten Kreuz, sonst hätte der Rücktransport ein Vermögen gekostet.
Meine Eltern erfuhren erst mit zwei Tagen Verspätung von meinem Unfall. Das Wochenende über waren sie mit ihrem Segelboot auf dem Starnberger See unterwegs, Handys gab es noch keine. Als sie zurückkamen, blinkte der Anrufbeantworter penetrant in Ampelrot, die Nachrichtenbox war voll.
Der Chefarzt des Dachauer Klinikums, der Vater eines Schulfreunds, der auch ein paar Brocken Französisch kann, tritt mit den Kollegen aus Limoges in Kontakt. Die Informationen sind anfangs widersprüchlich. Zunächst heißt es, ich könne die Beine noch nicht bewegen, aber von einer Lähmung sei nicht auszugehen. Meine Mutter weiß es zu diesem Zeitpunkt schon besser. Sie habe sofort gespürt, dass etwas Schwerwiegendes passiert sei. Eine Mutter fühle so etwas, wenn das Leben ihres Sohnes, ihrer Familie so existentiell bedroht wird. Ihren Schock und ihre Trauer verarbeitete Annemie später in einem Buch.1 Auch für meinen Vater Peter war es ein Schock, das konnte man schon daran ablesen, dass er kaum noch sprach und immer schweigsamer wurde.
In Murnau komme ich auf die Station 45, Abteilung für Rückenmarksverletzungen, Zimmer 2. Stimmung und Behandlungsstrategie in diesem berühmten oberbayerischen Unfallkrankenhaus unterscheiden sich von derjenigen in Limoges grundlegend. Ich werde flach gelegt. Die Hälfte der Zeit auf dem Rücken, die andere Hälfte auf dem Bauch, routinemäßige Vorkehrung für Paraplegiker, die selbst nicht spüren, wenn sie sich wundliegen. Murnau sieht in mir einen ganz normalen Fall für den Rollstuhl. Das erste Patientengespräch, noch am Tag der Einlieferung, endet mit den Worten: „Herr Teuber, wir bereiten Sie in sechs Monaten auf ein Leben im Rollstuhl vor.“ Wumms! Die Taktik ist klar: Murnau will keine Hoffnung schüren, um nicht zu enttäuschen. Erstmal schwarz malen und dann sehen wir weiter. Egal, wie demoralisierend das auf den Patienten wirken mag. Meine Einwände, dass es im rechten Oberschenkel zuckt, dass ich Restsensibilitäten an der Haut spüre und das eben nicht alles tot sein könne, will in Murnau zu diesem Zeitpunkt niemand hören. Am Abend des ersten Tages kommt die junge Stationsärztin an mein Bett, um mir nun auch ganz offiziell die schlechte Nachricht der Neurologen zu überbringen. Ich solle mir keine Illusionen machen, meine Restfunktionen seien nicht verwertbar, der Rollstuhl die einzig realistische Perspektive. Zu meiner Mutter gewandt sagt sie: „Der arme Junge tut mir besonders leid, er ist ja noch so jung.“ Mitleid ist brutal für einen 19-jährigen Burschen, der sich nicht mehr rühren kann.
Der Empfang in Murnau ist wie ein Schlag vor den Kopf – den Körperteil, der noch gesund ist, und den ich ab sofort brauchen werde wie keinen anderen. Die Ansage der Ärzte hinterlässt Wirkung. Ich liege den ganzen Tag im Bett herum, kann mich ohne Hilfe nicht von links nach rechts drehen, realisiere meine Begrenztheit, das volle Ausmaß des Unfalls. Meine Gedanken schwirren wie Leuchtblitze durch mein Gehirn. Das Kopfkino setzt wieder ein, diesmal nicht rauschinduziert, sondern durch meine erzwungene Untätigkeit, meine Handlungsunfähigkeit, während das Leben der anderen um mich herum kreist wie ein Kettenkarussell, für das ich keine Eintrittskarte mehr kaufen kann: „Herr Teuber, wir bereiten Sie auf ein Leben im Rollstuhl vor …“ Leben … Rollstuhl … Ich … Was soll das, bitteschön, für ein Leben sein?
Ich habe während dieser Zeit in der Klinik nie über meine Situation gejammert. Klar, es gab Momente des Selbstmitleids. Aber echte Schwermut, Verzweiflung, Depressionen, gar Selbstmordgedanken? Das habe ich nach dem Unfall, auch wenn es vielleicht schwer zu glauben ist, so nicht erlebt. Dafür bin ich einfach nicht der Typ. Viel zu rational, viel zu kopfgesteuert, als dass ich mir erlauben würde, mich von derlei Gefühlen überwältigen zu lassen. Der Gedanke an das Zucken im rechten Oberschenkel hielt mich über Wasser. Mit einer einzigen Ausnahme. Ein halbes Jahr nach dem Unfall, im Januar 1988, gegen Ende meines Aufenthalts in Murnau, erlitt mein Vater einen Herzinfarkt. Der Stress, die Angst um seinen Sohn hatten ihn im Innersten getroffen. „Ich würde sofort mit dir tauschen und ein Leben im Rollstuhl in Kauf nehmen“, hatte Peter noch kurz davor zu mir gesagt. Ein paar Tage später brach er zusammen. Dass vor lauter Kummer über meine gebrochene Wirbelsäule das Herz meines gerade mal 49 Jahre alten Vaters brach, das übermannte mich. Dieses eine Mal heulte ich hemmungslos. Mich selbst habe ich in all der Zeit nie so beweint. Bis heute nicht.
War der Unfall nun Schicksal? Gab es doch jemanden da oben, der einem Atheisten wie mir ein Zeichen schickte? Ist so ein Unfall irgendetwas anderes als ein Fakt von höchstens statistischem Belang? Rechnerische Wahrscheinlichkeit. Irgendeinen muss es ja treffen, wenn es Abertausende Verkehrstote und Schwerverletzte jedes Jahr allein auf deutschen Straßen gibt. Ist das nicht der Gang der Dinge oder, wenn Sie so wollen, das Leben? Ich war vor dem Unfall nicht religiös und bin es danach nicht geworden. Wenn es einen selbst erwischt, wird schnell von Schicksal palavert. Da konstruiert sich der eine oder andere gern etwas zusammen, damit ihm das Geschehene begreiflich und erträglich wird. Es wird ein Sinn gesucht, eine Antwort auf die Frage nach dem Warum. Aber auf die Frage, warum ich heute ein Querschnittsgelähmter bin, gibt es keine andere Antwort als die: Es ist einfach passiert. Es hätte genauso gut jeden anderen treffen können. Aber die Banalität des Faktischen wird von den meisten nicht akzeptiert, zumal wenn man der Betroffene ist. So, wie ich auf die Welt schaue, ist der Unfall kein himmelschreiendes Unrecht, das das Leben an mir verübt hat, sondern ein ebenso banaler wie saudummer Zufall. Auch deshalb habe ich Daniel nie große Vorwürfe gemacht. Ich bin ihm nicht böse und ich gebe ihm nicht die Schuld. Er hat einen Fehler gemacht, wie ihn schon viele 18-jährige gemacht haben, die gerade ihren Führerschein in der Tasche haben. Er ist weiter gefahren, obwohl er müde war. Auch mir hätte so ein Sekundenschlaf leicht passieren können, trotz aller Warnungen der Eltern und Freunde. Es ist passiert. Basta!
Daniel und ich waren Kumpel, wir kannten uns von der Schule, gingen gern zusammen surfen. Aber nach dem Unfall trafen wir uns nicht noch einmal unter vier Augen. Wir redeten nicht miteinander, um gemeinsam zu begreifen, was passiert war. Um sagen zu können: Ich gebe dir keine Schuld! Dazu kam es nie, das bedaure ich. Daniel war in der akuten Phase nach dem Unfall ein-, zweimal bei mir im Krankenhaus. Es waren Pflichtbesuche, mehr nicht. Dann brach der Kontakt ab. Bis heute. Das ist etwas, das mich ein Stück weit irritiert. Es schien für ihn wohl der beste Weg, der Situation Herr zu werden, die Schuldgefühle zu verdrängen, etwas zu vergessen, was man aber gar nicht vergessen kann. Weder er noch ich. Zu sehr ist dieser 1. August unseren beiden Lebensläufen eingebrannt. Wie es ihm geht? Wie er heute damit umgeht? Ob er es an sich heranlässt, wenn er hört, wie erfolgreich ich mein „Schicksal“ gemeistert habe? Ich wünsche ihm, dass er einen Weg gefunden hat. Aber um ehrlich zu sein: Es ist nicht mehr mein Thema. Ich habe genug mit mir selbst zu tun.
Ich war in den letzten Jahren noch zwei Mal an der Unfallstelle. Zufällig führten zwei offizielle Weltcuprennen über die D 1089 nach Tulle. Das Abflussrohr gibt es immer noch, es ist immer noch das Einzige weit und breit, aber es hat seinen Schrecken für mich verloren. Es liegt da, als bräuchte es keiner, vergessen von der Welt, als könne es keiner Fliege etwas zuleide tun, und doch hat es mein Leben für immer verändert. Einige Wochen nach dem Unfall bekamen meine Eltern von den französischen Behörden ein Paket zugestellt. Darin waren die Klamotten, die ich am Unfalltag getragen hatte. T-Shirt und Jeans, zerschnitten und dunkelrot gefärbt vom eingetrockneten Blut. Meine Mutter hat das blutige Bündel, wie sie mir sehr viel später einmal offenbarte, einfach in die Grundmauern der behindertengerechten Einliegerwohnung, die meine Eltern in ihrem Haus in Odelzhausen errichten ließen, einmauern lassen. Als zementiertes Überbleibsel aus meinem ersten Leben. Dieser 1. August 1987 lässt eine Jugend und eine Freundschaft und ein Surfbrett zurück, das eine Legende werden wollte und an einem Betonrohr zerschellte. Es hat das offene Meer nie gesehen.
1 Anna Maria Teuber: Querschnitt, Der Bericht einer Mutter über den Weg ihres Sohnes vom Rollstuhl auf’s Rennrad, ISBN 3-8311-3997-0