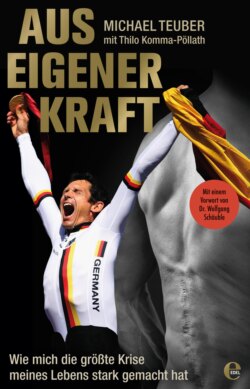Читать книгу Aus eigener Kraft - Thilo Komma-Pöllath - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1 Was ich einmal werden wollte, was ich geworden bin
Die Frage, was ich einmal werden will, die Frage also, die sich jeder Jugendliche stellt, wenn das Leben auf ernst schaltet, habe ich mir nie gestellt. Auch nicht vor dem 1. August 1987. Da war ich 19 Jahre jung, kurz vor dem Abitur und das Leben stand mir offen. Wie man so sagt. Interessante Redewendung. Und dann: Nach halb zwei Uhr nachmittags konnte von stehen keine Rede mehr sein. Ich saß im Rollstuhl. Querschnittsgelähmt. Behindert. Schon klar, ich war nicht todkrank, aber völlig intakt eben auch nicht mehr. Was konnte ich jetzt noch werden?
Polizist, Popstar oder Rennfahrer wäre mir schon als Kind nicht in den Sinn gekommen. Was Kinder eben so werden wollen. Mit mangelndem Ehrgeiz hatte das nichts zu tun, vielmehr konnte ich schon von klein auf mit kindischen, weil unrealistischen Schwärmereien nichts anfangen. Meine Eltern ahnten schon damals, dass ich mich nicht – völlig unnötig und viel zu früh – auf etwas festlegen lassen wollte, das mich dann doch nicht für mein ganzes Leben ausfüllen konnte. Spätestens seit der siebten Klasse wusste ich, dass ich das Abitur machen werde, daran hatte ich keinerlei Zweifel. Zweifel hatte ich grundsätzlich nicht viele. Meine Mutter Annemie bestärkte mich darin, das Leben von seinen Stärken her zu betrachten. „Such’ dir was, das dir Spaß macht. Intelligent genug bist du!“
Ein einziges Mal, ich war etwa acht Jahre alt, bin ich von der teuberschen „Sich bloß nicht festlegen“-Regel abgewichen. Ich war bei der Maier-Oma am Tegernsee zu Besuch, der, anders als im Märchen, guten Stiefmutter meiner Mutter. Ich liebte die Maier-Oma, sie hatte so viel Güte und Freundlichkeit in ihrem Wesen und schien mir immer zu signalisieren: „Michi, egal wie du es machst, du machst das schon richtig!“ Sie war damals ungefähr 50 Jahre alt, was mir als Kind uralt vorkam, und ich ging wohl davon aus, dass sie es nicht mehr lange machen würde. Jedenfalls sagte ich zu ihr: „Maier-Oma, ich werde Doktor, damit du nicht sterben musst.“ Die Maier-Oma lachte nur. Ich bin kein Arzt geworden, gestorben ist sie bis heute nicht, die Maier-Oma. Es blieb das einzige berufliche Ziel, das ich in meinem Leben je formuliert habe.
Als Teenie war mir der Gedanke an „Arbeit“, an „Nine to Five“, generell ein Graus, an dem nur Spießer Gefallen finden konnten. Hey, es waren die Achtziger, ich trug Kajal unter den Augen, Schmuck überall und spitze Schuhe an den Füßen, und das in der bayerischen Provinz! Ich wollte mich ausprobieren, ich wollte was anderes als die Mainstream-Maibaum-Jugend. Ich wollte mir Zeit lassen, die ich, das weiß ich heute, so nicht hatte. Gerade volljährig, das Abi in Sichtweite, wollte ich in jede nur mögliche Lustnische meines jungen Lebens schnuppern: Surfen, Segeln, Mode, Mädels. Nebenbei die Schule fertig machen, später an die Uni. Was Richtiges studieren, einen guten Job, einen gut bezahlten Job. Konkreter war das nicht. Ich wollte was werden, aber bitte noch nicht sofort. Ich war kein Typ, der sich sonderlich Sorgen um seine Zukunft machte, lang herumgrübelte, sondern einer, der an seine Möglichkeiten glaubte. Wie soll ich sagen: Ich hatte schon als junger Bursche ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein, das auch meine Eltern immer wieder überraschte. „Michi, woher hast du das nur?“, war ein Standardspruch meiner Mutter. Die Antwort war einfach: Von dir und Papa.
Dann kam der 1. August 1987, der Tag, der meine Möglichkeiten im Leben dramatisch beeinflussen sollte. Zunichtemachte, dachten die meisten. Aber auch das kam anders. Ausgerechnet mit dem Unfall ergab sich die günstige Fügung für mein Leben, dass ich mich nie um einen dieser langweiligen, spießbürgerlichen Jobs mit dem klassischen Chef, der schlechten Bezahlung und dem üblichen Mobbing bewerben musste. Es gehört zu den Kuriositäten meines Lebens, dass ich nur durch meine Querschnittslähmung Profisportler werden konnte.
Es gibt Menschen, die, weil sie zu viele Talente haben, ihre Möglichkeiten im Leben vertändeln. Sie fangen vieles an und bringen nichts zu Ende. Da hatte ich es besser. Ich stürzte mich auf das Wenige, das ich noch hatte, das ich jedoch unbedingt nutzen wollte: meinen gesunden Menschenverstand und das, was von meinem Körper übrig blieb. Beides erwies sich als erstaunlich lebendig. Nach dem Unfall wurde mir ziemlich schnell klar, was ich zu tun hatte. Die Rückkehr in ein einigermaßen normales Leben, die Rehabilitation, die Quälerei waren anfangs natürlich kein Spaß. Aber als sich die ersten Fortschritte zeigten, als ich den Rollstuhl nach über zwei Jahren verlassen konnte, da erinnerte ich mich wieder an die Ermunterung meiner Mutter: Junge, mach, was dir Spaß macht im Leben! Elf Jahre später beschloss ich, Leistungssportler zu werden. Heute weiß ich: Ein Leben in der Weltspitze macht eine Menge Spaß, selbst wenn man seine Beine nicht mehr spüren kann.
Ich hatte das, was man eine unbeschwerte, glückliche Kindheit nennt. Ich war ein fröhlicher Bub, konnte die Leute um mich herum zum Lachen bringen. Ich spielte am liebsten draußen auf der Straße und war schon als Kind sehr unabhängig, wie meine Mutter sagt. Was wohl heißen soll, dass ich sie mit meinem Bewegungs- und Freiheitsdrang an die Grenzen ihrer Pädagogik brachte und ihr manchmal ziemlich auf die Nerven ging. Big Jim war mein Ideal, ein martialischer Plastikheld, mit Muskelpaketen überall, die dicken Arme in Siegerpose in die Höhe gereckt. Sein durchgedrückter Rücken gefiel mir, was war dagegen schon der Schönling Ken? Wenn man jung ist, will man autonom, stark und selbstbewusst sein und Dinge einfach tun können, ohne die Eltern fragen zu müssen. Was ich schon als Kind in mir spürte, wurde spätestens mit dem Unfall zum wichtigsten Charaktermerkmal: meine Unabhängigkeit. Gerade in den ersten Wochen nach dem Unfall, im Krankenhaus, wurde mir bewusst, wie einsam man sich fühlen kann, wenn man für jeden noch so kleinen Schritt jemanden braucht, der einem hilft, weil man selbst nichts mehr einfach nur so tun kann: Aufstehen, Treppen steigen, Füße hochlegen, pinkeln.
Als Fußgelähmter darf ich diesen platten Wortwitz machen: Die Freiheit des Einzelnen – auf ihr fußt alles im Leben. Das ist zumindest meine Grundmaxime. Mein Gerechtigkeitsempfinden, meine Aversion gegen blinden Gehorsam, meine Abneigung gegen Bevormundung, meine kritische Haltung Autoritäten gegenüber, all das war bei mir bereits in meiner Kindheit angelegt, fragen Sie meine Eltern. Ich wollte mich nicht unterordnen. Sie werden kaum einen Lehrer finden, der mich damals nicht als renitent und aufmüpfig empfunden hat (na gut, ein, zwei mag es gegeben haben, denen ein freier Geist, eine selbständige Denke wichtiger waren als der starre Lehrplan).
Seit der Mittelstufe des Gymnasiums wusste ich, dass ich, anders als mein älterer Bruder Christian, niemals zur Bundeswehr gehen würde. Mein Antrag auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen ist auf den 31. Juli 1987 datiert. An diesem Tag steckte ich das Kuvert an das Bundesamt für den Zivildienst in die Post. Es ist der Tag, an dem ich mich abends auf jene unglückselige Reise nach Portugal aufmachte, die mein Leben von den Füßen auf den Kopf stellte. Der Tag vor der größten Katastrophe meines Lebens. So sahen es damals alle, vor allem meine Eltern. Keine 24 Stunden, nachdem ich den Brief eingeworfen hatte, in dem ich meinem Land darlegte, warum ich aus Gewissensgründen keine Waffe in die Hand nehmen könne und meine Dienstzeit lieber etwas Sinnvollerem opfern wolle, meinetwegen mich als Zivi um Behinderte zu kümmern. Keine 24 Stunden später war ich selbst behindert, ein Pflegefall, der auf Hilfe angewiesen war.
Bis zum Abitur, der Entlassung in die größtmögliche persönliche Freiheit der Erwachsenenwelt, war es noch ein Jahr, aber ich wollte meine Haltung so früh es geht demonstrieren. Nach der Pfeife von anderen tanzen – niemals! Mit 18 war ich aus der Kirche ausgetreten, es war meine erste Amtshandlung als erwachsener deutscher Staatsbürger, noch bevor ich das erste Mal zur Wahl ging. Im Ohr hatte ich dabei den Religionslehrer, der mir in der Grundschule in Odelzhausen eine Watschn androhte, nur weil ich im Unterricht geschwätzt hatte. Nein, ich bin nicht für streng hierarchische Systeme wie das Militär, die katholische Kirche oder auch den Klinikbetrieb gemacht. Solche Systeme schließen das Selberdenken zu oft aus. Nicht meine Denke vom Leben.
Dass ich ein Mensch bin, der eine eigene, oft unbequeme Meinung hat und deshalb mitunter aneckt, das habe ich von meinen Eltern. Sie haben mich zu einem eigenständigen Menschen mitgeformt, das war und bleibt die große Kunst ihrer Erziehung. Was andere über mich denken, darüber habe ich mir nie viele Gedanken gemacht. Und spätestens in der Klinik, nach meiner Querschnittsdiagnose, hatte ich dafür auch gar keine Zeit mehr. Seit meine Beine gelähmt sind, weiß ich die Freiheit zwischen meinen Ohren noch viel mehr zu schätzen. Nur indem ich nach dem Unfall meine Ratio benutzte, konnte ich den lange ergebnisoffenen Schwebezustand zwischen Lähmung und Fortschritt austarieren, meinen persönlichen Erwartungsdruck bezüglich der maximal erreichbaren Mobilität in Schach halten. Und ich lernte, dass die Fähigkeit, von anderen Hilfe anzunehmen, nicht automatisch den Verlust der Unabhängigkeit bedeuten muss, sondern der Beweis innerer Größe sein kann.
Soweit ich mich zurückerinnere, hatte ich im Umgang mit meiner Behinderung von Anfang an das gute Gefühl: So, wie ich es mache, ist es richtig. Ich bin nicht in Depressionen versunken, ich habe nie gedacht, dass es das schon gewesen sein könnte mit mir. Ich habe mich, trotz angeknackstem Selbstwertgefühl, nie in Gänze in Frage gestellt, nur weil ich keine funktionstüchtigen Beine mehr hatte. Und mein Vater Peter machte mir anfangs immer wieder klar, wozu ich noch selbst in der Lage sein musste. Ich wollte also was werden im Leben, jetzt ein zweites Mal, jetzt aber schnell und erst recht!
Wenn mir heute fremde Menschen begegnen, dann kennen sie – nicht immer, aber immer öfter – Teile meiner Lebensgeschichte, obwohl ich nicht zu den Celebritys gehöre, die von RTL ins Dschungelcamp geschickt werden. Der tragische Unfall, die Querschnittslähmung mit 19, meine Erfolge als Behindertensportler. Die Menschen zeigen sich meistens beeindruckt von meiner Biografie und Lebensleistung und halten mich, das wird in vielen Gesprächen deutlich, entweder für ein medizinisches Wunder oder für einen Masochisten. Dabei ist die Antwort auf ihre verwunderten Blicke ziemlich einfach: Die wundersame Heilung des Michael Teuber hat es nie gegeben. Den unbeugsamen Willen, mich selbst ins Leben zurückzuschubsen, den schon.
„Der Teuber tickt anders“, sagten Ärzte, Betreuer, Mitpatienten in der Unfallklinik Murnau damals während meiner halbjährigen stationären Rehabilitation. Halb aus Respekt, halb aus Verwunderung. Ich nahm ihre Skepsis als Bestätigung auf. Sie erklärten mich für verrückt, wenn ich wieder und wieder auf das Ergometer geschnallt werden wollte, um das letzte Zucken in meinen Beinen herauszukitzeln, um auch die letzte intakte Faser zu retten. Der Begriff „Restfunktion“, der immer wieder fiel, so sperrig und so kalt er sich anfühlen mag, wurde zum Mantra meiner täglichen Übungen. „Bringt doch nichts, Michael, lass gut sein“, sagten sie, die Profis in der Klinik zum Patientenprofi. Die hierarchische Struktur, wie sie zumindest damals in der Klinik in Murnau bestand, wo der Chefarzt einen auf lieben Gott machte und den Patienten zum willenlosen Befehlsempfänger degradierte, das passte mir nicht. Da wurde ich einmal mehr zum renitenten Michi Teuber, der auch als Paraplegiker im Krankenhaus die Verantwortung lieber selbst übernahm. Ein Neurologe gab mir bei der Verabschiedung nach über einem halben Jahr Recht: „Sie tun so, als wären Sie nicht behindert – das könnte die richtige Taktik sein.“ Einmal aus Murnau entlassen, kehrte ich so schnell nicht wieder dorthin zurück.
Ich habe viele der schmerzhaften Erinnerungen lange verdrängt. Mit Dingen, die nicht zu ändern sind, vergeude ich normalerweise keine Energie. Hätte, wenn und aber – so ticke ich nicht. Ich bin heute Hochleistungssportler, ich schaue nur nach vorne. Weinerlichkeit und Gefühlsduselei sind mir fremd. Lieber Leistung und Analyse statt Gefühle, die ich verdrängen musste, um ein neues Leben beginnen zu können. Angesichts der Aufgabe, meine motorischen Unzulänglichkeiten in den Griff zu bekommen, verhielt ich mich schon in den langen Jahren der Rehabilitation wie ein Leistungsportler. Und bis heute begegne ich mir selbst im alltäglichen Leben wie ein Athlet vor einem wichtigen Wettkampf: fokussiert, ehrgeizig, egoistisch. Das ist ein heikles Unterfangen, denn das Leben ist kein Ego-Shooter-Game, in dem es nur um einen selbst geht, die eigene Befindlichkeit, die permanente Selbstoptimierung. Vor allem dann nicht, wenn man ein Kind hat und eine Familie, für die man da sein will.
Im Rahmen der Erinnerungsarbeit für dieses Buch bin ich zu den entscheidenden Weggabelungen und Emotionen meines Lebens zurückmarschiert – ja, ich kann wieder gehen, wenn auch etwas stacksig und auch nur mit Fußschienen. Weggabelungen, die den Menschen Michael Teuber spürbar machen sollen, vor und nach dieser existenziellen Krise des Unfalls und seiner Folgen. Sich selbst spüren zu können, darum geht es doch im Leben. Für jeden von uns und gerade, wenn man gelähmt ist. Ich habe den Unfall nicht gebraucht, um eine Lebensaufgabe zu finden. Aber der Unfall hat mir mein Leben selbst, mein Überleben zur größten Aufgabe gemacht. In dieser Krise entdeckte ich eine Kraft in mir, die ich anzapfen und für mich nutzbar machen konnte. Seitdem bin ich der Athlet meines Lebens. Von diesem Weg in dieses Leben will ich Ihnen hier erzählen.
P.S.: Mein Antrag auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissengründen wurde nicht mehr bearbeitet. Nach meinem Verkehrsunfall rief mein Vater das zuständige Kreiswehrersatzamt an, um den Beamten mitzuteilen, dass der Antrag wohl hinfällig sei, jetzt, da sein Sohn, Michael Teuber, im Rollstuhl sitze. Junge Männer mit einem Schwerbehindertenausweis und einem eingetragenen Behinderungsgrad von 100 Prozent, waren – logischer Weise – als „untauglich“ von der Wehrpflicht freigestellt. Dass dieser junger Mann schon bald Profisportler werden wollte, der das Zeug zum Paralympics-Sieger hatte, nun, wie hätte Peter das dem Beamten einigermaßen glaubhaft erklären sollen ….