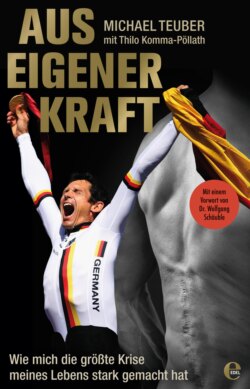Читать книгу Aus eigener Kraft - Thilo Komma-Pöllath - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3 New Wave in Odelzhausen
Die Frage, wie viel von dem, was ich heute bin, ich schon vor dem Unfall war, führt zurück an einen Ort, der sich selbst als heile Welt versteht: Odelzhausen, eine 4000- Seelen-Gemeinde im Landkreis Dachau westlich von München. CSU-Hoheitsgebiet. In die Dorfjugend waren mein Bruder Christian und ich nie wirklich integriert, was vermutlich auch daran lag, dass das Interesse meiner Eltern an den Stammtischen und Vereinen des Ortes begrenzt war. Das Dorfleben ist, von alters her, auch in Odelzhausen eine zweigeteiltes. Die Männer im Wirtshaus am Politisieren und beim Fußball, die Frauen, wenn nicht zu Hause, vor allem sozial engagiert. Als meine Eltern das erste Mal an der Hauptversammlung des örtlichen Sportvereins teilnahmen, war Annemie die einzige Frau. Es kam ihr reichlich antiquiert vor. Immerhin: Sie durfte bleiben. Später, bei der Gründung des Tennis- und des Skicklubs, durften Frauen sich auch für Ämter bewerben, die Idee der Gleichberechtigung war in Odelzhausen angekommen. Gerade im Tennisklub sammelten sich viele Neubürger, die ein Gegengewicht zu der über Generationen gewachsenen, homogenen Dorfgemeinschaft suchten. Dort Anschluss zu finden, bedeutete für jeden „Zuagroasten“ das Bohren dicker Bretter, vor allem dann, wenn die persönlichen Interessen so ganz anders gelagert waren. Meine Eltern tranken lieber Wein als Bier und lasen lieber Literatur als den Lokalteil der Tageszeitung. Die Familie wohnte im „Goaßenzipfel“, einem Gebiet, das die Gemeinde nach dem Zweiten Weltkrieg Flüchtlingen bereitgestellt hatte. Bereits diese Wohnlage wies uns für jeden Alteingesessenen als „die Neuen“ aus. Es ging nicht darum, dass Christian und ich uns als etwas Besseres gefühlt hätten, das taten wir nicht. Odelzhausen war einfach nicht unsere Welt. Von außen betrachtet auch nicht die Welt meiner Eltern, sehr aufgeschlossene, aber eben auch unkonventionelle Charaktere, zu denen das Leben auf dem Land auf den ersten Blick so gar nicht passen wollte.
Peter
Mein Vater Peter ist schon biografisch bedingt ein Einzelkämpfer, als Vertriebenem blieb ihm kaum eine andere Wahl. 1939 bei Breslau geboren, kam er im Januar 1945 unter der Obhut von Männern des Reichsarbeitsdiensts als sechsjähriger Pimpf mit Mutter, Oma und zwei jüngeren Brüdern in einem Güterzug nach Bayern. Die Schrecken des Krieges, die er als Kind erlebt hat, sind ihm bis heute gegenwärtig. Wenn er sich an die letzten Kriegswochen erinnert, erzählt er von Fliegerangriffen auf den Bahnhof von Landshut, die ihn in Angst und Schrecken versetzten. „Mutti, Mutti, bitte leg dich auf mich!“, flehte er seine Mutter, Oma Hilde, an, wenn er die Jagdbomber am Himmel hörte. Anders als man vielleicht annehmen würde, formten diese Erlebnisse Peter aber nicht zu einem zaghaften oder gar ängstlichen Charakter, sondern, ganz im Gegenteil, zu einem jungen Mann, der sein Schicksal selbst in die Hand nehmen wollte. Nach der Handelsschule und einer kaufmännischen Ausbildung in München schlug er bei der Post die Beamtenlaufbahn ein. Nach ein paar Jahren, Peter war inzwischen Beamter auf Lebenszeit, beschloss er, sich für den höheren Dienst zu bewerben. Das Dumme war nur, die Post gab ihn nach bestandener Prüfung nicht frei. Seine Enttäuschung darüber war so groß, dass Peter den Beamtenstatus, damals der Traum vieler, aufgab und 1965 zur Allianz wechselte. Dort wurde er Bezirksleiter der Außendienstvertreter, Außendienstsprecher, Betriebsrat. Mitte der 1970er-Jahre wurde er als Arbeitnehmervertreter des Gesamtbetriebsrats in den Aufsichtsrat der Versicherung berufen, neben honorigen Leuten wie Bertelsmann-Eigner Reinhard Mohn und Deutsche-Bank-Vorstandssprecher Alfred Herrhausen – ausgerechnet er, „der rote Peter“, geprägt von der 68er-Bewegung und Willy Brandts Ostpolitik, und selbst von der eigenen christ-sozialen Verwandtschaft als „Sozi“ kritisch beäugt. „Bei mir ist alles eher oppositionell“, lautet ein Satz von ihm, der bezeichnender nicht sein könnte. Nach einem Dreivierteljahr war es mit dem Aufsichtsrat auch wieder vorbei. Nach einer Umstrukturierung verlor der Außendienst sein Aufsichtsratsmandat und Mohn und Herrhausen die Chance, ihre Sinne weiter an einem Mann zu schärfen, der aus seiner sozialdemokratischen Haltung keinen Hehl machte. Mein Vater verdiente gut bei der Allianz, die damals noch eher Beamtenbetrieb war und kein Megakonzern wie heute. Als in den 1990ern die EDV Einzug hielt und die Allianz von Karteikarten auf Computer umstellte, zeigte sich eine weitere Eigenschaft, die meinen Vater bis heute auszeichnet: Er hat den Mut, sich auf neues Terrain zu wagen. Während viele Kollegen „das neumodische Zeugs“ ablehnten, war ihm sofort klar, dass der Computer die Zukunft bedeutete. Als eine Art IT-Sonderbeauftragter reiste er quer durchs Land, warb bei den Vertretern vor Ort für die neuen Computersysteme, hielt Schulungen ab und zeigte den skeptischen und missmutigen Kollegen gern, dass ein Computer nur dann funktionieren kann, wenn das Stromkabel in der Steckdose steckt. Als nach Ende der Pilotphase die Position Ende der 1990er-Jahre wieder aufgelöst wurde, sollte mein Vater Assistent des Geschäftsführers werden, aber der Hansel vom Chef, das wollte er nicht sein. Also bot man ihm, gerade mal 58 Jahre alt, eine großzügige Altersteilzeitregelung an. In der Endphase seiner Allianz-Zeit kam es regelmäßig vor, dass der Chef auf die Frage, wo denn der Teuber wieder stecke, von den Kollegen nur hörte: „Beim Segeln!“ Mein Vater war der Exot mit dem Boot.
Annemie
Meine Mutter, die am Tegernsee aufwuchs, war ein widerspenstiges Kind. Keine Angst, das sagt sie bis heute über sich selbst. Dass ich nicht zu allem Ja und Amen sage, habe ich wohl noch mehr von ihr als von Peter. Der Vater meiner Mutter, ein Kriminalbeamter aus kleinsten Verhältnissen im Bayerischen Wald, führte zu Hause ein strenges Regiment. Um ihren Willen zu beugen und sie Gehorsam zu lehren, forderte er – nicht nur einmal – seine beiden Töchter auf, laut „der Schnee ist schwarz“ zu rufen. Schwester Hanni gab irgendwann klein bei, aber meine Mutter stellte auf stur, der Vater war machtlos. Als sie 14 oder 15 Jahre alt war und auf die Handelsschule in München ging, bekam sie in Betriebswirtschaftslehre einmal eine Vier, ihre Sitznachbarin, eine Tochter aus besserem Hause, die von ihr abgeschrieben hatte, hingegen eine Zwei. Das ließ meine Mutter, die ein unbestechliches Gerechtigkeitsempfinden besaß, nicht auf sich sitzen und stellte den Lehrer zu Rede. „Die Schicke schreibt von der Doofen vom Dorf ab und wird dafür belohnt, das kann doch wohl nicht sein“, sagte sie in ihrer Erinnerung zu dem Pauker. Es ist ihr zuzutrauen. Die Arbeiten wurden noch einmal verglichen, der Text war so gut wie identisch. Am Ende bekamen beide eine Zwei, obwohl die „Schicke“ nachweislich abgeschrieben hatte.
Meiner Mutter wusste schon als Jugendliche, dass der Tegernsee nicht die Erfüllung ihres Lebenstraums war. Ihr war klar: Sie wollte weg aus der Enge des Tals, in dem jeder jeden kennt und hinter dem Rücken oft ganz anders über einen spricht als von Angesicht zu Angesicht. Mit 19 kündigte sie, nach einem Streit mit dem Leiter des Schalterraumes, kurzer Hand ihre Anstellung bei der Hypobank und ging als Au-pair nach England. Auch die Liebelei mit Peter, den sie kurz zuvor kennengelernt hatte, hielt sie nicht davon ab. Ihre Sehnsucht nach der großen weiten Welt war stärker. Nun also, Frühjahr 1963: London! Minirock, Twiggy, Beatles, Drogen, Swinging Sixties. Sie fand eine Stelle bei der Tochter eines tüchtigen Fischhändlers. Joyce war Leiterin eines Kindergartens und nur etwa zehn Jahre älter als meine Mutter. Beide wurden Freundinnen. Annemie betreute Joyce’ neunjährige Tochter Gillian, kochte und half im Haushalt. In ihrer Freizeit lernte sie am College Englisch und erwarb einen Cambridge-Abschluss. Heimweh kam nicht auf, im Gegenteil, der Abstand von zu Hause tat ihr gut. Ihren Horizont erweitern zu können, empfand sie als großes Geschenk. Die Zeit in England zeigte ihr, wie eine junge Frau in den frühen 1960er-Jahren ihr Leben selbstständig leben konnte. Annemie genoss ihre Freiheit in London in vollen Zügen. Am Sonntagnachmittag ließ sie sich von jungen Männern ausführen, die zahlreich um sie warben. Es ging zum Tanztee in die Hall of Music, ganz in der Nähe des Piccadilly Circus. Einmal ergatterten sie und ihre Schwester, die ebenfalls als Au-pair in England war, Karten für eine BBC-Radioshow. Angekündigt waren die Beatles mit dem Song “I wanna hold your hand”; Annemie durfte John und Paul von der ersten Reihe aus anschmachten und konnte ihr Glück kaum fassen. Sie schmiedete an ihrer Zukunft. Zusammen mit Hanni wollte sie weiter nach Australien, einen neuen Au-pair-Job in Aussicht. Ihrem „lieben Peter“ schrieb sie, dass es aus sei. Er solle nicht weiter auf sie warten und sie am besten vergessen. Doch aus Australien wurde nichts und sie und ihre Schwester kehrten viel früher als gedacht nach Deutschland zurück. Vor ihrer Abreise rief Annemie Peter an, ob sie nicht etwas trinken gehen wollten, ihre Pläne hätten sich geändert. Als ihr Zug am Münchner Hauptbahnhof einfuhr, stand Peter am Gleis, als wäre nie etwas gewesen. Wieder daheim besuchte Annemie eine Hotelfachschule und arbeitete als Rezeptionistin und Buchhalterin im „Wiesseer Hof“, einem gediegenen Hotel im Tegernseer Tal. Auch als junge Mutter arbeitete sie einige Jahre noch an den Wochenenden weiter, wenn Peter die Kinder hüten konnte. Eine intelligente junge Frau, die es liebte, ihren eigenwilligen Kopf zu benutzen.
Peter und Annemie hatten sich Pfingsten 1962 auf einer Party auf der Solveig 1 kennengelernt. Die Solveig war eine knapp sechs Meter lange Hansajolle mit Mahagoniplanken und kleiner Kajüte, die mein Vater von seinem ersten selbst verdienten Geld dem Abenteurer Rollo Gebhard für 2000 Mark abgekauft hatte. Gebhard, der als Einzelkämpfer zweimal die Welt umsegelt hatte, war wie mein Vater Mitglied im Segelclub Würmsee am Starnberger See. Damals musste man noch kein reicher Mann sein, um ein Boot zu besitzen oder Mitglied in einem Segelklub zu werden. Ungewöhnlich war es trotzdem. Mein Vater, nach eigener Einschätzung kein Abenteurer, aber mutig genug, um dem Leben mit all seiner Vielfalt offen zu begegnen, war in seinem Freundeskreis der Erste, der ein Surfbrett und ein Rennrad hatte, sich für Mopeds interessierte, eine Kamera spannend fand, der sein Haus selbst entwarf und sich ein Boot anschaffte. Die Lust am Ausprobieren und Entdecken ist ihm bis heute geblieben. Eine Lust, der man Anfang der 1960er-Jahre noch hemmungslos nachgehen konnte. Heute käme man schnell in den Ruch, ein neureicher Gockel zu sein, der sich alles leistet, weil er es kann und um damit anzugeben. Bei meinem Vater war das etwas anderes: Die Dinge bedeuteten ihm etwas.
Die Freundin seines Bruders Dieter brachte ihre beste Freundin zur Party mit aufs Boot: Annemie. Sie blieb über Nacht, obwohl sie damals erst 18 und damit noch nicht volljährig war. In einer Koje im Yachtklubgebäude hatte mein Vater zwei Liegen aufgestellt, eine Spüle für die Morgenwäsche gab es auch. Es war die erste gemeinsame Nacht meiner Eltern. Knapp vier Jahre später, im Januar 1966, heirateten sie. Ein halbes Jahr später kam mein Bruder Christian zur Welt, 19 Monate danach ich. Wir, die Teuber-Jungs der zweiten Generation, hatten in Odelzhausen einen Ruf zu verteidigen, an dem unsere Eltern nicht ganz schuldlos waren. Weil ihre Vorstellung vom Leben sich wie eine Blaupause über das Leben ihrer Söhne legte. Weil wir nicht vorhatten, weniger experimentierfreudig und eigenwillig zu sein als unsere Alten.
Nachdem sie Anfang der 1970er-Jahre ein Grundstück in Oberhaching bei München an eine Wohnungsbaugesellschaft verkauft hatten, besaßen meine Eltern das Startkapital, um in Odelzhausen bauen zu können. 1973 zog die Familie in ein Haus ein, wie es im ganzen Ort kein zweites gab. Offen, hell, modern, großzügig, mit Sichtbeton, Kamin und Wendeltreppe. Peter und Annemie liebten den Bauhaus-Stil. Weil das Haus direkt gegenüber der Autobahnausfahrt lag, ließen sie einen Wall aufschütten – wahrscheinlich den ersten Lärmschutzwall Bayerns – für den sie eigens ein Gutachten einholen mussten. Damit unterschied sich die Familie Teuber nun auch architektonisch von den anderen, die es eher gut bürgerlich mochten. Mein Vater liebte Opern, vor allem Verdis La Traviata, aber auch Mozart. Meine Mutter liebt die deutsche Literatur und las alles, was sie in die Hände kriegen konnte, Goethe und Grass, Böll und Walser, und wenn sie die Zeit dazu fand, schrieb sie abends noch selbst Gedichte. Es wurde diskutiert über Gott, die SPD und die richtige Kindererziehung. Die dörfliche Gemeinschaft haben sie nicht romantisch verklärt, sondern vielmehr als Enge empfunden. Unsere Kindheit auf dem Land war so idyllisch wie es das Klischee besingt, spätestens in der Pubertät ist idyllisch jedoch auch so langweilig wie es klingt.
Als ich noch ein Baby war, segelten Peter und Annemie zu zweit – Christian und ich übernachteten bei der Maier-Oma am Tegernsee – mit unserer Hansajolle von Lignano nach Istrien einmal quer über die Adria – ohne Außenbordmotor versteht sich. Mit Motor, das könne ja jeder, meinte der Vater. Ein anderes Mal, ich war etwa neun Jahre alt, bestiegen wir mit der ganzen Familie den Ätna. Stundenlang wanderten wir den Krater hoch. Mir genügte das nicht, ich wollte die Lava sehen und riechen und bin dann mit Peter bis zum Kraterrand hinaufgestiegen. Eigentlich war es verboten, aber der Blick in den Schlund war großes Kino. Ein paar Tage später setzten wir mit der Fähre zu den Äolischen Inseln über. Ich lag meinem Vater so lange in den Ohren, bis wir gegen Abend von Vulcano aus mit einem Touristenboot zur Insel Stromboli tuckerten, um uns den daueraktiven Vulkan aus der Nähe anzusehen. Bis heute spuckt er alle acht Minuten Lava, ein weltweit einmaliges Naturschauspiel. Es war klar, dass wir die letzte Fähre zurück nach Sizilien verpassen würden. Also legten wir vier uns zum Schlafen in ein Fischerboot, wo uns am nächsten Morgen die Fischer entdeckten und mit wüstem Gebrüll, der Ausdruck „Stronzo“ fiel mehrfach, verscheuchten. Wahrscheinlich hielten sie uns für Gammler oder Diebe, die es auf ihre Boote abgesehen hatten.
Manchmal führe ich mein immer schon stark ausgeprägtes Selbstvertrauen darauf zurück, dass ich schon als Kleinkind so oft auf dem Boot meiner Eltern war. Dort lernte ich, ein raues Klima zu ertragen und mit Unwägbarkeiten schnell und unerschrocken umzugehen. Eine Charaktereigenschaft, die mich bis heute auszeichnet. Das Segeln wurde für mich in meiner Kindheit und Jugend zum Inbegriff eines Lebensgefühls, das mir von meinem Dad vorgelebt wurde und von dem ich bereits als kleiner Junge nicht genug bekommen konnte: die Freiheit, in der Natur, auf dem offenen Meer sich selbst zu spüren; die Freiheit, niemandem Rechenschaft ablegen zu müssen. Am Ende, auch wenn es pathetisch klingt und egoistisch sein mag: Frei zu sein von allen Zwängen. Das genoss ich – manchmal auch zum Leidwesen meines älteren Bruders Christian.
Christian & ich
Wir teilten uns ein großes Zimmer und waren wie Zwillinge, unzertrennlich. Die 19 Monate Altersunterschied spielten keine Rolle. Christian war in vielerlei Hinsicht ein Vorbild für mich. Er fuhr schon begeistert Rad, ich sauste als Sechsjähriger mit dem Kettcar hinterher. Kaum machte er den Segelschein, wollte ich ihn auch machen. Das gleiche mit dem Surfen, dem Rauchen, den Mädels. Wie oft bei Erstgeborenen, musste er vieles an Rechten und Freiräumen gegenüber den Eltern erst erkämpfen, wovon ich als Nachgeborener profitieren konnte. Ihm oblagen viele unangenehme Pflichten, die für mich nicht mehr galten.
Es gibt da eine Geschichte, die uns beide bis heute begleitet. Eines gelangweilten Tages, ich war noch keine zehn Jahre alt, hatte ich mit der gallertartige Masse aus einem Lufterfrischer einen dicken Streifen auf die Toilettenwand gemalt – sozusagen ein ebenso künstlerisches wie chemisches Experiment. Als die unsinnige Aktion aufflog, gab ich den Ahnungslosen. Ich verstrickte mich so in mein „Kann ich mir überhaupt nicht erklären“-Märchen, dass ich daraus tagelang nicht mehr herausfand. „Wir können ja mal den Opa fragen“, suggerierte ich bei den Verhandlungen mit meiner Mutter eine mögliche Täterschaft des Großvaters. Und mein Vater rief tatsächlich den armen Opa an. Wenn es um Ausreden ging, war ich sehr fantasievoll. Meine Mutter wurde böse: „Wollt ihr mich veräppeln?“, schimpfte sie und erließ Hausarrest für uns beide, so lange, bis wir mit der Wahrheit herausrückten. In meiner kindlichen Sorglosigkeit dachte ich mir nichts dabei, den älteren Bruder, der völlig schuldlos war, in die Sache mit hineinzuziehen. Zwei Tage später änderte ich meine Taktik und war am runden Küchentisch bereit, klein beizugeben: „… was wäre denn …, was würde denn passieren …, wenn ich sagen würde, dass ich…“. Viel weiter kam ich nicht. Christian stand vom Tisch auf und ging beleidigt weg. Er hatte allen Grund dazu.
„Ich hatte immer schon das Gefühl, dass du das Herzibubi der Eltern bist“, sagte Christian einmal im Urlaub in Mexiko zu mir. Das war ein gutes halbes Jahr nach meinem Autounfall und ich saß gelähmt im Rollstuhl. Schon in den frühesten Kindertagen habe er ein Defizit an Aufmerksamkeit von Seiten der Eltern wahrgenommen, sagte er, weil sich oft alles um den Kleinen und dessen Wehwehchen drehte. Ich wusste natürlich, was er meinte. Im Alter zwischen sieben und neun Jahren brach ich mir viermal hintereinander den Arm. Das erste Mal passierte es mit Holzclogs auf dem Skateboard: „Schau mal Papa, wie gut ich das kann …“ Beim zweiten Mal fuhr ich auf Skiern über eine Sprungschanze, die Landung war weniger elegant als schmerzhaft. Beim dritten Mal stolperte ich in der Schulaula über eine Stufe und stützte mich im Fallen mit dem gerade genesenen Arm ab – ich war genau einen Tag gipsfrei gewesen. Beim vierten Mal zog ich bei einer Rangelei mit zwei Nachbarjungen den Kürzeren. Auf dem Weg ins Krankenhaus bläute mir meine Mutter nach den Erfahrungen der letzten Male ein: „Schrei fei g’scheit, damit du gleich drankommst.“ Der Hausarzt gab sich lakonisch: „Naja, mit Gewalt bekommt man alles immer wieder kaputt.“ Die Eltern bekamen wohl den Eindruck, dass sie auf das Nesthäkchen ganz besonders aufpassen mussten. Für Christian bedeutete es, dass er sich über all die Jahre weniger geliebt fühlte. Die Geschichte mit dem Lufterfrischer dient ihm bis heute als Beleg dafür, dass er sich im Vergleich zu mir ungerecht behandelt fühlt. Ein Vorwurf, der unseren Eltern schwer im Magen liegt. Eine persönliche Sicht, die ich lange nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Und der Unfall hatte den Neid des Großen auf den Kleinen noch einmal neu entfacht.
Dass Christian und ich sehr unterschiedliche Charaktere sind, wurde mir erst im Laufe der Jahre klar. Als Kinder hatten wir damit kein Problem. Er, der etwas Ältere mit der oft sehr rauen Schale war zugleich sehr viel introvertierter, verletzlicher und sensibler als ich. Über Gefühle sprach er nicht, keiner wusste, was er dachte. Seine enttäuschten Erwartungen verbarg er so lange, bis es aus ihm herausbrach, wenn der Druck in ihm zu groß wurde. Dann konnte er ziemlich ruppig werden. Da war ich, der nach der Mutter kam, ganz anders. Ein meist fröhlicher und gut gelaunter Sonnyboy, dem keiner wirklich böse sein konnte. Mit drei Jahren stellte ich mich zu Weihnachten in einem Wirtshaus in Bad Tölz auf den Tisch und sang: „Hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor!“ Und alle klatschten amüsiert Beifall. Ein andermal, ich saß mit meiner Mutter bei der Nachbarin im Auto, wir waren auf dem Weg nach München zum Einkaufen, sagte ich zu dieser: „Du, Brigitte, du weißt schon, dass das ein Puff ist“ und zeigte auf ein Haus am Straßenrand. Es war der „Leierkasten“, Münchens berühmtestes Bordell. Da muss ich zehn gewesen sein. Das ganze Auto brüllte vor Lachen. Christian fiel es deutlich schwerer, Menschen für sich einzunehmen. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass meine Art, mich aus brenzligen Situationen zu lavieren, ihm durchaus imponierte. Einmal sagte er zu mir, ich sei wie ein Aal, der durch alle Probleme hindurchgleite, ohne jemals das Gesicht zu verlieren. Das nahm ich als Kompliment.
Brenzlig war so einiges während unserer wilden Zeit im dörflichen Odelzhausen. Wir montierten Surfsegel auf unsere Skateboards und „surften“ auf dem Asphalt; oder ich ließ mich mit dem Skateboard von Christian mit dem Mofa ziehen und versuchte mich an immer neuen Geschwindigkeitsrekorden jenseits aller Tempo-30-Grenzen. Die Zeit von Big Jim war endgültig vorbei. „Mit dem spiele ich jetzt nicht mehr“, sagte ich zu meinem ältesten Sandkastenkumpel Stefan, der die Osterferien über zu Besuch war. Stattdessen gingen wir zu den Teichen des Fischereivereins und zogen dort mit einfachen Angelschnüren und Haken jede Menge Forellen aus dem Wasser. Bis uns der Vereinsvorsteher auf die Schulter tippte. Er sah den Tatbestand des Schwarzfischens erfüllt, hielt uns mit seinem kläffenden Schäferhund in Schach und befahl mir, meinen Personalausweis zu holen, er wolle schließlich wissen, wen er vor sich habe. Der arme Stefan musste so lange als Faustpfand vor dem Köter ausharren und sich anbellen lassen. Zurück im Haus fragte mich meine Mutter, warum ich so aufgeregt sei und wofür ich meinen Ausweis bräuchte. Ziemlich kleinlaut für einen Gernegroß erzählte ich, was passiert war. Sie ließ mich die Geschichte alleine ausbaden. Im Büro des Vorstehers hinterließ ich meine Personalien und löste endlich meinen Kumpel aus. Eine Woche später bekamen wir einen Brief, in dem der Tathergang in allen Einzelheiten geschildert wurde. „Ihr Sohn Michael wurde mit seinem Komplizen Stefan E. auf frischer Tat beim Schwarzfischen (Fischwilderei) ertappt. Dieses Mal sehen wir von einer Anzeige noch ab und belegen Sie mit einem Bußgeld von 20 DM. Im Wiederholungsfall werden wir die Angelegenheit zur Anzeige bringen.“ Na dann, Petri Heil.
Als Christian seinen Segelschein machte, verbrachten wir beide fast jedes Wochenende auf dem See. Beim Fahren mit Außenbordmotor besteht die Kunst darin, das Boot sicher aus dem Liegeplatz zu steuern. Rückwärtsfahren geht nur bei Standgas, bei höherer Drehzahl besteht die Gefahr, dass der Motor durch die Fliehkraft aus der Verankerung geschleudert wird. Einen Führerschein macht man unter anderem darum, damit das nicht passiert. Was soll ich sagen, Christian passierte genau das. Viel zu schnell beschleunigte er von der Anlegestelle Richtung See. Um die Mädels im Undosabad mit einem coolen Bremsmanöver zu beeindrucken, drehte er den hochjaulenden Motor um, doch der plumpste wie ein Stein ins Wasser und versank etwa einhundert Meter vom Ufer entfernt in der Tiefe des Starnberger Sees. Ein Anfängerfehler. Uns beiden war sofort klar, dass wir die wahren Umstände des Malheurs der breiteren Öffentlichkeit vorenthalten wollten. Wie es sich für den kleinen Bruder gehörte, deckte ich Christian. Den Eltern gegenüber behaupteten wir, der Motor sei gestohlen worden. Warum ausgerechnet unser Uraltmodell, darauf konnten wir uns beim besten Willen keinen Reim machen. Schon um weitere Verdachtsmomente gegen uns auszuschließen, meldeten wir den Verlust des Motors der Polizei. Das Boot wurde inspiziert, die Motorkennung notiert, eine Diebstahlsmeldung aufgesetzt. Peter glaubte uns die Geschichte, aber Annemie blieb skeptisch. Irgendwas kam ihr merkwürdig vor. Wochen später klingelte das Telefon. Der Leiter der Werft meldete, der Motor sei gefunden worden, man habe ihn mit einem Magneten aus dem See bergen können, die Zahlenkennung stimme überein, wir könnten ihn abholen. Mit der Wahrheit rückten wir aber immer noch nicht raus, das verspätete Eingeständnis wäre zu peinlich gewesen. Erst Jahre später, als wir mal wieder bei einem Familienfest in feucht-fröhlicher Runde zusammensaßen, konnten Christian und ich unser „Hirschauer Stückl“ nicht mehr länger für uns behalten. Peter lachte am lautesten darüber.
Unsere Eltern mussten mit einigen Enttäuschungen dieser Art leben, was sie ohne großes pädagogisches Murren taten. Will heißen: Mit Erziehungsterror mussten wir nicht rechnen. Die Noten stimmten und der Charakter, alles in allem, schon auch. Wir beherzigten das alte Lausbuben-Credo: Je besser du in der Schule bist, desto mehr kannst du dir herausnehmen. Dabei fehlte es mir auch nie an einer gesunden Selbsteinschätzung. Noch in der Grundschule sagte ich einmal zu meiner Mutter: „Ich lerne für dieses Diktat nicht, ich kann das!“ Am Ende hatte ich keinen einzigen Fehler und nie wieder eine Diskussion mit ihr über meine schulischen Pflichten. Es gab auch keinen Grund dafür. Ich tat nur das Nötigste, aber Versetzungsgefahr bestand nie. Die Teuber-Jungs, die sich als „Gebrüder Fürchterlich“ einen Namen gemacht hatten, mochten im Odelzhausen-Maßstab gefürchtete Outlaws sein, in Wirklichkeit waren wir zwei ganz normale, vielleicht etwas wilde Burschen. Ein bisschen so wie in den Rosenmüller-Filmen: Wenn es allzu heimelig wurde, sorgten wir halt für ein bisschen Remmidemmi.
Auf dem Gymnasium, mit 15 Jahren, fing ich an zu rauchen. Zehn Kippen am Tag dürften es gewesen sein. Der Elternbeirat hatte den Eltern damals geraten, ihren Kindern daheim ein paar Zigaretten „zuzutrauen“, so hieß es damals, sonst würde man sie nur ganz vergraulen. Meine Eltern, beide überzeugte Nichtraucher, beherzigten die pädagogische Vorgabe und tolerierten unsere Glimmstengel, wenn auch unter Schmerzen. Für die Unter- und Mittelstufe herrschte allerdings auf dem gesamten Schulgelände ein strenges Rauchverbot, sogar in der Nähe der Schule war es verboten. Ich sah es nicht ein, diese, in meinen Augen unsinnige Regelung zu befolgen – Sie wissen schon, blinder Gehorsam und so – und steckte mir regelmäßig öffentlich eine Zigarette an. Allerdings immer außerhalb des Schulgeländes. Trotzdem wurde ein erster Verweis fällig, den ich noch achselzuckend hinnahm. Ich rauchte weiter, bis die Angelegenheit eskalierte. Es war der Lehrer Hintermeier, der sich persönlich von mir provoziert fühlte und mit einem Schulverweis drohte. Um ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen entgegnete ich ihm spontan, dass das gar nicht möglich sei, ich sei nämlich gar nicht Schüler des Effner, sondern von der Realschule gegenüber. Hintermeier war perplex. Er hatte mich nie persönlich im Unterricht gehabt, aber er kannte mich natürlich vom Sehen und wusste, dass ich log. Ihm brannten beinahe die Sicherungen durch und er forderte vom Rektor noch am selben Tag meinen Rauswurf. Als meine Eltern zwei Tage später zum finalen Showdown in die Schule zitiert wurden, weigerten sie sich vehement, mich von der Schule zu nehmen. Sie beriefen sich darauf, dass ich mich ihres Wissens nach nicht auf dem Schulgelände befunden hätte und deshalb nicht gegen das Verbot verstoßen hatte. Dieser Argumentation hatte der Schulleiter nichts entgegenzusetzen und am Ende des Gesprächs meinte er nur, wegen einer Zigarette fliege hier keiner von der Schule. Die nichtrauchenden Eltern verteidigten ihren Sohn mit rauchenden Colts gegen einen Willkürakt, der ihnen sauer aufstieß. Daheim bekam ich freilich den Anschiss meines noch jungen Lebens.
Die Pubertät machte nicht nur im Verhalten, sondern auch äußerlich einen neuen Menschen aus mir: Ich wurde Waver. Ich färbte mir die Haare schwarz, stylte sie mit Seife und Gel, malte mir Kajal unter die Augen, trug schwarze Klamotten, spitz zulaufende Creepers mit dicken Sohlen und enge Röhrenhosen, die meine Mutter immer noch ein bisschen enger nähte. Für die Odelzhausener waren zwei Marsmenschen im Dorf gelandet. Christian und ich hörten nicht Abba oder Phil Collins, wie die anderen, sondern Queen und vor allem The Cure.
Tennisspielen in der Sommerhitze fanden wir plötzlich doof, auf einem Segelboot im Starnberger See bei zwei, drei Windstärken herumcruisen dagegen lässig. Mein Vater hatte inzwischen ein größeres Boot gekauft. Die Pamich, eine Sunbeam S 22, übte eine magische Anziehungskraft auf uns aus. An den Wochenenden war die ganze Familie auf dem Boot, wir sonnten uns an Deck und schipperten über den See, und am Abend blieben Christian und ich oft allein an Bord. Wir stellten fest, dass Partys auf einer Yacht schon deshalb mehr Spaß machten, weil man die Mädchen dazu nicht groß überreden musste. Die Gäste waren illuster. Der Sohn einer Modeschöpferin war darunter, eine „Sport Scheck“-Tochter und ein Mädchen, das später Schauspielerin wurde. Starnberg eben. Unsere Eltern machten sich keine großen Gedanken darüber, auch wenn wir beide, immer noch nicht volljährig, allein unterwegs waren. Sie wussten ja, würden wir es zu bunt treiben und das Schiff versenken, würden sie auf alle Fälle über den Segelklub davon erfahren …
Um auch dieser Kontrollinstanz zu entgehen, bot sich bald eine reizvolle Alternative an: Willi, Annemies jüngerer Bruder und unser Lieblingsonkel, hatte eine Studentenbude in München, die so gut wie jedes Wochenende frei war. Er gab uns die Schlüssel, falls wir der Provinz entfliehen wollten. Unsere Eltern waren so ziemlich das Gegenteil von dem, was man heute Helikopter-Eltern nennt: Sie vertrauten uns. Gerade weil sie aus nächster Nähe miterlebten, wie wir als Jugendliche die grenzenlose Freiheit, die einem die Pubertät suggeriert und die man später als Erwachsener so nicht mehr haben kann, auslebten. Das ungeschriebene Elterngesetz im Hause Teuber war: Montag bis Freitag mussten wir „brav“ bleiben, damit wir es am Wochenende krachen lassen konnten. Aber um es klar zu sagen: Von München hätte uns ohnehin niemand abhalten können. Die Eltern brachten uns freitags nach der Schule zur S-Bahn-Haltestelle nach Pasing, von dort tauchten wir ein in die Welt, nach der wir uns sehnten. Zwei Jahre lang zogen wir durch Münchens Kneipen, Clubs und Discotheken. Gewöhnlich glühten wir am Freitagnachmittag im Café Reitschule am Englischen Garten vor, früh am nächsten Morgen endete es meist im Mirage, eine Disse ganz in der Nähe der Kammerspiele. Tagsüber schauten wir im Robot an der Münchner Freiheit vorbei, einem Kultladen für englische New-Wave-Klamotten. Christian und ich wollten zur Avantgarde gehören und waren modisch mutiger als viele Münchner. Immer wenn wir durch die Tür traten, begrüßte uns der Chef des Robot mit den Worten: „Das sind sie ja wieder, die beiden verrücktesten Typen von allen.“
Auf einer unserer München-Touren wurden wir in der Reitschule von einem Fotografen angesprochen. Die Bravo suchte für eine Modeserie noch „Typen, die uns auffallen“. Sie fragten, ob wir nicht Lust hätten, uns fotografieren zu lassen. Hatten wir natürlich. Bravo war begeistert von unserem Look und brachte eine Doppelseite über unsere „Elektroschock-Frisuren“, die wir „in Heimarbeit mit Wasserstoffsuperoxid (Vorsicht, nicht ganz ungefährlich)“ bleichten, so schrieb das Magazin 1985 unter der Überschrift „Kriegt Ihr Ärger, wenn Ihr so rumlauft?“ über uns. Die Frage erübrigte sich insofern, als unsere Mutter, wie gesagt, unsere Hosen persönlich enger nähte und wir ihrem und Omas Silberschmuck und Ohrringen zu neuem Glanz verhalfen. Als ich dann auch noch mit wild gestylten Haaren von einer Anzeige für ein angesagtes Haargel von der letzte Seite der Popcorn lächelte, raufte sich der ein oder andere Mitbürger in Odelzhausen sicherlich die Haare, in welche Schublade man den Teuber Michi stecken soll? Aber ganz ehrlich – mich kümmerte das nicht!
Meine Antwort auf die provinzielle Enge war die Weite des Meeres, das Surfen. Die Begeisterung der Dorfjugend für das Fußballspielen konnte ich nicht teilen. Fußball, das waren für mich 22 Typen, die einem Ball hinterherrannten. Die Sinnhaftigkeit davon, bei Starkwind über den Gardasee zu heizen, stellte ich dagegen nie in Frage. Tempo, Adrenalin, Gänsehaut, die aufgestellten Härchen an den Armen, muss man das erklären? Das Ziel: Die „Schweinebucht“, der Surfer-Hotspot am Gardasee, zwischen Riva und Limone gelegen. Viele Male waren Christian und ich gemeinsam dort, ein wichtiges Ritual unter uns Brüdern. Pfingsten im Jahr vor dem Unfall zum letzten Mal. Mutter lieh uns ihren R4, und hätten wir uns nicht dabei fotografieren lassen, hätten unsere Eltern auch nie etwas davon mitbekommen, dass wir den letzten Schultag vor den Ferien schwänzten. Bereits früh morgens fuhren wir los in Richtung Italien. Man könnte sagen, perfekt geplant, wären wir nur nicht kurz vor der Garmischer Autobahn an einer roten Ampel geblitzt worden, mit dem Ergebnis, dass unsere Mutter bald darauf ein entsprechend datiertes unscharfes Schwarz-Weiß-Foto von ihren beiden Jungs zugeschickt bekam. Shit happens!
Am Gardasee angekommen, fanden wir wie geplant einen Parkplatz direkt an der Bucht, den wir die ganzen zwei Wochen nicht mehr hergaben. Alle guten Surfer waren dort, die meisten deutlich älter als wir. Ich war gerade mal volljährig. Bei den Anfängern in Torbole herumzueiern, kam für uns nicht in Frage. Wir hingen mit den krassen Typen ab, die aus 15 Meter Höhe von Felsvorsprüngen in den See sprangen, und taten es ihnen gleich. Abends ging es ins Cutty Sark oder ins Moby Dick, den beiden wichtigsten Surfbars. Weil wir unseren Parkplatz nicht aufgeben wollten, trampten wir den Weg nach Torbole, und weil zwei Typen selten gemeinsam mitgenommen werden, kam es schon mal vor, dass es mal der eine, mal der andere nach einem ausschweifenden Abend erst am nächsten Tag wieder zurück zur Bucht schaffte. Es kann aber auch an dem einen oder anderen weiblichen Wesen gelegen haben.
Mit 15 ging es bei mir so allmählich los mit den Mädels. Das Boot des Vaters war sicher ein Lockmittel, aber die ersten erfolgreichen Kontaktversuche fanden im Familienurlaub auf Sardinien statt. In einem Surferspot südlich von Olbia, in unmittelbarer Nähe unserer Bungalowsiedlung, gab es eine Disko mit sehr vielen, sehr hübschen Mädchen. Die allererste Geilheit meines Lebens. Eine davon hatte es mir angetan, ein Flirren in der Magengegend, ein Flirt, mehr war es noch nicht. Einige Mädchen erkannten mich aus der Bravo, was meiner nervösen Jungmännlichkeit schmeichelte. Der Artikel erhöhte meine Chancen erheblich, aber es war Christian, der einen echten Schlag bei den Frauen hatte. Wenn bei unseren Streifzügen durch München etwas lief, schickte er mich regelmäßig vor die Tür. Nur selten war es umgekehrt. Anders an der Schweinebucht am Gardasee: Da wir beide im Auto schliefen, kam es schon mal vor, dass wir zu viert auf engstem Raum herumfummelten. Ich betrachtete mich als sein Juniorpartner, der sich in puncto Mädchen-beeindrucken noch einiges abschauen konnte. Ein ums andere Mal dachte ich mir: „Mann, der Chrisi ist echt aus einem anderen Holz geschnitzt.“ Nie im Leben hätte ich damals gedacht, dass unser brüderliches Verhältnis einmal so Schiffbruch erleiden würde.