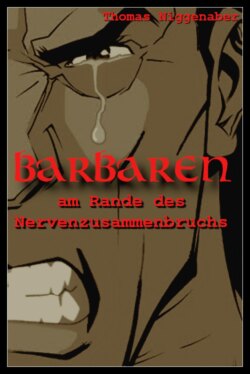Читать книгу Barbaren am Rande des Nervenzusammenbruchs - Thomas Niggenaber - Страница 5
Оглавление4
Storne Stahlhand schlief nicht gut in dieser Nacht.
In normalen Nächten suchten ihn im Schlaf oft die Geister der vielen Verstorbenen heim, die er im Kampf erschlagen hatte. In Scharen erschienen sie in seinen Träumen: Bleiche, verstümmelte Schreckgestalten mit verwesenden Leibern, die ihre verrottenden Finger als stumme Anklage auf ihn richteten. Sie forderten Vergeltung für seine Taten, schweigend, doch die eingefallenen, lippenlosen Münder zu lautlosen Schreien verzerrt. Ihre toten Augen sahen ihn anklagend an und ihr Hass erfüllte die Luft wie ein Geruch, der sogar den Gestank von Fäulnis und Verwesung überdeckte.
Doch in dieser Nacht war es anders – in dieser Nacht träumte er schlecht.
Wie es bei Albträumen oft der Fall ist, fing auch dieser recht harmlos an. Es war helllichter Tag und Storne stand wieder vor der Rauschhöhle, in der Zorm der Zerfetzer versehentlich sein unrühmliches Ende gefunden hatte. Das schwere Tor war geschlossen und weder der Druide noch sonst irgendjemand war außer dem König zugegen.
Seltsamerweise war es diesem bewusst, dass er sich in einem Traum befand. Aus diesem Grund überraschte es ihn auch nicht, dass sich das Tor plötzlich und ohne sein Zutun öffnete, obwohl es ja eigentlich nur mithilfe des großen Handrads nach oben gezogen werden konnte. Als es vollständig geöffnet war, trat ein ziemlich angefressen aussehender Zorm aus der Höhle heraus – wobei angefressen nicht seinen Gemütszustand beschreiben soll. Ihm fehlten tatsächlich ein paar große Stücke seiner Oberschenkel, seiner Arme und seines Oberkörpers. Letzterer war stellenweise sogar bis zu den Knochen abgenagt, was dem Aussehen des blonden Barbaren natürlich ziemlich abträglich war. Dass seine Verletzungen noch frisch waren und sein Blut daraus in dicken, zähen Tropfen zu Boden fiel, steigerte das Grauen seines Anblicks zudem erheblich.
Bis hierher verlief dieser Traum also nach dem üblichen Muster, wie Storne unbeeindruckt und etwas gelangweilt feststellte.
Dann jedoch begann die Angelegenheit unangenehm zu werden. Statt der gewohnt anklagenden und hasserfüllten Blicke erschien in den Augen Zorms ein Ausdruck abartiger Güte und Barmherzigkeit. Die klaffenden Wunden schlossen sich und neues Fleisch wuchs in den herausgerissenen Stellen. Bald schon sah der Zerfetzer wieder aus, als hätte sich nie ein Raubtier mit ihm den Bauch vollgeschlagen. Widerlich nett und aufrichtig lächelnd streckte er dem König seine Hände entgegen.
»Hab keine Furcht«, säuselte er so milde, dass es Storne beinahe den Magen umdrehte. »Ich verzeihe dir! Dein Handeln war geprägt von der Unwissenheit und den falschen Doktrinen, denen unser Volk schon seit Urzeiten ausgesetzt ist. Wie soll man dir da einen Vorwurf machen können?«
»Na toll!« Der König verschränkte die Arme vor der Brust und beäugte den Auferstandenen voller Hohn. »Selbst im Tod laberst du noch daher, als wenn du nicht alle Latten am Zaun hättest. Kannst du dich nicht wenigstens im Jenseits wie ein anständiger Barbar verhalten? Ob du mir verzeihst oder bei den Zwergen ein Fass Met umkippt, ist mir gleichermaßen schnurz. Ich habe das Richtige getan – nämlich einen Spinner wie dich unschädlich zu machen. Das mit dem Säbelzahntiger war ein Versehen, so was kann halt mal passieren. Hast du die Bestie wenigstens dafür gekillt, dass sie dich gefressen hat?«
»Aber natürlich nicht!« Zorm hielt seinen pervers freundlichen Gesichtsausdruck weiterhin aufrecht. »Wie hätte ich dieses Wesen denn töten sollen? Bevor ich überhaupt begreifen konnte, was los war, hatte es seine Zähne schon vollständig in mir vergraben. Und in diesem Traum kommt das Tier auch überhaupt nicht vor, da es keinerlei Relevanz hat. Aber selbst wenn es hier existieren würde, täte ich ihm kein Leid an. Es ist doch auch nur seinen Instinkten gefolgt. Wahrscheinlich würde ich meinen Frieden mit ihm schließen, so wie ich diesen auch mit dir schließen möchte. Aus Vergebung sind die Steine geformt, mit denen wir die Straße zum Frieden pflastern.«
»Ich glaub, ich kotze gleich!« Überrascht stellte Storne fest, dass er selbst im Schlaf einen Brechreiz empfinden konnte. »Was ist eigentlich der Sinn dieses bekloppten Traums? Soll er mir einfach nur auf die Nüsse gehen oder hält er auch noch irgendwelche nützlichen Informationen für mich bereit?«
»Er soll dir vor Augen führen, wie es sein könnte, wenn wir alle unserer barbarischen Natur abschwören und neuen, revolutionären Ideen eine Chance geben würden.« Die Traumgestalt schritt an Storne vorbei. »Komm mit mir, ich zeige es dir.«
Der König zögerte. Schon jetzt jagte ihm dieser Traum eine Heidenangst ein und er wollte eigentlich gar nicht wissen, wie sich dieser noch entwickeln würde. Da es ihm aber partout nicht gelingen wollte aufzuwachen und sich ein wahrer Barbar unter keinen Umständen von Furcht beeinflussen ließ, folgte er dem Zerfetzer.
Dieser führte ihn ins Dorf, das in den Augen Stornes eine grauenhafte Veränderung durchgemacht hatte. Nicht eine Behausung sah noch so aus, wie es der König gewohnt war und wie es schon seit Jahrhunderten der Barbaren-Tradition entsprach. Die vertrauten Hüttenwände aus groben Holzstämmen waren seltsam glatten Wänden gewichen, die man mit viel Sorgfalt verputzt und angestrichen hatte. Nahezu jede Hütte erstrahlte in einer anderen freundlichen, hellen Farbe und all diese Farben verursachten tief empfundene Abscheu in Storne. Als ebenso grauenerregend empfand er die vielen bunten Blumen, die vor fast jedem Hütteneingang wuchsen. Anscheinend gab es wirklich Dorfbewohner, die ihre Zeit mit dem Heranziehen dieses überflüssigen Unkrauts verschwendeten. Warum vernunftbegabte Wesen etwas derart Blödsinniges taten, das konnte sich der König beim besten Willen nicht erklären. Die allgegenwärtige Harmonie, die dieser Ort ausstrahlte, verursachte zudem ein starkes Gefühl der Entfremdung in ihm. Dies war nicht mehr das Dorf, in dem er geboren und aufgewachsen war. Hier fühlte er sich ganz und gar nicht mehr heimisch und wohl.
Aber auch die Einwohner des Barbarendorfs hatten sich verändert. Ohne dass es jemand zu stören schien, tollten die Kinder lachend und spielend umher, obwohl sie sich doch eigentlich im bewaffneten Zweikampf hätten messen oder sich der Körperertüchtigung hätten widmen sollen. Die Frauen standen tratschend und kichernd in kleinen Gruppen zusammen, statt sich um die Wunden ihrer Männer zu kümmern oder in anderer Form für deren leibliches Wohl zu sorgen. Selbst dieses unverschämte Verhalten fand keinerlei Widerspruch und wurde anstandslos geduldet.
Für blankes Entsetzen in Storne sorgte letztendlich der Umstand, dass alle männlichen Barbaren ohne Waffen herumliefen und sie außerordentlich seltsam gekleidet waren. Sie trugen bunte Kleidung aus dickem Leinen, die fast ihre ganzen Körper verdeckte. Ihre massigen, beeindruckenden Muskeln konnte man so überhaupt nicht sehen.
All das verstörte den König sehr. Er fühlte sich überfordert, kaum noch in der Lage, diesen fürchterlichen Traum noch länger ertragen zu können. Doch sein Begleiter, der Zerfetzer, zeigte kein Erbarmen. Fröhlich winkend rief er eine der Dorfbewohnerinnen herbei, die ihren Weg durch das Dorf zufällig kreuzte. Leise stöhnend stellte Storne fest, dass es sich bei dieser um Froengi handelte.
Die Mittdreißigerin trug ein farbenfrohes Kleid und hatte es tatsächlich gewagt, sich Schminke in ihr altes, verbrauchtes Gesicht zu schmieren. Darüber hinaus zeigte ihr Gebaren keinerlei Respekt oder Unterwürfigkeit, sondern nur ein geradezu empörendes Selbstbewusstsein.
»Froengi, meine Teuerste!«, begrüßte Zorm die Greisin. »Erzähle uns doch ein wenig über das Leben hier im Dorf!«
»Oh, es ist einfach wunderbar«, frohlockte Froengi. Ihr Lächeln war dabei so strahlend und jugendlich, als hätte sie ihre besten Jahre nicht schon längst hinter sich gelassen. »Wir alle leben hier in vollkommener Eintracht und Zufriedenheit – frei und ohne Sorgen. Wir machen nur, was uns gefällt, wobei wir einander stets achten und respektieren. Es gibt keine Waffen, keine Gewalt und keine Kämpfe mehr. Da alle anderen Rassen und Völker Archainos ebenfalls den Pfad der Gewaltlosigkeit gewählt haben, gibt es auch keine Kriege mehr. Wir leben in einer Welt des Friedens und der Liebe, in der jedes Wesen auf seine Art glücklich werden kann.«
Storne Stahlhand verspürte ein leichtes Schwindelgefühl. Alles um ihn herum schien sich zu verändern. Die Umgebung verschwamm, sie wurde unscharf wie eine Spiegelung in unklarem Wasser und die Menschen wurden mehr und mehr zu geisterhaften Schatten. Möglicherweise war dies ein Anzeichen dafür, dass sich sein Traum dem Ende neigte – so hoffte er zumindest. Vielleicht war es aber auch nur die Reaktion seines Verstandes auf diesen kolossalen Schwachsinn, den das alte Weib da von sich gegeben hatte.
»Wer ist euer König?«, wollte er wissen. »Wer lässt es zu, dass dieser ganze Unfug hier geschieht? Bin ich etwa noch euer Herrscher?«
Froengi sah ihn mitleidig und ein wenig amüsiert an. Storne nahm dies wie durch einen Schleier wahr.
»Aber nein«, sagte sie. »Wir haben gar keinen König mehr. Wir entscheiden alle gemeinsam über die Belange des Stammes. Wenn eine wichtige Entscheidung ansteht, versammeln wir uns alle im Langhaus und stimmen darüber ab. Jede Stimme zählt dabei gleich viel. Wir nennen das Demokratie.«
Storne hatte genug. Er wollte nicht länger in dieser abstrusen Traumwelt verweilen. Seine rechte Hand fand ihren Weg in sein Haar, während er ächzend sein Haupt senkte. Erst als er so an sich herabsah, bemerkte er, dass auch er diese seltsame Kleidung aus Leinen trug, welche die Pracht seines famosen Leibes vollständig verbarg. Dann fiel sein Blick dorthin, wo sich eigentlich seine stahlharten, völlig fettfreien Bauchmuskeln befinden sollten. Eine beachtliche Wampe wölbte nun dort den groben Stoff.
Schweißnass und schreiend erwachte Storne Stahlhand aus seinem Traum. Sein Herz schlug wie eine Kriegstrommel und er keuchte, als hätte er gerade einen Oger huckepack durch den Wald getragen. Die seltsamen Äußerungen Froengis und Zorms schwirrten noch durch seinen benommenen Verstand. Es beunruhigte ihn sehr, dass nun auch schon sein Unterbewusstsein damit anfing, sich alberne, neue Wörter auszudenken. Das noch immer vor seinem inneren Auge präsente Bild seines verunstalteten Körpers beunruhigte ihn jedoch wesentlich mehr.
»Nun krieg dich mal wieder ein, du elende Memme«, maßregelte er sich selbst. »Was bist du, ein Barbar oder ein verängstigter Säugling? Das war nur ein Traum, ein öder, blöder Traum.«
Um sich gänzlich von der Richtigkeit dieser Aussage zu überzeugen, strich er sich mit der Hand behutsam über seine Körpermitte. Die steinharten, deutlich herausragenden Erhebungen, über die seine Fingerspitzen dabei glitten, ließen ihn erleichtert aufatmen.
Danach erhob er sich von seinem Bett, einem mit Tierfellen bedeckten Gestell, das aus dicken, mit Lederriemen zusammengebundenen Ästen bestand. Obwohl es sich um die Hütte des Königs handelte, war auch die übrige Einrichtung dieser Unterkunft eher schlichter und rein zweckmäßiger Natur. Unnötiger Zierrat und Gerümpel waren jedem Barbaren ein Graus. Neben dem Bett gab es lediglich einen Tisch mit vier Stühlen, ein paar Truhen, einen aus groben Steinen gemauerten Kamin und eine Vielzahl von Waffen, die mit Haken an der Wand befestigt waren. Da in dem Kamin kein Feuer brannte, war das kleine Fenster der Hütte zurzeit die einzige Lichtquelle. Doch auch diese war momentan wenig ergiebig, da es – anders als in Stornes Traum – noch tiefste Nacht war. Die herrschende Finsternis hielt den König jedoch nicht davon ab, die Tür seiner Behausung zu öffnen und einen kurzen Blick hinaus zu werfen.
Das Dorf lag ruhig und so wie er es kannte vor ihm. Keine farbenfrohen Hütten oder bunten Blumen beleidigten sein Auge. Wieder entrang sich seinem Brustkorb ein erleichtertes Seufzen. Er schloss die Tür, ging zu seinem Bett und legte sich beruhigt darauf nieder. Nach nur wenigen Augenblicken fiel er wieder in einen tiefen, diesmal traumlosen Schlaf.
Nach seinem Empfinden waren erst wenige Minuten vergangen, als ihn ein lautes, unbekanntes Geräusch erneut aus dem Schlaf riss. Es war ein durchdringendes, schräges Tröten, wie er es noch nie zuvor vernommen hatte und das ihn erschrocken hochfahren ließ. Die Sonnenstrahlen, die durch das Fenster drangen, widerlegten seine Vermutung bezüglich der Dauer seines Schlafes, was ihm jedoch einerlei war.
Ihn erfasste eine unbändige Wut auf den Verursacher dieses infernalischen Lärms, der nun ohne Unterlass seine Trommelfelle drangsalierte. Keinem Dorfbewohner war das Verursachen lauter Geräusche gestattet, bevor der König aus seinem hoheitlichen Schlummer erwacht war. Dieser Krach stellte somit auch einen ungeheuerlichen Affront und eine Missachtung seiner Autorität dar.
Wie ein wilder Stier, die Zornesröte im Gesicht und der Raserei nahe, stürmte Storne deshalb aus seiner Hütte. Dass er barfuß war und noch seinen Schlaf-Lendenschurz trug, bemerkte er dabei gar nicht. Ihn trieb nur noch das Bestreben, den Ruhestörer rasch ausfindig zu machen und dem Krawall ein Ende zu bereiten.
Recht schnell entdeckte er den Störenfried neben dem Dorfbrunnen. Es war kein Angehöriger des Stammes, es war noch nicht mal ein Barbar. Ein ziemlich mickrig aussehendes Kerlchen stand da, fremdartig bekleidet mit hohen Stiefeln, einer knielangen, weißen Tunika und einem blauen Wappenrock darüber. Das Wappen auf seinem Rock zeigte einen aufrecht stehenden, weißen Löwen. Eine ebenso weiße, lange Feder zierte die alberne Mütze auf dem Kopf des Fremden.
An seine Lippen presste er ein seltsames, goldfarbenes Musikinstrument. Es bestand aus einer langen, mehrfach gewundenen Röhre, die in einer trichterförmigen Öffnung endete. An die Kriegshörner der Barbaren erinnerte dieses Ding den König, nur dass es nicht aus dem Horn eines Tieres gemacht war, sondern aus Metall.
Voller Inbrunst, die Backen aufgebläht wie die Schallblasen eines Frosches, blies der Unbekannte in sein Musikinstrument. Die drohende Gefahr, die sich ihm in Form eines wutschnaubenden Barbaren näherte, bemerkte er deshalb zunächst nicht.
»He, du Torfnase!«, brüllte Storne dem Radaubruder entgegen. Er hatte mittlerweile einen Grad der Entrüstung erreicht, der ihn jegliche Zurückhaltung vergessen ließ. »Bist du des Lebens überdrüssig oder einfach nur total behämmert?«
Blitzschnell hatte er den Fremden erreicht und ebenso blitzschnell riss er ihm seine seltsame Tröte aus den Händen. Ohne irgendwelche Erklärungen des Unbekannten abzuwarten, begann er, mit diesem Instrument auf selbigen einzuprügeln.
»Ich werde dir zeigen, welche Folgen es hat, den Schlaf eines Barbarenkönigs zu stören!«, schnaubte er dabei voller Wut.
Dass der Fremde nicht dem Volk der Barbaren angehörte, das zeigte sich alleine schon daran, dass er bereits nach fünf Schlägen zu Boden ging. Dort blieb er um Gnade winselnd liegen, zusammengerollt wie ein Ungeborenes im Leib der Mutter. Seine Arme legte er zudem schützend um seinen Kopf und jeder Schlag entlockte ihm ein mitleiderregendes Jaulen.
Dies hielt Storne natürlich nicht davon ab, weiterhin mit dem Blasinstrument auf ihn einzudreschen. Selbiges verlor zusehends seine ursprüngliche Form und verwandelte sich in ein zerbeultes, verbogenes Stück Blech.
»Kommst einfach in mein Dorf und röhrst hier herum wie ein besoffener Elch«, schimpfte der König unterdessen weiter. »Dafür versohle ich dir dermaßen den Arsch, dass dir allein der Gedanke an diese unsagbar dämliche Tat schon unendliche Schmerzen bereiten wird.«
Ein lautes Räuspern ließ ihn innehalten, während er zu einem weiteren Schlag ausholte.
»Verzeiht bitte«, erklang eine ihm unbekannte Stimme. »Könntet Ihr eventuell davon Abstand nehmen, unserem Herold sämtliche Knochen im Leib zu brechen? Wir wären Euch dafür überaus dankbar.«
Storne ließ von seinem kläglich jammernden Opfer ab und sah nach oben. Erst jetzt bemerkte er die zwei Reiter, die etwas verstört von ihren prächtigen Rössern auf ihn herabsahen. In seiner blinden Rage hatte er die beiden Fremdlinge glatt übersehen. Dass sich inzwischen auch eine Schar neugieriger Dorfbewohner angelockt von all dem Lärm um den Brunnen herum versammelt hatte, war ihm ebenfalls entgangen. Er ließ deshalb das zweckentfremdete Musikinstrument neben dem schluchzenden Häufchen Elend zu Boden fallen. Nur ungern wollte er den Eindruck erwecken, cholerisch oder jähzornig zu sein.
»Ich danke Euch!«, sprach der Besitzer der unbekannten Stimme weiter. Er war ein wohl recht alter Mann, der ein burgunderrotes, sehr kostbar aussehendes Gewand trug. Sein langes Haar und sein ebenfalls langer Bart waren so weiß wie das Fell der hochgewachsenen, edlen Stute, auf deren Rücken er saß.
Der Bursche zu seiner Linken hingegen saß auf einem pechschwarzen Hengst und trug eine beeindruckende, mit Gold reich verzierte, stählerne Plattenrüstung, die seinen Leib vollständig verbarg. Auch das Visier seines mit Federn geschmückten Helms war geschlossen, sodass Storne nur ein Paar grüngraue Augen erkennen konnte. Bewaffnet war dieser Krieger mit einem imposanten Zweihandschwert, das neben ihm an seinem Sattel hing. Sein weißhaariger Begleiter trug indes nur einen langen Stab bei sich, dessen Spitze ein rot schimmernder Kristall zierte.
Neben den beiden Reitern stand ein drittes Pferd, das offensichtlich dem glücklosen Musiker gehörte, der noch immer klagend auf dem Boden herumlag.
»Ihr müsst unserem Herold verzeihen«, bat der Alte. »Er hat lediglich unser Eintreffen in diesem Dorf verkündet, so wie es seinen Pflichten entspricht.«
»Aha, seinen Pflichten ist er also nachgekommen«, sinnierte Storne, während er die langen, aufwendig gemusterten Schabracken betrachtete, mit denen die drei Pferde bedeckt waren. »Von denen hättet Ihr ihn lieber zeitweise befreien sollen. Es gehört sich nämlich nicht, vor Tagesanbruch ein solches Trara zu veranstalten.«
»Aber die Sonne steht bereits hoch am Himmel, guter Mann«, lautete der berechtigte Einwand des weißhaarigen Reiters.
Storne richtete sich zu seiner vollen Größe auf. »Hierzulande beginnt ein Tag, wenn ich es sage!« Er ließ seine Brustmuskeln ein paar Mal eindrucksvoll zucken. »Denn ich bin Storne Stahlhand, Herrscher der Nordland-Barbaren. Mein Wort gilt hier mehr als der Lauf irgendwelcher Sonnen!« Etwas argwöhnisch musterte er seine zwei Besucher. »Und mit wem spreche ich?«
»Ich bin Teophus Teodaphalus, Erzmagier am Hofe König Ludebrechts«, stellte sich der Alte vor. »Mein Begleiter ist der ehrenwerte Hohlefried von Ömmerbaum, Paladin im Dienste seiner Majestät und Offizier der Palastwache. Wir kommen aus Loewenehr, der Hauptstadt Adlreichs – falls Euch das etwas sagt.«
»Natürlich sagt mir das etwas!«, erwiderte Storne etwas brüskiert. »Haltet Ihr mich etwa für ungebildet? Jeder kennt Adlreich, das Land der Zauberer und der edlen Ritter, bedeutendste Nation der menschlichen Rasse und Heimat der sogenannten zivilisierten Menschen. Aber Adlreich liegt auch sehr, sehr weit im Osten, deshalb frage ich mich, was Euch so weit in den Westen führt.«
»Eine außerordentlich ernsthafte und dringliche Angelegenheit«, mischte sich nun der Paladin in die Unterhaltung ein. Der Helm auf seinem Kopf verlieh seiner Stimme einen Klang, als würde er durch ein Ofenrohr sprechen. »Wir sind in der Tat sehr weit geritten in der Hoffnung, diese mit Euch besprechen zu können. Hier scheint mir jedoch nicht der geeignete Ort für eine solche Unterredung zu sein.«
Storne sah sich um und umgehend schloss er sich der Meinung des Blechkameraden an. Der Dorfbrunnen, umringt von einfachen Stammesmitgliedern, war wirklich nicht der passende Ort für eine königliche Audienz.
»Nun gut«, sagte er deshalb. »Ich lasse Euch in den Thronsaal bringen.« Er warf einen Blick auf den Leidtragenden seines überstandenen Wutanfalls. Dieser schien sich aus eigener Kraft nicht mehr erheben zu können. »Und verzeiht mir bitte, wenn ich vielleicht ein wenig überreagiert habe.«
»Ein wenig überreagiert?«, fragte der Herold mit weinerlicher Stimme. »Ihr habt mir, glaube ich, einige Rippen gebrochen. Mein linkes Ohr ist taub und meine Beine spüre ich auch nicht mehr. All die Prellungen und blauen Flecken will ich gar nicht erst erwähnen.«
Storne sah verächtlich auf ihn herab. »Kann es sein, dass Ihr recht wehleidig seid? Aber seis drum, man wird sich um Euch kümmern.«
Er winkte einen jungen Burschen zu sich, der untätig in seiner Nähe stand. »Du da, geh und such den Druiden. Der alte Zausel treibt sich wahrscheinlich irgendwo im Wald herum und sucht Kräuter für seine Tränke. Sag ihm, dass wir Gäste haben, es aber einen kleinen Zwischenfall gegeben hat und er sich deshalb ein paar unbedeutende Kratzer anschauen muss. Danach soll er unsere Besucher ins Langhaus führen und ihnen etwas Met bringen.«
Er sah an sich herab und wurde sich peinlich berührt seiner Nachtkleidung bewusst. »Äh … und ich sollte mich wohl in der Zwischenzeit umziehen.«
Alles geschah, wie es der König befohlen hatte und nur wenig später fand die Zusammenkunft im königlichen Langhaus statt. Storne – nun vollständig und korrekt gekleidet – saß natürlich auf dem Schädelthron. Seine Stiefel hatte er angezogen und seinen Lendenschurz für die Nacht hatte er gegen jenen getauscht, den er am Tag zu tragen pflegte.
Grahlum der Greise hatte sich derweil um die Wehwehchen des Herolds gekümmert. Dass sich dieser aufgrund seiner geringfügigen Blessuren außerstande sah, an der Unterredung teilzunehmen und lieber in einem Krankenbett herumlag, entzog sich gänzlich Stornes Verständnis. Doch die Gegenwart dieses Jammerlappens war ohnehin nicht vonnöten, so lautete zumindest die Meinung der anderen Besucher.
»Zunächst einmal möchte ich unsere Gäste formell und unserer Tradition entsprechend begrüßen«, verkündete der König. Dann erhob er sein Trinkhorn, das bis zum Rand mit goldgelbem Met gefüllt war. »Also, auf Euer Wohl – mögen Eure Klingen immer scharf und Eure Kämpfe immer blutig sein!«
Die drei anderen Anwesenden, die sich nahe beim Thron an der Tafel niedergelassen hatten, taten es ihm gleich. Während sich König, Druide und Magier nun einen kräftigen Schluck des Honigweines gönnten, schlug sich der Paladin das Trinkhorn vor sein noch immer geschlossenes Visier. Das leise Scheppern und sein lautes Fluchen wurden amüsiert zur Kenntnis genommen.
»Verzeihung!«, murmelte er verlegen, dann öffnete er das nun feuchte und klebrige Visier hastig.
Er gab somit den Blick auf ein Gesicht frei, das in den Augen der anwesenden Barbaren noch ziemlich jung und unerfahren wirkte. Als Milchgesicht hätten sie es wohl treffenderweise bezeichnet.
»Welchem Umstand verdanken wir also die Ehre Eures Besuches?«, wollte Storne nun endlich wissen.
Er lehnte sich in seinen Thron zurück und tat so, als würde er sich wohlfühlen. Tatsächlich fühlte er sich mal wieder so, als würde er auf einem Haufen spitzer Felsbrocken sitzen.
»Wir sind auf der Suche nach einem äußerst gefährlichen Wesen, das sich hier in Euren Gefilden herumtreibt«, erklärte der weißhaarige Magier. »Es handelt sich dabei um einen Vampir – genauer gesagt um einen Vampirlord. Dieser Blutsauger hat sein Unwesen über mehrere Wochen hinweg in Loewenehr getrieben. Einige junge Frauen hat er dort entführt, zumeist Angehörige niederer Stände. Anfangs sind wir uns der Ernsthaftigkeit dieser Umtriebe gar nicht bewusst gewesen. Die Stadtwache hat nach den vermissten Mädchen gesucht, so wie sie es immer tut, wenn irgendwelche Personen verschwinden. Dann hat es dieser Lump jedoch zu weit getrieben und dabei hat er einen großen Fehler gemacht – er hat Sielrud entführt, die Braut König Ludebrechts. Da sie zudem meine Nichte ist, habe ich natürlich sofort selbst die Nachforschungen übernommen. Sehr schnell habe ich herausfinden können, mit was für einer Kreatur wir es zu tun haben.«
»Eure Nichte?«, fragte Grahlum der Greise. »Das ist wahrhaft tragisch.« Trotz der Kapuze auf seinem Kopf konnte man es ihm ansehen, wie sehr ihn die Ausführungen des Magiers faszinierten. »Verzeiht mir meine Unwissenheit, doch ich hatte es bislang noch nie mit einem Vampir zu tun. Bei uns in den Wäldern rennen nur ein paar Werwölfe und einige Ghule herum. Hat dieser Unhold den Mädchen das Blut ausgesaugt oder sie gar zu seinesgleichen gemacht?«
Der Erzmagier hob die Schultern und seufzte traurig, was angesichts seiner familiären Beziehung zu einem der Opfer auch verständlich war. »Das kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Vielleicht hat er auch nur mental Besitz von ihnen ergriffen. Ihr müsst wissen, dass Vampire über eine mächtige, unheilvolle Kraft verfügen. Diese gestattet es ihnen, Macht über den Willen anderer zu erlangen. Wir nennen das Hypnose und es ist eine Art dunkler Magie, mit der sie sich jedes sterbliche Wesen gefügig machen können. So bin ich letztendlich ja auch darauf gekommen, dass es sich bei dem Übeltäter nur um einen Lord der Vampire handeln kann. Vampirlords können nämlich so mächtig sein, dass allein schon ihre Anwesenheit den Verstand der Wesen um sie herum korrumpiert. Mir ist damals das seltsame Verhalten einiger Stadtbewohner aufgefallen – sie sind irgendwie nicht mehr sie selbst gewesen, haben merkwürdige Dinge gemacht und wirres Zeug geredet.«
»Wartet!«, rief der Druide aufgeregt. »Sagtet Ihr gerade, die Leute hätten sich verändert? In ihrer Persönlichkeit und so?« Er wandte sich dem König zu. »Storne, hörst du das?«
Erwartungsvoll sah er den Herrscher der Nordland-Barbaren an. Doch dieser hatte nur mit halbem Ohr zugehört. Er war damit beschäftigt, sein Körpergewicht von der einen Gesäßhälfte auf die andere zu verlagern. Die Notwendigkeit, seinem Thron mehr Komfort zu verleihen, wurde ihm wieder mal auf schmerzhafte Art bewusst. Vielleicht mit einem dickeren Sitzpolster oder durch das Abschleifen der Schädelkuppen, so überlegte er es sich.
»Storne!«, rief Grahlum ungeduldig. »Hörst du denn nicht?«
»Doch, doch«, erwiderte der schwarzhaarige Barbar geistesabwesend. »Vampir, entführte Mädchen, irgendwelche Leute, die sich verändern.«
Der Greise stöhnte entnervt auf. »Ach, und das erinnert dich nicht an diverse Vorfälle hier bei uns? An einen gewissen Zorm vielleicht, der keine Lust mehr hatte zu kämpfen? Oder an die Burschen, die deine Königswürde infrage gestellt haben und wegen denen der Feldzug gegen die Amazonen abgesagt wurde?«
Nun wurde auch Storne hellhörig. Obwohl es eine Wohltat für seine gepeinigte Kehrseite darstellte, sprang er aus einem ganz anderen Grund von seinem Thron auf. Er griff sich einen Hocker und setzte sich zu den anderen an die Tafel.
»Natürlich! Der Druide hat recht«, erklärte er hektisch. »Auch bei uns ereignen sich höchst mysteriöse Dinge. Ein paar meiner Männer benehmen sich in letzter Zeit nicht mehr wie anständige Barbaren. Sie nehmen widerliche Worte wie Vergebung, Gewaltlosigkeit oder gar Frieden in den Mund. Manchmal lassen sie sich auch völlig neue Wörter einfallen. Glaubt Ihr, die Gegenwart des Vampirlords könnte so etwas verursachen?«
Der Erzmagier nickte. »Das ist durchaus vorstellbar. Einige unserer Ritter haben ähnliche Symptome gezeigt.« Er sah den blutjungen Paladin an und etwas zögerlich sprach er weiter. »Das ist auch der Grund, warum mich lediglich der gute Hohlefried begleitet.« Ein verschämtes Hüsteln unterbrach seinen Redefluss. »Ähm … die anderen Paladine haben es vorgezogen, eine sogenannte Selbsthilfegruppe zu gründen, anstatt mit uns in den Kampf zu ziehen. Dort sitzen sie jetzt beieinander und sprechen über ihre Ängste, Sorgen und die seelischen Probleme, die sie neuerdings plagen.«
Storne Stahlhand schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte, sodass die ganze Tafel erbebte und etwas Met aus den darauf stehenden Trinkhörnern schwappte.
»Das ist ja mal ein dickes Ding, da brat mir doch einer ein Einhorn! Aber sagt mir, Teophus, was hat Euch zu der Vermutung gebracht, dass der Vampir nun in unseren Landen wandelt?«
Ein selbstgefälliges Lächeln erschien im Gesicht des weißhaarigen Alten. Es war das erste Lächeln, das er seit seiner Ankunft im Dorf zeigte.
»Als Magier habe ich da so meine Methoden. Nach einigen Ermittlungen habe ich damals den Unterschlupf des untoten Schuftes ausfindig gemacht – eine alte Gruft auf dem städtischen Friedhof. Leider war der Schurke bereits entflohen und die jungen Frauen hatte er natürlich mit sich genommen. Ich habe jedoch das hier gefunden.«
Aus den Falten seines Gewandes, in denen sich offenbar eine Tasche verbarg, zog er eine goldene Kette heraus, an der ein großer, blutroter Rubin hing.
»Dies ist ein Geschenk, welches ich meiner Nichte zu ihrem achtzehnten Geburtstag gemacht habe. Sie hat es eigentlich ständig getragen und muss es wohl in der Gruft verloren haben. Vielleicht hat sie es aber auch absichtlich dort zurückgelassen, um mich auf ihre Spur zu führen.«
Er legte die Kette vor sich auf die Tafel und strich behutsam mit seinen Fingerspitzen darüber. Ein leises Summen erfüllte plötzlich den Raum, welches aus dem Rubin zu dringen schien.
»Ein Gegenstand wie dieser, mit einer so starken persönlichen Bindung an seinen Besitzer, kann einem Magier äußerst nützlich sein. Mit seiner Hilfe kann ich mühelos den ungefähren Aufenthaltsort seines Eigentümers bestimmen. Dies nötigt mir nur ein wenig Konzentration und etwas mentale Energie ab. Ich bin mir deshalb sicher, dass Sielrud hier in dieser Gegend ist. Und wo sie ist, da wird auch der Vampirlord sein. Das, was Ihr mir über das seltsame Gebaren Eurer Männer erzählt habt, bestätigt diese Annahme zudem. Habt Ihr vielleicht eine Ahnung, wo sich die Bestie mit den Mädchen verborgen halten könnte?«
König und Druide dachten einige Augenblicke lang nach, dann tat Grahlum es mit einem Fingerschnippen kund, dass ihn ein Geistesblitz ereilt hatte.
»Nicht weit von hier, etwa einen halben Tagesritt entfernt, liegt eine Burgruine. Schon seit Jahrhunderten ist sie unbewohnt und dort gibt es sogar einen kleinen Friedhof. Wenn Ihr mich fragt, wäre dies ein ideales Versteck für Untote jedweder Art.«
»Das ist fürwahr interessant!«, meldete sich nun der milchgesichtige Paladin zu Wort. Storne stellte fest, dass dieser durch das geöffnete Visier viel von seiner Imposanz einbüßte. Auch seine Stimme klang nun ziemlich unreif und nicht sehr beeindruckend für einen Krieger. »Diese Ruine könnte auch der richtige Ort sein, um nach dem Vampirlord zu suchen!«
Storne und Grahlum sahen sich fragend an, während der Magier seine Augen schloss und leise ächzte. Anscheinend war er derart bahnbrechende Erkenntnisse seines Begleiters bereits gewohnt.
»Genau das wollte uns der ehrenwerte Druide damit sagen.«, klärte er den Paladin auf.
»Ach so!« Hohlefried schaute etwas einfältig drein. »Na, dann sollten wir uns diese Ruine möglichst bald mal anschauen. Vielleicht ist es ja auch noch nicht zu spät. Noch hege ich die Hoffnung, wenigstens ein paar der Mädchen vor einer Zukunft als blutsaugendes Monster bewahren zu können. Vor allem der edlen Sielrud gilt meine Sorge. Meine Pflicht als königlicher Paladin gebietet es mir, alles in meiner Macht stehende zu tun, um die Braut des Königs zu retten.«
Der weißhaarige Magier betrachtete die vor ihm liegende Kette gramerfüllt. »Ja, auch ich habe noch nicht die Hoffnung verloren. Doch selbst wenn sich diese als unbegründet erweist, müssen wir dem untoten Haderlumpen endgültig den Garaus machen.«
»So ist es!«, stimmte der Barbarenkönig ihm zu. »Der Halslutscher muss weg! Seinen verderblichen Einfluss auf meinen Stamm kann auch ich nicht hinnehmen. Deshalb werde ich Euch begleiten – als Führer und als zusätzlicher Streiter. In einem Kampf gegen eine so mächtige Kreatur dürfte Euch etwas schlagkräftige Hilfe wohl sehr gelegen kommen. Wir sollten sofort aufbrechen!«
Grahlum der Greise schien von dieser Idee nicht sehr begeistert zu sein. »Hältst du es für klug, dich als Herrscher in ein solches Abenteuer zu stürzen? Du trägst immerhin die Verantwortung für den ganzen Stamm auf deinen Schultern. Wäre es nicht ratsamer, einen deiner Männer zu schicken?«
»Unter normalen Umständen würde ich dir sicherlich Recht geben.« Storne atmete schwer aus. »Aber zurzeit kann ich keinem meiner Männer uneingeschränkt vertrauen. Was ist, wenn ich einen von denen auf diese Mission entsende und er auf einmal die Lust daran verliert, weil er urplötzlich die Mimose in sich entdeckt oder lieber bunte Topflappen häkeln möchte? Dieses Risiko ist mir zu hoch. Ich will diesem Spuk ein rasches Ende bereiten.«
»Und wenn sich die finstere Aura des Vampirs auch deiner Seele bemächtigt?«, gab der Greise zu bedenken. »Wir können nicht wissen, ob überhaupt jemand dagegen immun ist.«
Der König erhob sich von seinem Hocker und legte dem Druiden seine Hand auf die Schulter. »Dann, mein Freund, ist ohnehin alles verloren.«