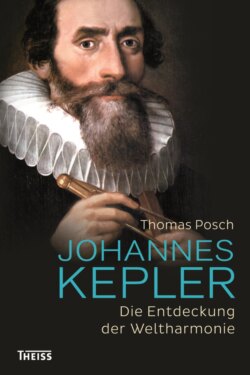Читать книгу Johannes Kepler - Thomas Posch - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеVertauscht man die letzten beiden Ziffern von Johannes Keplers Geburtsjahr 1571, so gelangt man in das weltgeschichtlich bedeutsame Reformationsjahr 1517 – in eine Zeit, von der uns ein halbes Jahrtausend trennt. Wir sehen vor uns den Theologieprofessor Martin Luther, wie er seinen kirchlichen Vorgesetzten 95 Thesen gegen den Ablasshandel vorlegt. Ohne einen kurzen summarischen Blick auf dieses Tun müsste vieles im Leben des Astronomen Kepler, der sich ebenso sehr als Theologe verstand, unverstanden bleiben. Was sich 1517 und in der Folgezeit in Europa abspielt, ist nichts Geringeres als die Neuentdeckung des inneren Menschen, oder – was dasselbe ist – ein neuer Aufweis der Macht der Innerlichkeit: gegen äußere Autoritäten, gegen die Macht verknöcherter Gewohnheiten, gegen die Macht der Sinne, die sich, wie Luther es empfindet, allzu leicht täuschen und verführen lassen, und sei es von einer scheinbar noch so durchgeistigten Schönheit wie jener der Renaissance-Kirchen und -Paläste.
„Gnade für den inneren Menschen“ fordert der Reformator in seiner 58. Ablassthese, doch zugleich „Kreuz, Tod und Hölle für den äußeren Menschen“. Die äußerliche Pracht der vatikanischen Peterskirche würde der Papst selbst „zu Asche verbrennen“, wenn er wüsste, „wie die Ablassprediger das Geld erpressen“, heißt es in der 50. These. Noch vieles mehr behauptet der streitbare Luther darüber, wie der Bischof von Rom das von ihm Gelehrte und seine Taten einzig und allein meinen könne. Doch woher weiß er das so genau? „Man soll die Christen lehren …“, so beginnen mehrere der Ablassthesen – doch wiederum: Woher weiß Luther so genau, was man die Christen lehren soll? Er weiß es, weil seine Lektüre der Bibel und seine Vernunft es ihm sagen. Was heute auch in anderen christlichen Konfessionen wie eine Selbstverständlichkeit klingt – die Berufung auf die eigene Schriftlektüre und auf die eigene Vernunft – war damals, 1517, aber auch noch 1571, revolutionär. Es kam tatsächlich der Erschließung einer neuen Welt gleich, diese Entdeckung der Autorität des Einzelnen in Glaubensfragen. „Das Prinzip der Subjektivität ist Moment der Religion selbst geworden“, sagt Hegel über Luthers reformatorische Wende. Es ist dies aber keine Subjektivität im Sinne von Beliebigkeit, sondern eine Subjektivität im Sinne des Selbstdenkens mit verbindlichen Ergebnissen für das Handeln in der Welt. Es ist eine Subjektivität, die in starke Überzeugungen und in mutiges, aber reflektiertes Handeln mündet, nicht in ein resignierendes „jedem das Seine“.
Was die Wittenberger Thesen im Keim enthalten, entwickelt sich nach und nach zu einer Lehre, die nicht nur dem Papst, sondern auch Bischöfen und Fürsten gefährlich wird. Die Folgen sind bekannt. Ein Jahr nach Keplers Geburt findet in Paris die sogenannte Bartholomäusnacht statt. Über 20.000 Protestanten werden grausam hingemetzelt. Weit über hundert Jahre heftiger, oft blutiger konfessioneller Auseinandersetzungen resultieren daraus. Es ehrt den Forscher, den Denker, den Charaktermenschen Johannes Kepler, dass er sich – in diese Zeit hineingeworfen – eine ökumenische Haltung zu eigen macht, dass er die Eiferer auf beiden Seiten in Schranken weist und an der Idee der Einheit der Kirche festhält. Es gereicht hingegen weder Keplers Gegnern noch seinen Freunden zur Ehre, dass sie wiederholt versuchen, den kaiserlichen Mathematiker zu einem in ihrem Sinne „klaren“, das heißt einseitigen Bekenntnis, etwa gegen die Anhänger Calvins, zu bewegen.
Szenenwechsel nach Frauenburg im Erzbistum Ermland an der Ostsee. Wir schreiben das Jahr 1543, drei Jahre vor der Geburt von Keplers Mutter Katharina. Wir sehen einen Mann auf seinem Totenbett liegen, der zeitlebens weder ein Lutheraner noch in sonstiger Weise ein religiöser Revolutionär, vielmehr Würdenträger der katholischen Kirche gewesen ist. Seine Nationalität und selbst sein Name werden später Gegenstand von Meinungsverschiedenheiten sein: War er ein Deutscher aus der altpreußischen Stadt Thorn? War er ein Pole aus Toruń? Hieß er Koppernigk, Köpernik oder Kopernik? Nennen wir ihn, die allen zeitgenössischen Gelehrten verständliche lateinische Sprache verwendend, Nicolaus Copernicus.In seinen Händen – so will es die Überlieferung – hält der Sterbende ein gedrucktes, ja, ein endlich gedrucktes, in seinem Geist schon lange vorher gereiftes Buch. Es trägt Revolutionen im Titel, wenn auch in einem ganz unpolitischen Sinne: Umwälzungen von Himmelssphären, Umläufe von Sternen, Planeten und des Mondes. Copernicus hat sie alle neu geordnet: „in medio vero omnium residet Sol“, im Zentrum der Planetenbahnen „residiert“ die Sonne. Der Verlegenheit darüber, wo die beiden Planeten Merkur und Venus zu platzieren seien, hat er damit ein Ende bereitet. Wie Luther achtet Copernicus das unreflektierte Zeugnis der Sinne gering, sofern es nicht in einen überzeugenden Gesamtzusammenhang gebracht werden kann. Dass die Sonne unseren Augen als bewegt erscheint, dass andererseits die Erde unter unseren Füßen ihre rasende Rotation nicht unmittelbar zeigt, ist für ihn kein Argument. Dass sich Autoritäten über Autoritäten häufen lassen, um für den Geozentrismus zu sprechen, überzeugt Copernicus gleichfalls nicht. Das System aller Wandelsterne, das System aller himmlischen Bewegungen will aus einem Prinzip heraus vernünftig geordnet sein – ohne dass ganze Welten, wie Merkur und Venus, einen bloßen Verlegenheitsplatz, eine unklare, eine so oder anders zu denkende Stelle zugewiesen bekommen, wie es im ptolemäischen System der Fall ist. Es soll nicht mehr so sein, dass jeder Planet einer eigenen Bewegungstheorie bedarf, losgelöst von den Modellen für die Bewegungen der anderen Wandelsterne. Wenn es am Ende dem Zweck dient, das System als Ganzes übersichtlicher, vernünftiger, einheitlicher zu machen, dann führt Copernicus einen Aristarch von Samos, einen Hiketas von Syrakus an. Er ist kein autoritätsfeindlicher Empiriker. Er ist aber wie Luther einer, der selbst denkt und der zu Ende denkt. Kepler wird später schreiben, das System des Copernicus habe eine „Schönheit“, die ihn „beim Betrachten mit unglaublichem Entzücken erfüllt“ (Briefe II: 74; 13.8.1617).
Allerdings gibt es zwei von Copernicus nicht hinterfragte Grundannahmen. Erstens: Er übernimmt aus der antiken Astronomie die Vorstellung – man kann beinahe sagen: das Dogma –, dass die Himmelsbewegungen durch Kombinationen von Kreisen darzustellen sind. Zweitens: Die Astronomie des Copernicus ist noch nicht „Himmelsphysik“ im Sinne der Forderung, dass den Planetenbahnen eine physische Realität entsprechen soll. Nur als Rechenschema, als mathematische Hypothese braucht das System der copernicanischen Kreise mit der Sonne in deren Mittelpunkt plausibel zu sein, nur das Endergebnis der Kalkulationen mit dem neuen Kreisbahnschema muss stimmen. Erst Kepler wird diese beiden Grundannahmen hinterfragen. Er wird zum einen Ellipsenbahnen und zeitlich variable Bahngeschwindigkeiten an die Stelle von Kreisbahnen und gleichförmigen Geschwindigkeiten setzen. Er wird damit etwas in sich Ungleichförmiges als Form eines Naturgesetzes zulassen – während für die antike Astronomie Gesetze finden und auf größtmögliche Gleichförmigkeit bringen dasselbe war. Kepler wird zum anderen seine Darstellung des Sonnensystems nicht mehr als bloß mathematisches Kalkül, nicht mehr als Erarbeitung eines geometrischen Modells zur „Rettung der Phänomene“ verstehen. Er wird mit vollem Bewusstsein und mit Stolz die Worte Physica coelestis (Himmelsphysik) als Untertitel seiner Neuen Astronomie (Astronomia Nova) wählen und damit den Anspruch zum Ausdruck bringen, dass die Wissenschaft vom Weltall von nun an mit Hypothesen zu arbeiten habe, die zumindest der jeweilige Urheber selbst für mögliche Wirkungsweisen der Natur selbst hält. Er wird sich also – modern ausgedrückt – mit einem bloß konstruktivistischen Wissenschaftsverständnis nicht zufrieden geben. Diese beiden Neuerungen sind noch grundsätzlicher als Copernicus’ Übergang vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild. Manche Autoren schlagen daher nicht zu Unrecht vor, von der „Keplerschen Wende“ eher als von der „Copernicanischen Wende“ zu sprechen (Carrier & Mittelstraß: 139).
Nicht nur durch seinen neuen Forschungsansatz, sondern auch als Persönlichkeit ragt Kepler aus der Wissenschaftsgeschichte hervor. In der Tat ist sein Werk stark von seinem individuellen Charakter geprägt, sodass es nicht nur von biographischem Interesse ist, dessen Eigentümlichkeiten zu verstehen. Betrachten wir dazu einige Beispiele.
Im 58. Kapitel seines 1609 erschienenen Werkes Neue Astronomie, in dem der Inhalt des Ersten Keplerschen Gesetzes – die elliptische Form der Planetenbahnen – dargelegt wird, ruft der Astronom aus: „O ich Lächerlicher!“ („O me ridiculum!“) und will damit sagen, dass die Beobachtungsdaten ihn schon viel früher auf die gesuchte Bahnform hätten führen können. Wohl nie davor und nie seither ist ein großes Naturgesetz mit so viel Demut verkündet worden. Wenige Seiten zuvor schreibt Kepler genauer, welcher mathematische Fehler ihn lange Zeit daran gehindert hat, auf elliptische Planetenbahnen zu kommen. Einige Kapitel davor klagt er sich an, sein „Eifer“ habe ihn „blind“ gemacht und habe ihn daran gehindert, auf alle empirischen Einzelheiten achtzugeben. Nicht weniger emotional ist der schon fast fünfzigjährige Kepler: Im selben Buch seiner 1619 erschienenen Weltharmonik (Harmonices Mundi libri V), in dem er das Proportionalitätsgesetz zwischen Umlaufzeiten und Bahnhalbmessern präsentiert, schreibt er eingangs, er überlasse sich aus lauter Freude über die Erkenntnis „heiliger Raserei“. In einem anderen Werk, das, wie wir heute sagen würden, von einer Supernova-Explosion handelt – es trägt den Titel Gründtlicher Bericht Von einem ungewohnlichen Newen Stern –, vergleicht Kepler das Himmelsphänomen mit einem „köstlichen [!] Diamant von vielen eckhen“. Einige Mondlandschaften nennt er in seinen handschriftlichen Beobachtungsnotizen, die erst vor wenigen Jahren im Druck erschienen, „wunderschön“. Er verwendet also auch in diesen Fällen ein stark vom subjektiven Erleben und von ästhetischem Empfinden geprägtes Bild. Ergänzend sei noch ein Auszug aus einem autobiographischen Text herangezogen. In seiner Ende 1597 verfassten Selbstcharakteristik schreibt der Astronom: „In mir ist Heftigkeit, Unduldsamkeit gegen lästige Menschen [intolerantia taediosorum], unverschämte Lust am Spotten wie auch am Spaßmachen, schließlich dreiste Kritiksucht, da ich niemanden unangefochten lasse.“ (Selbstzeugnisse: 28; Übs. berichtigt nach GW 19: 336)
Was wollen diese Beispiele besagen? Gewiss gehören offenherzige Kritik am eigenen Charakter, überschwänglicher Jubel über erzielte Einsichten, erst recht aber Beschreibungen von eigenen Erlebnissen, Irrwegen und Fehlern – zum Teil in veröffentlichten Werken! – nicht zu dem, was man von einem Naturforscher erwarten würde. Heute ist dies mehr denn je selbstverständlich. Doch selbst in seiner eigenen Epoche nimmt Kepler mit seinem leidenschaftlichen, alles andere als rein an Fakten orientierten Schreibstil sowie mit seinen Reflexionen auf eigene Fehler eine Sonderstellung ein. Zwar spielt der jeweilige Charakter auch bei anderen Naturforschern jener Epoche eine Rolle. So tritt uns ja auch Galileo Galilei als ein ausgeprägtes Individuum – als ein angriffslustiger, als ein ebenfalls zum Spott neigender Mensch – aus seinen Schriften entgegen. Aber eine mit Kepler vergleichbare schonungslose Offenheit gegenüber sich selbst, ein Fallenlassen aller akademischen Masken, eine aus den Schriften hervortretende Herzlichkeit finden wir bei Galilei nicht. Kepler bekennt sich zu letzterer ganz explizit: „Es kann ja eine Schreibweise nicht willkommen sein, wenn sie nicht frei ist, wenn sie nicht vom Herzen in die Feder fließt.“ (Briefe II: 92) Er scheut sich dabei auch nicht, freimütig über seine körperlichen Gebrechen zu sprechen. So findet sich an mehreren Stellen seiner Werke und Briefe das Eingeständnis seiner Fehlsichtigkeit: für einen Astronomen eine nicht geringe Beeinträchtigung. Einmal fallen sogar in einer deutschen Druckschrift die drastischen Worte: „ich mit meinem blöden Gesicht“ (GW 4: 61) – Worte, die sich nicht etwa auf ein unvorteilhaftes Aussehen, sondern auf das schlechte Sehvermögen beziehen.
Weil Kepler so sehr als „Charaktermensch“ zu uns spricht, ist es so lohnend, sich mit seiner Persönlichkeit zu beschäftigen und sich am Leitfaden seines Lebens seinem Werk zu nähern. Auch früheren Kepler-Biographen entging dies nicht. So schrieb Max Caspar im Vorwort zu seinem 1948 erschienenen, immer noch grundlegenden Kepler-Buch pathetisch und zugleich treffend: „Es ist der Nimbus seiner Persönlichkeit, der viele in seinen Bann zieht, der Adel seines Menschentums, der ihm Freunde zuführt, die Wirrnis seiner Lebensschicksale, die Teilnahme erregt, das Geheimnis seiner Naturverbundenheit, das alle lockt“ (Caspar: 7).
Noch ein zweiter Gesichtspunkt ist es, unter dem Kepler aus der Masse der neuzeitlichen Naturwissenschaftler herausragt. Er verkörpert nämlich einen Weg der Naturforschung, auf dem die Hochschätzung der Erfahrung, die genaue Beobachtung ebenso zentral ist wie der philosophische Blick auf die Welt als Ganze. Heute werden diese beiden Pole allzu oft gegeneinander ausgespielt. Der Blick auf die Welt als ein geistiges, vernünftiges, wertund sinnbehaftetes Ganzes wird gegenwärtig eher von den Religionen und von Lebensberatern in Anspruch genommen, dagegen den Wissenschaften abgesprochen und auch von ihnen selbst ausdrücklich nicht reklamiert. Umgekehrt werden Hochschätzung der Erfahrung, Anerkennung der Widerlegbarkeit sowie höchste Genauigkeit des immer erneuten Beobachtens praktisch nur von den Einzelwissenschaften zur Geltung gebracht, während sie in ganzheitlichen Denkansätzen weitgehend fehlen.
Anders ist es, wie gesagt, bei Johannes Kepler. Berufung auf die Empirie, Detailtreue und ganzheitlicher Blick auf die Welt sind ihm keine Gegensätze. Philosophie und Naturwissenschaft sind ihm nicht „zwei Kulturen“, während es in den Jahrzehnten und Jahrhunderten nach seinem Tod immer mehr so kommt, was bis heute ungünstige Folgen für das Geistesleben nach sich zieht. Kepler schafft aber – was ebenso entscheidend ist – keine mystische, keine esoterische, keine kurzschlüssige Verbindung zwischen Naturphilosophie und einzelwissenschaftlicher Forschung. Er grenzt sich deutlich und an manchen Stellen scharf von jenen pseudowissenschaftlichen Bestrebungen ab, die sich ein Geheimwissen über das, was die Welt angeblich im Innersten zusammenhält, anmaßen. In seiner Polemik gegen den englischen Esoteriker Robert Fludd schreibt er scharfzüngig: „Man sieht, daß Fludd seine Hauptfreude an unverständlichen Rätselbildern von der Wirklichkeit hat, während ich darauf ausgehe, gerade die in Dunkel gehüllten Tatsachen der Natur ins helle Licht der Erkenntnis zu rücken“ (Caspar: 347).
So ist es nicht bloß schwäbischer Regionalpatriotismus, dass die Philosophen Hegel und Schelling im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts auf Kepler als ihr Vorbild zurückgreifen, wenn es darum geht, ein Denken zu begründen, das ‚aus einem Guss‘ ist, das nicht in eine subjektive und eine objektive Sphäre zerfällt, das Weltanschauung und Wissen, das poetischen und mathematischen Weltzugang, „ésprit de finesse“ und „ésprit de géometrie“ (nach Pascal) zu vereinen vermag, ohne dabei in ein dunkles Orakeln zu verfallen.
Der amerikanische Astronom und Wissenschaftshistoriker Owen Gingerich spricht diesen Aspekt mit folgenden Worten an: „Es gibt […] keinen Widerspruch zwischen einem festen Glauben an einen übernatürlichen Plan und der Arbeit als kreativer Wissenschaftler, und vielleicht gibt es dafür kein besseres Beispiel als den Astronomen Johannes Kepler.“ (Gingerich: 86f.) Ganzheitlicher Blick auf die Welt ist natürlich nicht dasselbe wie der Glaube an einen übernatürlichen Weltenplan. Man kann das eine auch ohne das andere haben. Bei Kepler kommt aber beides zusammen, und zwar nicht bloß auf eine äußerliche Weise. Für ihn ist die mathematische Struktur der Naturgesetze ein Abbild der Schönheit und geistigen Struktur der Welt. Er vermutet, dass „die gantze Natur und alle ihre himmlische Zierligkeit in der Geometria symbolisiert sey.“ (Caspar: 344) Ja, er wird noch deutlicher: „daß die mathematischen Begriffe der zu schaffenden Körperwelt mit Gott von Ewigkeit her vorhanden waren.“ (GW 6: 219) Die Geometrie ist, mit anderen Worten, schon vor der Entstehung der Dinge im göttlichen Geist verankert gewesen. Erst in diesem Zusammenhang wird im Ansatz verständlich, wie schon der junge Kepler in einem Brief 1595 schreiben konnte: „Ich wollte Theologe werden; lange war ich in Unruhe. Nun aber seht, wie Gott durch mein Bemühen auch in der Astronomie gefeiert wird.“ (Briefe I: 24) Und an anderer Stelle, in der Vorrede zu seinem Werk Abriss der copernicanischen Astronomie (Epitome Astronomiae Copernicanae), er sehe sich selbst als einen „Priester Gottes, der das Buch der Natur studiert“ (GW 7: 9). Diese Äußerungen sind nicht etwa poetisches Beiwerk. Sie entspringen dem Kern des keplerschen Denkens und durchdringen all dessen komplizierte Verästelungen, motivieren all seine Mühen, begründen auch manche seiner triumphalen Erfolge.