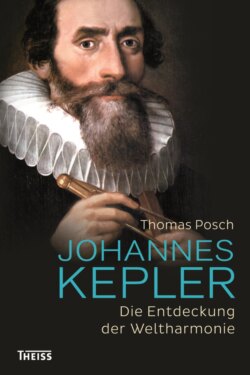Читать книгу Johannes Kepler - Thomas Posch - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Herkunft, Kindheit und Jugend (1571–1593)
ОглавлениеKepler ist ein Kind des späten 16. Jahrhunderts, schuf aber fast alle seine Hauptwerke im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts. Es ist dies eine Zeit gewaltiger Entdeckungen von Seefahrern und Naturforschern. Es ist eine Zeit, in der man im Abendland immerhin schon etwa die Hälfte der Erdoberfläche in groben Zügen kennt. Es ist zugleich eine Zeit großer geistig-religiöser Umbrüche, aber auch extremer weltanschaulicher Intoleranz. Eine „ketzerische“ Schrift, eine abweichende Lehrmeinung, mitunter ein falsches Wort genügt, um eingekerkert oder gar hingerichtet zu werden. Es ist, um es mit dem Komponisten Paul Hindemith zu sagen, eine Zeit von „Kriegen, Kirchenzwisten, Kaiserwechseln und Krankheiten“. Ebenso ist es eine Zeit grausamer Hexenprozesse, eines ausufernden Sternen- und Aberglaubens sowie hoher Kindersterblichkeit. Von den zwölf Kindern, die Kepler in die Welt setzt, sterben acht kurz nach ihrer Geburt oder erreichen nicht das Erwachsenenalter. Keplers Mutter entgeht nur knapp und nur dank des aufopfernden Einsatzes ihres Sohnes der Verurteilung in einem Hexenprozess. Das frühe 17. Jahrhundert ist aber auch – um noch ein positives Charakteristikum der Epoche anzufügen – eine Zeit, in der ein Buch, eine kleine Flugschrift, eine massive Umwälzung jahrhundertelang gültiger Weltmodelle einleiten kann. Kepler selbst hat als einzelner Forscher einen bis heute noch nicht vollends aufgearbeiteten Anteil an der Weltbild-Revolution jener Zeit. Zusätzlich nimmt er mit der ganzen Kraft seines Wesens an den religiösen Konflikten jener Tage Anteil, versucht vermittelnd zu wirken, doch muss er gerade auf diesem Gebiet herbe Rückschläge hinnehmen.
Wann genau beginnt nun das Leben des Johannes Kepler? Die Frage ist dank seiner in diesem Punkt genauen autobiographischen Angaben beantwortbar. Der nachmalige Astronom erblickt am 27. Dezember 1571 um halb drei Uhr nachmittags in Weil der Stadt das Licht der Welt. Sein Vorname Johannes wird in Anlehnung an den Gedenktag Johannes des Evangelisten gewählt. Sein Geburtsort Weil ist damals eine Kleinstadt mit etwa 600 Einwohnern und liegt 25 Kilometer westlich von Stuttgart. Die von Kepler selbst später durchaus beachtete, aber nicht fatalistisch verstandene Konstellation von Sonne, Mond und Planeten rund um den Zeitpunkt seiner Geburt lässt sich kurz folgendermaßen beschreiben: Die Sonne steht tief am Himmel, denn es ist etwa Wintersonnenwende. Der Mond steht dagegen im Sternbild Stier, wird also als Beinahe-Vollmond im Dezember in der folgenden Nacht eine hohe Stellung am Himmel durchlaufen. Der Riesenplanet Jupiter leuchtet am Abendhimmel in der Nähe des Frühlingspunktes, nachdem er am Nachmittag, zum eigentlichen Geburtszeitpunkt, den Meridian durchlaufen hat („medium coeli“). Der rötlich schimmernde Mars befindet sich Jupiter gegenüber im Sternbild Jungfrau. Er wird demzufolge erst in der zweiten Nachthälfte, d.h. in den frühen Morgenstunden des 28. Dezember (sowie an den Morgen der darauffolgenden Tage), sichtbar. Unweit von Mars befindet sich Saturn im Abstand von etwa 60° westlich der Sonne. Diese Konstellation wird auch Sextilschein genannt. Die inneren Planeten Merkur und Venus haben einen sehr geringen Winkelabstand von der Sonne. In einem 1596 verfassten Text stellt Kepler eine Reihe von Spekulationen über die astrologische Bedeutung dieser Stellung der Gestirne an, nachdem er sie errechnet hat. So schreibt er unter anderem: „Es steht die Sonne im Sextil des Jupiter und in Konjunktion mit Venus, die nichts ist als Schönheit. […] Dazu noch Jupiter im Medium Coeli. Aber sind das nicht eher zahlreiche Vorzeichen für Glück?“ Andererseits vermutet er, es mache „die Sonne im Sextil zu Saturn argwöhnisch und unruhig und ängstlich, zum Nachtarbeiter und auf Einzelheiten bedacht.“ (Selbstzeugnisse: 25) In einem Brief an den bayerischen Kanzler Herwart von Hohenburg führt er dazu näher aus:
„Bei mir wirken Saturn und Sonne im Sextilschein zusammen. […] Daher ist mein Körper trocken und knotig, nicht groß. Die Seele ist kleinmütig, sie versteckt sich ganz in literarischen Winkeln; sie ist argwöhnisch, furchtsam, sucht ihren Weg durch beschwerliches Gestrüpp und läßt sich dabei aufhalten […]. Knochen nagen, trockenes Brot essen, Bitteres und Scharfes kosten ist mir eine Wonne; über holprige Wege, Anhöhen hinauf, durch Dickicht hindurch zu spazieren ist mir ein festliches Vergnügen. Mittel, das Leben zu würzen, kenne ich außer den Wissenschaften nicht …“ (Briefe I: 106; 9./10.4.1599)
All diese Erwägungen sind mit Vorsicht, teilweise auch mit Offenheit für Ironie zu lesen. Mehr als einmal wird Kepler später festhalten, dass die Sterne „zwar die Seele eines Menschen erfüllen“, aber seinen Erfolg oder Misserfolg keineswegs direkt bewirken können (Briefe II: 55; 13.4.1616). Anders gesagt: Was die Geburtskonstellation bewirken kann, ist nur, „daß sie […] den Geist zu unermüdlicher Arbeit anspornt und den Wissensdurst vermehrt.“ (Caspar: 331)
Kommen wir von diesen zweifelhaften Gedanken zu Gewissem und heute noch Nachvollziehbarem. Keplers Geburtshaus in Weil der Stadt – ein schönes, zweistöckiges Fachwerkhaus – wird zwar am Ende des Dreißigjährigen Krieges zerstört, doch später in ähnlicher Form wieder aufgebaut. Seit 1940 ist darin ein Kepler-Museum untergebracht, das 1999 neu gestaltet wurde. Ungeachtet seiner Kleinheit war Weil als freie Reichsstadt im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit bedeutend. Ein Urgroßvater Keplers väterlicherseits, Sebald, war um 1520 aus der fränkischen Metropole Nürnberg nach Weil – damals auch Weyl oder Wyl genannt – eingewandert. Er gehörte dem Handwerkerstand an, doch stammte er von einem ob seiner Verdienste im kaiserlichen Heer im 15. Jahrhundert geadelten Friedrich Kepler ab. Für die Nürnberger Vorfahren Keplers ist auch die Schreibweise „Kepner“ bezeugt. Was den geadelten Urahnen Friedrich Keplers betrifft, wird über ihn in einem Dokument, das im Österreichischen Staatsarchiv aufbewahrt wird, festgehalten: „Es sein auch Ire [= Sebalds] voreltern Irer Eerlichen geübten Kriegsdienst halben, von Kaiser Sigmund Höchlöblichster gedechtnuß zu Ritter geschlagen im Jar 1433.“ (GW 19: 313) Johannes Kepler wird von dem Ritterschlag, der einem seiner Vorfahren in Rom zuteil wurde, ein deutliches Bewusstsein haben, wie unter anderem seinem Brief an Vinzenz Bianchi vom 17. Februar 1619 zu entnehmen ist (GW 17: 321, GW 17: 504). Er trägt seinen Adel zwar nicht zur Schau, doch in manchen Momenten seines Lebens besinnt er sich darauf. Der harten Arbeit seiner späteren Vorväter als Handwerker ist er sich ebenfalls bewusst: „Die Not trieb […] in den letzten 100 Jahren meine nächsten Vorfahren in den Kaufmanns- und Handwerkerstand“ (Briefe II: 124).
Das Geburtshaus Johannes Keplers in Weil der Stadt, in dem heute ein Kepler-Museum untergebracht ist.
Das Wappen der 1433 geadelten Familie Kepler.
Johannes Keplers Großvater väterlicherseits trug wie der Urgroßvater den Vornamen Sebald. Im Jahre 1521 geboren, war er von 1569 bis 1578 Bürgermeister und einer der angesehensten Männer innerhalb der protestantischen Minderheit von Weil. Die Mehrheit der Bevölkerung jener schwäbischen Kleinstadt war katholischer Konfession. Selbst ein Onkel des Astronomen – auch er trug den Namen Sebald – trat zum Katholizismus über und wurde Jesuit. Er galt als „Zauberer“ und als hasserfüllt gegen seine Mitbürger. Früh schon starb er an Wassersucht.
Keplers Vater Heinrich führt zum Leidwesen der Familie ein sehr unstetes Leben. Er verdingt sich als Söldner und verbringt lange Zeit in fernen Ländern, unter anderem in den Niederlanden. Er kommt von den Kriegsschauplätzen manchmal mit Geld, oft aber auch zerrüttet, in die württembergische Heimat. Keplers Mutter Katharina stammt aus dem zwischen Stuttgart und Weil gelegenen Eltingen, wo sie 1546 – im selben Jahr wie Tycho Brahe – zur Welt kam. Ihr Mädchenname ist Guldenmann. Ihr Aussehen wird der Sohn später mit den Stichworten „klein“, „mager“ und „schwarz“ beschreiben. Der Zugang zu höherer Bildung bleibt ihr verwehrt. Sie lernt nicht einmal lesen und schreiben. Sie vertieft sich aber in die Kunst, mit Hilfe von Heilkräutern Krankheiten zu behandeln. Sie neigt zu Streitsucht. Ihre Ehe mit Heinrich Kepler verläuft nicht harmonisch. Das Paar bekommt insgesamt sieben Kinder, von denen Johannes das älteste ist. Mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Heinrich wird er später – während seiner Grazer Zeit – in einen Konflikt geraten, über den er schreiben sollte: „Der Grund für den Streit mit meinem Bruder waren erstens seine liederlichen Sitten, dann meine Tadelsucht, drittens seine maßlosen Forderungen, viertens meine Kargheit.“ (Selbstzeugnisse: 28) Der Bruder Heinrich ist indes nicht nur streitsüchtig, er ist krank. Seit seiner Kindheit leidet er an Epilepsie, einer damals verbreiteten und gefürchteten Krankheit. Da die Menschen mit den daraus resultierenden Verhaltensweisen nicht recht umzugehen wissen, sind endlose Schwierigkeiten vorprogrammiert. Wie der Vater wird Heinrich Kepler junior ein Leben als Soldat führen und lange Jahre bei der kaiserlichen Wache in Prag dienen. Glücklicher sollte Keplers Beziehung zu seinen wesentlich jüngeren Geschwistern Christoph und Margarete verlaufen. Mit seiner Schwester bleibt er zeitlebens in Verbindung und korrespondiert bis ein Jahr vor seinem Todmit ihr, phasenweise – im Zuge eines Württemberg-Aufenthalts – wohnt er sogar bei ihr.
Keplers Vater stirbt bereits im Jahre 1590 bei Augsburg. Seine etwa gleichaltrige Ehefrau wird ihn um 32 Jahre überleben, also erst 1622 das Zeitliche segnen – nicht lange nach einem gegen sie geführten langwierigen Hexenprozess, in dessen Verlauf man ihr unter anderem den absurden Vorwurf machen wird, sie habe ihren Ehemann „etliche Male von Haus vertrieben“ (Walz: 97).
Merkwürdigerweise wird Johannes Kepler katholisch (d.h. von einem katholischen Geistlichen) getauft. Dies ist ein Umstand, auf den er noch zweieinhalb Jahre vor seinem Tod den Jesuiten Paul Guldin aufmerksam macht (Briefe II: 269f.; 24.2.1628). Er wird dann aber, entsprechend der Familientradition, evangelisch-lutherisch erzogen und unterrichtet. Darüber äußert er sich in einem Brief folgendermaßen: „die Augsburger Konfession habe ich aus der Belehrung von meinen Eltern her, in wiederholter Erforschung ihrer Begründung, in täglichen Erprobungen in mich aufgenommen.“ (Briefe I: 91) Nach Keplers späterer Überzeugung ist er fast zwei Monate zu früh zur Welt gekommen. Die meisten Biographen übernehmen diese Vorstellung, auch weil die schwache Gesundheit des Jungen dafür zu sprechen scheint. Das Hochzeitsdatum der Eltern war jedenfalls der 15. Mai 1571. Kepler und seine Verwandtschaft wissen, dass es als Schande gälte, vor dem Hochzeitstag gezeugt worden zu sein. Daraus hat sich bei Kepler selbst und in der Nachwelt die Auffassung durchgesetzt, er sei ein „Siebenmonatskind“. Diese Auffassung muss aber nicht zutreffend sein – sie kann, wie der Biograph Eberhard Walz ausführt, den damaligen gesellschaftlichen Konventionen geschuldet gewesen sein.
Keplers körperliche Konstitution wird oft als schwächlich beschrieben, was man aber nur gelten lassen kann, wenn man hinzufügt, dass sie mit enormer Zähigkeit und großer Ausdauer verbunden war. Metaphorisch schreibt er sich selbst eine „Hundenatur“ zu (Selbstcharakteristik: 29). Als Kind wird er oft von Krankheiten heimgesucht – so etwa als Vierjähriger von den Pocken, die ihn beinahe dahinraffen. Auch als Erwachsener wird Kepler nicht nur mit Fehlsichtigkeit, sondern mehrfach mit großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, die ihn sogar in der Lebensmitte an den Rand des Todes bringen – und die ihn dennoch nicht nachhaltig schwächen. Seine Seelenstärke, seine Willenskraft, seine Zähigkeit sind außerordentlich. Er gehört wie ein Ludwig van Beethoven, wie ein Søren Kierkegaard zu jenen Menschen, deren Schaffenskraft sich weder von Schicksalsschlägen noch von körperlichen Gebrechen niederdrücken lässt, deren Produktivität im Gegenteil mit ihren Leiden eine merkwürdige Symbiose eingeht, sodass die Arbeitsintensität mit den Sorgen oft sogar kulminiert. Kepler arbeitet gleichsam ununterbrochen. In seiner Selbstcharakteristik sagt er über sich: „Auch nur ein wenig Zeit ungenützt verstreichen zu lassen war ihm unerträglich.“ (Selbstcharakteristik: 17) Er liest und schreibt auch auf seinen zahlreichen, wahrlich nicht komfortablen Reisen und opfert erholsame Stunden nächtlichen Schlafes mühseligen Rechnungen beim Licht einer flackernden Kerze, die denn auch auf dem Frontispiz seines letzten großen Werkes neben einem kleinen Selbstporträt des Autors zur Darstellung kommen wird. Er nimmt Zuflucht zu geistiger Arbeit auch und gerade in Lebenslagen, die dies nicht begünstigen, und schreibt Werke wie die Weltharmonik, die Schöpfung und Schöpfer loben, die Generationen von Menschen begeistern werden, gerade in Augenblicken des Waffengetöses und des Eintreffens von Hiobsbotschaften.
Zurück zur Kindheit des künftigen Forschers. Alles spricht dafür, dass der Großvater väterlicherseits für den jungen Johannes Kepler in höherem Maße Bezugsperson ist als der ohnehin meist abwesende Vater Heinrich, den der Sohn überdies später als ruchlos, lasterhaft, schroff und streitsüchtig beschreibt. In dem oben zitierten autobiographischen Dokument heißt es über den Vater auch: „Er erlernte den Geschützdienst, hatte viele Feinde, eine Ehe voll Streit“. Über die Mutter lesen wir im selben Schriftstück einerseits: „Sie ist mir sehr ähnlich andererseits nennt er auch sie streitsüchtig sowie „von beißendem Witz“ und „von schlimmem Wesen“. Selbst der angesehene und persönlich geschätzte Großvater kommt in Keplers Notizen nicht nur gut weg, nennt er ihn doch „jähzornig“ und findet, dass seine Körpersprache auf Begierden hindeute (Schmidt: 218).
Schon früh beobachtet Kepler in seiner entbehrungsreichen Kindheit Ereignisse am gestirnten Himmel. Auch sein späteres Leben wird reich an außergewöhnlichen und bahnbrechenden Himmelsbeobachtungen sein: von einer Supernova-Explosion in unserer Milchstraße über helle Kometen, Sonnen- und Mondfinsternisse bis hin zur teleskopischen Erkundung der Wunder unseres Sonnensystems zu einer Zeit, als erst eine Handvoll Menschen über Fernrohre verfügen und Ähnliches erschauen können. Seine früheste Mondfinsternis-Beobachtung am 31. Januar 1580, bei der dem noch nicht einmal Neunjährigen die rötliche Farbe („rubicunda“) des Mondes auffällt, muss einen so bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben, dass er sie noch mehr als zwei Jahrzehnte später in seinem Buch Optischer Teil der Astronomie (Astronomiae Pars Optica) erwähnt. Aus noch früherer Zeit ist überliefert, dass der sechsjährige Knabe gemeinsam mit seiner Mutter an einem hochgelegenen Ort den Großen Kometen vom Herbst des Jahres 1577 beobachtet. Gemäß der heutigen astronomischen Nomenklatur trägt der Komet die Bezeichnung C/1577 V1. Zeitgenössische Berichte künden von einer sehr eindrucksvollen Himmelserscheinung. So lesen wir etwa in einer Schrift des Bartholomäus Scultetus, der Komet erscheine wie eine „große leuchtende Kugel, die Feuer spuckte und in Rauch endete“ (Kronk: 318). Seine Helligkeit ist zur Zeit des größten Glanzes mindestens so groß wie jene der Venus – somit leuchtet er weit heller als alle Fixsterne! Der dänische Astronom Tycho Brahe, der in Keplers Leben noch eine große Rolle spielen wird, zählt ebenfalls zu den Beobachtern dieses spektakulären Schweifsterns. Er bestimmt die Breite des Kometenschweifs zu zweieinhalb Winkelgraden – also fünf Monddurchmessern – und dessen Länge zu mehr als 21 Winkelgraden, was etwa der Größe eines ganzen Sternbilds entspricht. Weiterhin kann er zeigen, dass dieses Objekt nicht – wie Aristoteles dies in Bezug auf alle Schweifsterne gelehrt hatte – ein Phänomen innerhalb der Erdatmosphäre ist, sondern mindestens 230 Erdradien von der Erde entfernt. In seiner Schrift De cometa anni 1577 schreibt er dazu: „Deshalb kann die Aristotelische Philosophie hierin nicht wahr sein, die lehrt, daß am Himmel nichts Neues entstehen könne und daß alle Kometen im oberen Teil der Luft sich befänden.“ (Hamel: 173) Den physischen Durchmesser des Kometenkopfs schätzt er auf ein Viertel des Erddurchmessers, beruhend auf Winkeldurchmesser und Entfernung.
Im 16. und 17. Jahrhundert gelten Kometen allgemein als Unglücksboten, sodass die weit überwiegende Mehrzahl der Betrachter keine große Freude an der Betrachtung des kosmischen Gastes zu empfinden vermag. Dreißig Jahre später, am 26. September 1607, wird Kepler von der Prager Moldaubrücke aus einen weiteren Schweifstern beobachten: den berühmten Halleyschen Kometen. Gemeinsam mit anderen Kometenbeobachtungen wird ihn diese zur Abfassung einer kleinen deutschen und später zu einer langen lateinischen Abhandlung (De cometis libri tres) inspirieren.
Bahn des großen Kometen des Jahres 1577, welchen Kepler als Kind mit seiner Mutter beobachtete. Schematische Darstellung aus dem „Theatrum Cometicum“ von Stanislaw Lubieniecki (1668). In der Mitte oben das Sternbild Delphin.
Ins Kometenjahr 1577 fällt ein kirchengeschichtliches Ereignis, dessen Folgen Kepler später wiederholt schwer zu schaffen machen werden: der Beschluss der sogenannten Konkordienformel. Ein halbes Jahrhundert nach Luthers Thesen-Veröffentlichung in Wittenberg herrscht in der evangelischen Kirche ein tiefes Bedürfnis, Grundpositionen des eigenen Glaubens in Kontrast zu Katholizismus, Calvinismus und anderen christlichen Konfessionen nochmals zu präzisieren. Dies geschieht im „Kometenjahr“ 1577 in Gestalt von zwölf Artikeln, die im Kloster Berge bei Magdeburg von einem sechsköpfigen Theologenkonvent beschlossen werden. Die Themen der Artikel reichen von der Willensfreiheit über die Bedeutung der guten Werke bis zur göttlichen und menschlichen Natur Christi sowie zum richtigen Verständnis der Abendmahlsfeier. Gerade der letzte Punkt wird Kepler ein Vierteljahrhundert später – während seiner Linzer Periode – in schwere Gewissensnöte bringen. Denn jener Artikel der Konkordienformel, der festzulegen sucht, welches das richtige Verständnis der Eucharistiefeier sei, muss Kepler wegen der allzu scharfen Abgrenzung von den Calvinisten als überzogen erscheinen. Erinnern wir uns: In der calvinistischen Konfession wird die Abendmahlsfeier so gedacht, dass die Gemeinde sich in ihr des Letzten Abendmahls Christi mit seinen Jüngern erinnert, jedoch keine substantielle Gegenwart des Gottessohnes in der Hostie annimmt. Im lutherischen Bekenntnis dagegen wird eine reale Präsenz Jesu Christi in Brot und Wein angenommen, wenn auch nicht losgelöst vom subjektiven Glaubensakt, sondern durch den Glaubensakt, wie später besonders Hegel – gegen die katholische Lehre – betonen wird. Für Kepler wird sich um 1611 diese schwierige, ihn lebenslang beschäftigende Materie so darstellen, dass die Konkordienformel in ihrer vehementen Ablehnung der calvinistischen Lehre zu weit geht. Er meint, man müsse als Lutheraner die Calvinisten als Brüder in Christo anerkennen. Die Folge aber ist, dass er später selbst von der lutherischen Kirche, der er sich zugehörig fühlt, als „verschlagener Calvinist“ verurteilt und vom Abendmahl ausgeschlossen werden wird.
Die vorhin beschriebenen Himmelsbeobachtungen des jungen Kepler fallen in die erste Phase seiner Schulzeit, die in Leonberg beginnt. In dieser unweit von Stuttgart gelegenen Stadt, die damals auch Löwenberg genannt wird, hat Keplers Vater Heinrich 1575 dem Seiler Hanns Theürer das Haus Marktplatz 11 abgekauft, und die Eltern haben dort ihren Wohnsitz genommen. Im Herbst 1577 hat der Vater in Löwenberg das Bürgerrecht erlangt. Der Sohn wird sich später denn auch „Underthan vnd Burgerssohn von Löwenberg“ nennen. Im selben Herbst tritt Johannes in die Leonberger Elementarschule ein. Das damalige Schulgebäude – eine Fachwerkkonstruktion wie sein Geburtshaus in Weil – besteht heute noch an der Adresse Pfarrstraße 1. Mit der zweiten Klasse beginnt bereits der Latein-Unterricht. Die damaligen Schüler müssen früh aufstehen: Im Winter ist der Schulbeginn um sieben Uhr, im Sommer bereits um sechs Uhr.
Schon im Dezember 1579 erfolgt der Verkauf des elterlichen Hauses in Leonberg. Dies bringt einen Schulortwechsel für den jungen Kepler mit sich, und zwar nach Ellmendingen bei Pforzheim. In Ellmendingen mieten sich die Eltern im Dorfgasthaus „Zur Sonne“ ein. In den darauffolgenden Jahren, 1580–82, muss Kepler immer wieder bei Feldarbeiten mithelfen: „ich war durch bäuerliche Arbeiten schwer geplagt“, erinnert er sich später.
Nachdem der noch nicht zwölfjährige Schüler am 17. Mai 1583 in Stuttgart das sogenannte Landexamen absolviert und damit die erste Hürde zum späteren Theologiestudium überwunden hat, tritt er im Oktober des Jahres 1584 in die Klosterschule von Adelberg ein. In diesem Internat bleibt er zwei Jahre lang. Die Sitten in dieser Schule sind streng. Den Schülern ist es nicht erlaubt, von sich aus mit dem Personal zu sprechen. Ausgänge sind nur in Begleitung von Aufsichtspersonen erlaubt. Als Schuluniformen sind ärmellose schwarze Mäntel zu tragen, die bis über die Knie reichen. Das Verhältnis zwischen den Zöglingen ist von mancherlei Rivalitäten gekennzeichnet. Immerhin aber bedeutet die Adelberger Periode für Kepler einen regelmäßigen Schulbesuch, denn nun können die Eltern den hochbegabten Jungen nicht mehr für landwirtschaftliche Arbeiten einspannen.
Ab Ende November 1586 finden wir den zukünftigen Astronomen im Evangelischen Seminar von Maulbronn. Eines Nachts – wir schreiben den 3. März 1588 – beobachtet er dort eine totale Mondfinsternis. In schwachem rötlichen Schein steht der Erdtrabant über den alten Klostermauern, lässt die Sterne durch sein Erblassen hell hervortreten und macht einen tiefen Eindruck auf den Jugendlichen. Durch die Streuung des Sonnenlichts in der Erdatmosphäre erscheint der Mond ja auch bei Mondfinsternissen nicht völlig dunkel. Im folgenden Jahr zieht Keplers Vater abermals in die Ferne. Der nunmehr achtzehnjährige Sohn wird ihn nie wiedersehen. Der etwas jüngere, schwierige Bruder Heinrich wird vom Vater vor dessen Weggang noch außer Haus gejagt.
Die lateinische und dann auch die griechische Sprache erlernt Johannes Kepler – dem damaligen Bildungsweg entsprechend – sehr gut. Im Zweifelsfall, etwa wenn es um eine genaue Auslegung der Schriften des Ptolemäus geht, wird er später das griechische Original zu Rate ziehen können, statt sich auf die Lektüre der lateinischen Übersetzung beschränken zu müssen. Mit Blick auf seine Werke und Briefe kann man ferner sagen, dass ihm ein stilistisch fein geschliffener Ausdruck eher auf Lateinisch als auf Deutsch möglich war. In seinen deutschen Schriften verwendet er nicht selten Ausdrücke aus dem schwäbischen Dialekt, etwa „schlims“ für schief, „plackecht“ für mühsam, „Grindt“ für Dickkopf, „Kißbonen“ für Graupel oder Hagelkörner, „hinhotten“ für nebenhergehen. Zu Keplers Meisterschaft im Lateinischen mag die Verpflichtung der Schüler beigetragen haben, sich miteinander und mit den Präzeptoren in dieser Sprache zu unterhalten. Auch die Bibel wird in der Schule in ihrer lateinischen Fassung gelesen. An der Tübinger Universität wird dann noch ein Hebräisch-Unterricht hinzukommen.
Kepler beginnt schon während seiner Schulzeit in lateinischer Sprache zu dichten, und während seiner Studienzeit werden kleine Trauer- und Hochzeitsgedichte aus seiner Feder gedruckt. Er wird diese Gewohnheit auch als arrivierter Forscher weiter pflegen. Auf sein Geburtsjahr (MDLXXI) und seinen Geburtstag (XXVII) verfasst der Latein- und Wortspiel-Freund Kepler ein Chronogramm, das folgendermaßen lautet:
„Joannes Keplerus natus
LVX MVnDI 1571
LUXI nVDaM
DVXI LVnaM“ (GW 19: 392)
Dieses rätselhafte kleine Gedicht ist nicht einfach zu verstehen. Man muss dazu über den unmittelbaren Wortlaut hinausgehen und es frei übersetzen:
„Johannes Kepler [wurde] geboren
Licht der Welt 1571 [d.h. wohl: Weihnachten 1571]
Ich beweinte die Nackte [d.h. die Mutter]
Ich ging dem Mond voraus [d.h.: es war kurz vor Vollmond].“
Ein nach dem Tod seiner ersten Frau 1611 veröffentlichtes lateinisch-deutsches Trauergedicht Keplers, das nichts mehr mit Wortspielen zu tun hat, sondern von großer Sprachgewalt zeugt, werden wir später noch kennenlernen.
Der Forscher entwickelt eine so tiefe Verwurzelung in der lateinischen Sprache, dass er auch seinen deutschen Schriften und Briefen oftmals Wörter wie „alterirn“ (verändern), „confundirn“ (verwirren), „consulirn“ (um Rat fragen), „defendirn“ (verteidigen), „dependirn“ (abhängen), „derogirn“ (abschaffen), „descendirn“ (hinabsteigen) oder „destruirn“ verwendet, was allerdings bei vielen Forschern seiner Zeit zu beobachten ist.
Keplers enormer Ehrgeiz und sein lebhaftes bis heftiges Temperament mögen eine Erklärung dafür bieten, dass er unter den Mitschülern nicht beliebt ist und – ganz im Gegensatz zu seinem späteren Leben – in der Schule keine nennenswerten Freundschaften schließen kann. Neid und Missgunst begleiten ihn. So erinnert er sich als Fünfundzwanzigjähriger an die Schulzeit in Adelberg und Maulbronn:
„Im Januar und Februar 1586 habe ich Hartes erduldet und wäre von Sorgen fast verzehrt worden. Ursache war die Bosheit und der Haß meiner Mitschüler […]. Am 6. Oktober wurde ich für Maulbronn bestimmt, wo ich am 26. November hinkam. 1587 am 4. April befiel mich ein Fieber. Damals machte ich Fortschritte und wurde durch den Haß meiner Mitschüler lange geplagt. Mit einem von ihnen hatte ich im März vorher Kämpfe zu bestehen.“
In derselben autobiographischen Aufzeichnung notiert Kepler selbstkritisch, er sei im Februar 1589 „verdientermaßen in den Karzer“ (also ins Schulgefängnis) gekommen (Schmidt: 220).
Im September 1589 immatrikuliert sich der knapp Achtzehnjährige an der ehrwürdigen Universität Tübingen. Er tritt in das mit dieser Hochschule verbundene Evangelische Stift ein. Dieses Stift ist neben Wittenberg eine besonders starke, trotzige Hochburg des Protestantismus. Es ist eine sehr orthodoxe Spielart des Lutheranismus, die hier vorherrscht. Toleranz gegenüber anderen Konfessionen hat hier zu Keplers Zeit keinen Platz. Ein Grund dafür ist, dass die verschiedenen reformatorischen Richtungen sich erst noch konsolidieren und gegeneinander abgrenzen müssen – oder meinen, dies um jeden Preis zu müssen. Viele Absolventen des Tübinger Stifts werden eine wesentliche Rolle in den geistigen Auseinandersetzungen ihrer Zeit spielen. Andere, wie Keplers späterer Freund Wilhelm Schickard, werden mit grundlegenden Erkenntnissen und Entdeckungen (Rechenmaschine) hervortreten. Dies wird auch noch lange nach Keplers Studienzeit gelten – man denke an die Tübinger Absolventen Hegel, Hölderlin und Schelling.
Ansicht der Universitätsstadt Tübingen aus dem Jahre 1643.
Unter den Lehrern Keplers ist der 1550 in Göppingen geborene Mathematiker und Astronom Michael Mästlin, mit dem ihn später eine lange Brieffreundschaft verbinden sollte. Mästlin hat 1582 ein mehr als fünfhundert Seiten starkes Lehrbuch mit dem Titel Epitome Astronomiae veröffentlicht. Er hält an der Universität unter anderem Vorlesungen über die Elemente des Euklid und über Astronomie nach Ptolemäus. Doch denke man nicht, Kepler habe in Tübingen ein naturwissenschaftlichmathematisches Studium betrieben – dies wäre zu dieser Zeit gar nicht möglich gewesen. Vielmehr studiert er Theologie. Bevor es indes zu einer im engeren Sinne theologischen Ausbildung kommen kann, ist zunächst für die Dauer von zwei Jahren die Artistenfakultät zu absolvieren. Die dort gelehrten Inhalte sind traditionell durch den Kanon der „Sieben Freien Künste“ bestimmt: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musiktheorie sowie Astronomie. Im Rückblick auf sein Studium schreibt Kepler 1609, er habe „von der Mathematik das gelernt, was aufgrund der Schulordnung vorgesehen war, jedoch nichts, was eine spezielle Neigung zur Astronomie bekundet hätte.“ (GW 3: 108) Andererseits anerkennt er in einem anderen Werk, dass Mästlin ihn während der Studienzeit nicht nur in die theoretischen Grundlagen der Astronomie, sondern auch mit der praktischen Himmelsbeobachtung vertraut gemacht habe. Er nennt sogar ein Jahr, nämlich 1591, von dem an Mästlin den Zwanzigjährigen in die Kenntnis des gestirnten Himmels eingeführt habe. Mästlin ist es auch, der Kepler mit den Vorzügen des damals erst fünfzig Jahre alten Weltsystem des Copernicus vertraut macht, sodass der Student von diesem System „entzückt“ ist, wie es in der Vorrede zum Weltgeheimnis (Mysterium Cosmographicum) heißt (GW 8: 23).
Zu den Autoren, die Kepler seit seiner Studienzeit neben der Lektüre der Heiligen Schrift besonders beeinflussen, zählen die Pythagoräer, Platon, Aristoteles, Euklid, Cicero, Vergil, Horaz, Seneca, Plinius, Ptolemäus, Lukian, der späte Neuplatoniker Proklos, der spätmittelalterliche Denker Nikolaus von Kues und der frühneuzeitliche Philosoph Julius Caesar Scaliger. Auch den Renaissance-Philosophen Pico della Mirandola, der unter anderem eine bemerkenswerte Astrologie-Kritik verfasste, dürfte Kepler schon früh studiert haben. Ebenfalls früh vertieft er sich in Luthers 1525 erschienene Ausführungen über die Vorherbestimmung und den unfreien Willen (De servo arbitrio). Von Aristoteles waren für ihn die Werke Physik (Physica), Über den Himmel (De caelo) und Meteorologie (Meteorologica) von besonderer Bedeutung, außerdem die logischen und ethischen Schriften (Selbstcharakteristik: 17). Was Platon betrifft, ist es vor allem der naturphilosophische Dialog Timaios, den Kepler rezipiert und den er auch in seinen späteren Werken zitiert – so etwa in der Vorrede zum fünften Buch der Weltharmonik, wo es sinngemäß in Anknüpfung an eine Timaios-Stelle heißt, der primäre Zweck der Naturforschung sei immer schon die Verherrlichung Gottes gewesen. Von Pythagoras und Platon übernimmt Kepler auch die feste Überzeugung, dass geometrisch-mathematische Verhältnisse die Naturerscheinungen sowie musikalische Harmonien bestimmen. So schreibt er im zweiten Kapitel seines Werkes Weltgeheimnis: „Was bleibt uns übrig, als mit Platon zu sagen, Gott treibe immer Geometrie“. Keplers Neigung zur geometrisch-mathematischen Beschreibung der Welt ist allerdings nicht allein mit pythagoreisch-platonischen Einflüssen zu erklären. Schon der Student Kepler hat ein waches Auge für das Schöne in Natur und Naturbeschreibung – und dazu zählen gewiss geometrische Strukturen, von sechseckigen Schneeflocken über die Kugelgestalt der Sonne bis hin zu abstrakteren Gebilden, deren Beschreibung erst noch die Entwicklung neuer mathematischer Methoden erfordern wird.
Eine weitere Eigenschaft, die Kepler bereits früh auszeichnet, ist seine hohe Rezeptivität und sein großer Respekt vor bedeutenden Autoren aller Zeiten. Während andere neuzeitliche Forscher wie Galilei und Descartes eine starke Abgrenzung gegenüber den verehrten – ihrer Auffassung nach allzu lange und allzu unfruchtbar verehrten – Autoritäten des Altertums anstreben, ist dem Theologiestudenten und späteren Naturforscher aus Schwaben das Bedürfnis eigen, nichts Altes über Bord zu werfen oder neu zu erfinden, was ihm gut oder wenigstens brauchbar erscheint.
Für sein Studium erhält Kepler ein Stipendium seiner Heimatstadt Weil. Dieses wird ihm auch noch nach seiner Magisterprüfung gewährt, mit der er – im August 1591 – den zweitbesten Rang unter vierzehn Studenten belegt. Der Senat der Universität Tübingen befürwortet eine Stipendien-Verleihung mit den Worten, der junge Student sei „dermaßen eines fürtrefflichen und herrlichen ingenii“, dass man große Hoffnungen in ihn setzen dürfe. Der Magistrat von Weil der Stadt bemerkt dazu, dass man Kepler für die Fortsetzung seiner Studien „von Got dem Almechtigen glückh, hayl und alle wolfarth“ wünsche; nebenbei wird erwähnt, dass Keplers „Altvater und Altmutter [also die Großeltern] noch bey uns leben“ (Briefe I: 6f.).
Zu den Tübinger akademischen Lehrern Keplers zählt neben Mästlin der Theologe Matthias Hafenreffer. 1561 in Lorch geboren, ist er zehn Jahre älter als Kepler. Zwischen Hafenreffer und Kepler stellt sich ein nicht immer spannungsfreies Verhältnis ein. Nach dem Weggang des jungen Astronomen aus Tübingen bleiben die beiden durch Korrespondenz verbunden. In einem Brief an Mästlin vom 11. Juni 1598 schreibt Kepler über Hafenreffer: „Wirklich glaube ich nun noch mehr, was ich schon vorher gedacht habe: er ist gar kein Gegner des Kopernikus, aber unter den übrigen Theologen muß er notwendig für die vermeintliche Autorität der Schrift eintreten. Daher sagt er mir seine wahre Meinung nicht.“ (Briefe I: 78f.) Diese Briefstelle ist erhellend in Bezug auf die Verhältnisse an den protestantischen Universitäten des späten 16. Jahrhunderts. Offen für das heliozentrische Weltbild einzutreten, dies konnte einem rechtgläubigen Lutheraner zu jener Zeit erhebliche Schwierigkeiten einbringen. Kepler tut es dennoch. Er schreibt: „In Tübingen habe ich häufig in den physikalischen Disputationen der Kandidaten die Lehre des Copernicus verteidigt.“ (Hoppe: 18) Nur auf dieser früh gelegten Grundlage kann es später zur Auffindung der Keplerschen Gesetze und zur Begründung einer „neuen Astronomie“ kommen.
Hafenreffer wird es übrigens während Keplers Linzer Jahren nicht gelingen, in den Glaubenskonflikten des Astronomen mit den Würdenträgern seiner Kirche eine vermittelnde Rolle zu spielen. Mehr noch: Wenige Monate vor seinem Tod 1619 wird Hafenreffer im Streit um die Abendmahlslehre Keplers „absurde und blasphemische Hirngespinste“ (Briefe II: 134) tadeln.