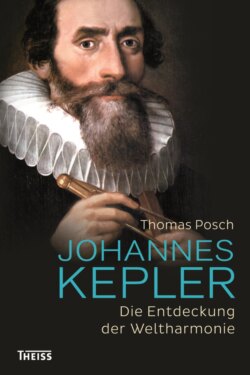Читать книгу Johannes Kepler - Thomas Posch - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Grazer Jahre (1594–1600)
ОглавлениеIm Jahr 1593 wird an der Evangelischen Stiftsschule in Graz durch den Tod des Niederösterreichers Georg Stadius die Stelle eines Mathematik-Lehrers frei. Die steiermärkischen Landstände wenden sich im November jenes Jahres an die hoch angesehene Tübinger Universität mit der Frage, ob man einen geeigneten Kandidaten wisse. Ja, man weiß einen! Aber als Kepler vom Kanzler der Universität Tübingen das Angebot erhält, die Stelle anzutreten, zögert er zunächst. Sein Zögern liegt nicht daran, dass er sich scheuen würde, die württembergische Heimat zu verlassen und auf Wanderschaft zu gehen. Der Hauptgrund ist vielmehr, dass die angebotene Stelle ihn von der Theologie, welche er als seine primäre Berufung ansieht, wegzuführen scheint. Auch Keplers Großvater Sebald teilt diese Bedenken. Als künftigen Prediger, nicht als Mathematiker, sieht man in der Familie den begabten Sprössling. Die Haltung des Familienrats geht aus einem Brief Keplers an die Theologische Fakultät der Universität Tübingen vom 10. März 1594 hervor: „Das Amt, das mir von dem ehrwürdigsten Herrn Kanzler angeboten wird, ist in vieler Hinsicht äußerst ehrenvoll und zudem viel zu ansehnlich, als daß ich es zurückweisen oder seine Annahme von allen möglichen Bedingungen abhängig machen könnte, ohne mich dem Verdacht, allzu anmaßend zu sein, auszusetzen.“ Doch die Familie hätte „es lieber, wenn ich mit meinen Studiengenossen, mit denen zusammen ich seither für dasselbe Ziel erzogen worden bin, mich der Theologie widmen und meine Kraft dereinst, wenn sie erstarkt ist, der Kirche weihen würde.“ (Briefe I: 8)
Der junge Kepler und seine Familie überlassen der Theologischen Fakultät letztlich die Entscheidung über die berufliche Zukunft. Diese fällt in der Tat dahingehend aus, den jungen Theologie-Absolventen als Lehrer der Mathematik nach Graz zu schicken. Manche Kepler-Biographen gehen davon aus, dass Kepler in der Theologie schon in jungen Jahren in hohem Maße eigene Wege zu gehen bestrebt und vieles zu hinterfragen geneigt war; so sehr, dass dies seinen Lehrern missfiel und der vorgeschlagene Fachund Ortswechsel die Reaktion darauf gewesen sein könnte, im Sinne einer Abschiebung des unbequemen Studenten. Diese These ist allerdings umstritten (Caspar: 54f.). Tatsache ist, dass Kepler in seinem späteren Leben, wenn er sich in Notsituationen an die Tübinger Lehrer Mästlin oder Hafenreffer wendet, nicht auf deren substantielle Rückendeckung wird hoffen können.
Am Ostersonntag des Jahres 1594 – am 11. April – kommt Kepler, 23 Jahre alt, in Graz an. Eine Distanz von mehr als sechshundert Kilometern und eine fast einen Monat währende beschwerliche Reise mit einem Pferd und einem Wagen – einschließlich der Überquerung der Alpen – liegen hinter ihm. Begleitet hat ihn ein angeheirateter Vetter, Hermann Jäger aus Metzingen. Die Reisekosten der beiden betrugen 31½ Gulden. Wir wissen nicht, wo sie unterwegs Unterkunft gefunden haben. Wir wissen auch nicht, wie die Alpenlandschaft mit den zu dieser Jahreszeit noch verschneiten, mächtig aufragenden, bis fast 3.000 Meter hohen Gipfeln und den unwegsamen, dünn besiedelten Tälern auf sie gewirkt hat. Hier hilft nur die Fantasie weiter, etwa jene des Schriftstellers Bertold Keppelmüller, der einen Abschnitt der Reise Keplers mit drastischen Worten schildert:
„Ab und zu taucht ein Gehöft aus dem harten Boden auf, eine armselige Bauernhütte, von wenigen schmalen Feldern umschlossen, von Ziegen und magerem Vieh umstellt. Es ist kein erquickender Anblick. Und trittst du in eine der Hütten zur Rast, so zeigt sich dir allenthalben immer wieder dasselbe Bild: trockene Bauernschädel, mit herb verbissenen Lippen mißtrauisch den Fremden musternd, einsilbig und unvertraut. Wenn aber die Bibel zum Vorschein kommt aus dem Reisesack, dann leuchten die Gesichter auf.“ (Keppelmüller: 80f.)
Kehren wir von dieser allzu lebhaften Ausmalung zurück zum sicher Überlieferten. Dazu gehört, dass der in der Hauptstadt Innerösterreichs angekommene Kepler als erstes Quartier ein Zimmer bei dem Schmied Stephan Kirschner in der Schmiedgasse Nummer 5 (heute Nr. 3) bezieht. Das Haus ist nicht mehr erhalten, denn es ging in dem Ende des 19. Jahrhunderts neu erbauten großen kuppelbekrönten Rathaus auf, dessen Fassade dem Hauptplatz zugekehrt ist. Die von dort nach Süden führende Schmiedgasse aber gibt es noch. Zwei Wochen nach seiner Ankunft in Graz befällt das ungarische Fleckfieber den weit Gereisten, nach vierzehn Tagen ist er aber wieder gesund.
Die Stadt am südöstlichen Alpenrand, in die der junge, ehrgeizige Forscher kommt, hat zu jener Zeit etwa 8.000 Einwohner, das sind etwa doppelt so viele wie in Tübingen. Sie ist zu jener Zeit noch mehrheitlich protestantisch. Vor allem im Mittelstand und in Adelskreisen hat die lutherische Konfession zahlreiche überzeugte Anhänger gefunden. Keplers Grazer Jahre stehen jedoch bereits im Zeichen der Gegenreformation. Nach dem Grundsatz „cuius regio, eius religio“ soll die Steiermark als Herrschaftsgebiet der Konfession des Herrschers bzw. der Herrscherin folgen. Kepler kommt also aus einem Gebiet, das als Hochburg der Reformation und gar als „lutherisches Spanien“ gilt, in eine Region, die bald wie viele andere mit unnachgiebigem Fanatismus zum Katholizismus zurückgebracht werden soll. Allerdings gilt seit 1578 und bis fast zum Ende des 16. Jahrhunderts ein Religionsfriede in der Steiermark. Denn im sogenannten Brucker Libell (Dokument von Bruck an der Mur, benannt nach einer 50 Kilometer nördlich von Graz gelegenen Stadt) war den Protestanten noch zugesichert worden, die staatlichen Autoritäten würden sie „in ihrem Gewissen unbekümmert“ lassen, sodass einstweilen von einem gewissen religiösen Pluralismus gesprochen werden konnte. Ein einflussreicher Adeliger, der später Kepler stark fördern sollte – Johann Friedrich Freiherr von Hoffmann –, hatte übrigens durch seinen Einfluss auf den Landesfürsten wesentlich dazu beigetragen, dass das Brucker Libell zustande gekommen war.
Zehn Jahre vor Keplers Eintreffen in Graz ist 1585 die dortige Jesuiten-Universität gegründet worden. Diese heute unter dem Namen „Karl-Franzens-Universität“ bestehende Hochschule wird im späten 16. und im 17. Jahrhundert auf akademischem Boden der Rekatholisierung der Steiermark sowie ihres geographischen Umfelds Vorschub leisten. Der Lutheraner Kepler lässt sich indes keineswegs davon abhalten, Kontakte zu Männern katholischer und reformierter Konfession zu pflegen. Er ist im Gegenteil sehr aufgeschlossen gegenüber Katholiken wie auch gegenüber Calvinisten. Sogar zum Kanzler der Jesuiten-Universität, dem aus den Niederlanden stammenden Johannes Decker, pflegt er gute Kontakte und Erfahrungsaustausch in Sachfragen. Zwei der von ihm verfassten Kalender widmet er dem katholischen Bischof von Laibach (Ljubljana), Thomas Chrön. Der päpstliche Nuntius in Graz, Jeronimo Girolamo Graf von Portia, befördert Briefe Keplers nach Italien. Was den Calvinismus betrifft, ist die Nähe der Steiermark zu Ungarn von Bedeutung. Im Königreich Ungarn hatte der Calvinismus stark Fuß gefasst, und ein gewisser Einfluss auf den Grazer Raum ist durch ungarische Studenten gegeben. Es ist keine leere Phrase, sondern bewusste Positionierung in diesem Konfessionsdreieck Lutheranismus – Calvinismus – Katholizismus, wenn Kepler schreibt: „Ich glaube, daß Gott Völker nicht einfach verdammen wird, weil sie nicht an Christus glauben. Daher rate ich zum Frieden zwischen Lutheranern und Calvinisten, ich bin gerecht gegen die Päpstlichen und empfehle ihnen allen Gerechtigkeit.“ (Schmidt: 218)
Nur vier Jahre vor dem Beginn von Keplers Grazer Zeit, im Jahre 1590, ist Erzherzog Karl von Innerösterreich verstorben. Seine Witwe, Erzherzogin Maria von Bayern, will die gegenreformatorischen Maßnahmen fortsetzen und intensivieren. Ihren Sohn Ferdinand schickt sie im selben Jahr 1590 zum Studium an die Jesuiten-Universität Ingolstadt. Nur pro forma war er im November 1586 ins Matrikelbuch der Grazer Karl-Franzens-Universität eingeschrieben worden. Im Alter von siebzehn Jahren erlangt er 1595 die Erzherzogswürde.
Parallel zu den wachsenden konfessionellen Spannungen ist der geographische Großraum um Graz zu Keplers Zeit einer massiven militärischen Bedrohung ausgesetzt. Truppen des Osmanischen Reiches sind fortwährend im Begriff, Richtung Nordwesten zu expandieren; eben erst im Jahre 1593 hat um die Festung Sisak – etwa 50 Kilometer südöstlich der heutigen kroatischen Hauptstadt Zagreb gelegen – ein heftiger Kampf getobt. Graz war in die Lage gekommen, ein Bollwerk des christlichen Abendlandes gegen das Osmanische Reich zu sein. Die Türkeneinfälle macht Kepler in seinen Grazer Briefen wiederholt zum Thema; so etwa, wenn am 19. April 1597 von einem drohend nahen, 600.000 Mann starken osmanischen Heer die Rede ist (Briefe I: 51). In einem wohltuenden Kontrast zur Festungsfunktion der Stadt, die für sechs Jahre den Lebensmittelpunkt des jungen Astronomen bilden wird, steht deren von der Natur begünstigte Lage, die den Kepler-Forscher Max Caspar zu einem Vergleich mit Tübingen veranlasst hat:
„Als er sich der schönen Stadt an der Mur näherte und den überragenden Schloßberg erblickte, mag er der lieblichen Neckarstadt gedacht haben, in der er seine Studien gemacht hatte und die ebenfalls um einen mit einem Fürstenschloß gekrönten Hügel gelagert ist. Auch in der Milde der Landschaft konnte er etwas Verwandtes mit dem Neckartal, das er verlassen hatte, finden.“ (Caspar: 56)
Wie bereits erwähnt, tritt Kepler an der Grazer Evangelischen Stiftsschule die Nachfolge des Georg Stadius an – eines Mathematikers und Astronomen, der 1550 in Stein bei Krems an der Donau zur Welt gekommen und 1593 in Graz verstorben ist. Schon Stadius hat bei seinem Unterricht der Mathematik oft wenige Schüler gehabt, und schon ihm ist als zweites Standbein seiner Tätigkeit die Aufgabe zugeteilt worden, jährliche Kalender und Prognostika zu erstellen. Dabei galt es, sicher vorauszuberechnende astronomische Ereignisse wie etwa Mond- und Sonnen-Finsternisse aufzulisten, aber ebenso nur angeblich Voraussagbares wie Kriege, Krankheiten und die Witterung zu behandeln. Unterricht und Kalenderabfassung kommen nun auch auf Johannes Kepler zu. Mit seinem Kalender auf das Jahr 1595, den er seinen Vorgesetzten am 1. Oktober 1594 überreicht, sollte er sozusagen Glück haben, da er darin unter anderem große Winterkälte sowie einen Türkeneinfall prophezeit, was beides tatsächlich eintritt. Damals, im Zuge der sogenannten „Kleinen Eiszeit“, sind allerdings sehr kalte Winter in Europa keine Seltenheit. Missernten und Hungersnöte sind die Folge. In Keplers Kalendern aus der Grazer Zeit finden sich sogar Prognosen für das Wetter an einzelnen Tagen (z.B. für den 11.8.1598: „schwülig“; für den 19.8.1598: „Platzregen“) und Angaben dazu, wann – in Abhängigkeit vom Stand des Mondes – das Aderlassen zu vermeiden sei. Solche Ausführungen, die offenbar von ihm erwartet werden, sind aber nicht als individuelle astrologische Vorhersagen gemeint, sondern gehen von der Voraussetzung aus, der Mond habe einen physischen Einfluss auf das gesamte irdische Leben und das irdische Wetter. „Astrometeorologische“ Prognosen werden Forscher noch zweihundert Jahre nach Kepler für realistisch halten.
Die ersten zwei Monate von Keplers Tätigkeit in Graz sind von seinen Vorgesetzten als Probezeit vorgesehen. So schreiben die Kirchen- und Schul-Inspektoren: „Doch wöllen wir ain Monat Zway mit Ime versuechen, wo dan Er mit gwisse Besoldung bestelt wirdt.“ (Briefe I: 10; 19.4.1594) Anfänglich fühlt sich Kepler in Graz nicht recht heimisch und meint, dass seines Bleibens „hier nicht über das folgende Jahr [15]96 hinaus sein kann“ (Briefe I: 17). Das Gebäude der Stiftsschule, in dem er unterrichtet und bis zu seiner Eheschließung auch wohnt, ist noch erhalten. Es handelt sich um den sogenannten „Paradeishof“, ein viergeschossiges Gebäude-Ensemble, das zwischen dem Fluss Mur und dem Anfang der Sackstraße unweit des Grazer Hauptplatzes liegt. Eine Gedenktafel erinnert an der Westseite des Arkadenhofs an Keplers mehrjährige Tätigkeit. Sie beginnt mit den Worten: „Johannes Kepler 1571–1630 lehrte hier an der einstigen protestantischen Stiftsschule 1594–1599 als Professor für Mathematik. In Graz schrieb er sein erstes astronomisches Werk, ‚Das Geheimnis des Weltenbaues‘“. Nach 1600 sollte im Paradeishof ein Kloster der Klarissinnen untergebracht werden.
Der erste Winter, den Kepler in Graz verbringt, ist, wie schon anlässlich seiner Prognostiken erwähnt, extrem kalt. In einem Neujahrsgruß an seinen Tübinger Lehrer Michael Mästlin schreibt der junge Astronom Anfang Januar 1595: „Es herrscht eine ungeheure Kälte in unserer Region. Von den Sennen in den Alpen sterben viele an Kälte. Manchen geht, wie als sicher erzählt wird, wenn sie zuhause angelangt sind, beim Schneuzen die Nase weg; die von der Kälte berührten Glieder gehen in Fäulnis über.“ (Briefe I: 16; 18.1.1595) Glücklich ist also gerade jetzt, wer in einem Haus wohnt und ein gut beheiztes Zimmer hat. Zum Glück erhält Kepler zusätzlich zum Gehalt – modern ausgedrückt – einen Heizkostenzuschuss, damals als „Holzgelt“bezeichnet. Doch die Winterkälte hat 1594/95 nicht nur die Steiermark fest im Griff. Zeitgenössischen Berichten zufolge friert auch der Rhein zu. Selbst die Lagune von Venedig ist nicht mit Schiffen befahrbar.
Zu Beginn des Jahres 1596 beantragt Kepler bei seinen Vorgesetzten eine Reise in seine württembergische Heimat. Seine beiden Großväter sind erkrankt und wollen ihn noch einmal sehen. Ursprünglich will er nur zwei Monate lang seinem Dienstort fernbleiben. Ein entsprechender Urlaub wird ihm denn auch gewährt. Der Großvater väterlicherseits, Sebald, schenkt wahrscheinlich zu diesem Anlass dem jungen Forscher etwas ganz Besonderes: eine Erstausgabe des Hauptwerks von Copernicus. Das entsprechende Exemplar von Sechs Bücher über die Umschwünge der himmlischen Sphären (De revolutionibus orbium coelestium libri VI) samt Keplers Notizen hat sich erhalten und befindet sich heute in der Leipziger Universitätsbibliothek.
Verschiedene Umstände – vornehmlich der Plan der ersten großen Buchpublikation und Verhandlungen über deren Druck in Tübingen – führen dazu, dass Kepler fünf Monate länger ausbleibt als vorgesehen. Die Verordneten der steirischen Landstände erweisen sich in diesem Fall als gnädig und zahlen ihrem Mathematiker dennoch sein Gehalt weiter – trotz seines „langen aussenbleibens“, oder, wie es in einem anderen Aktenstück heißt, obwohl er „vber die Zeit außgewest“ (GW 19: 12). Im August 1596 kehrt Kepler aus dem Stuttgarter Raum zurück nach Graz. Hier steht ihm zunächst eine böse Überraschung bevor.
Bereits einige Monate vor seiner Württemberg-Reise hat Kepler die junge, aber bereits zwei Mal verwitwete Barbara Müller von Mühleck kennengelernt – „seine Venus“, wie er schreibt. Ebenfalls noch vor seiner Abreise haben die beiden eine künftige Eheschließung ins Auge gefasst. Nun aber, nach seiner Rückkehr im Sommer 1596, muss Kepler erfahren, dass der Vater der Braut, Jobst Müller, der Verbindung seiner Tochter nicht zustimmen will. Zu arm, zu wenig materiell abgesichert erscheint ihm der Mathematiker. Andere Darstellungen, denen zufolge Jobst Müller vom Schwiegersohn einen Beweis seiner adeligen Abkunft verlangt hätte, sind umstritten (Caspar: 80). Sicher ist, dass einige Mitglieder der Grazer evangelischen Gemeinde gegen den zeitweilig abwesenden Kepler intrigierten. Zu diesen zählt der Sekretär der Landstände, Stephan Speidel zu Vattersdorf, der über Keplers finanzielle Verhältnisse genauestens Bescheid weiß, zahlt doch sein Vater Sebastian dem Astronomen seine „quatember besoldungen“aus. Stephan Speidel trachtet danach, die junge Witwe Müller mit einem seiner Freunde zu verkuppeln. Das Geschlecht der Speidel stammte übrigens auch aus Schwaben und ließ sich 1596–1603 auf dem Grazer Rosenberg das heute noch bestehende Schlösschen „Rosegg“oder „Speidelsegg“errichten. Auf der anderen Seite setzt sich der Rektor der Evangelischen Stiftsschule bei Familie Müller von Mühleck für Kepler als Bräutigam ein. Der Vater der Braut gibt schließlich seinen Widerstand auf: „als alle Hoffnung geschwunden und der [negative] Ausgang bereits bei der Behörde gemeldet war, erfolgte ein neuer Umschwung“ (Briefe I: 42), schreibt Kepler erleichtert in einem Brief.
Im Februar 1597 folgt das feierliche Eheversprechen, am 27. April dann die Hochzeit. Barbara Müller ist als Tochter eines Mühlenbesitzers, der auch Ländereien besitzt, gesellschaftlich gut situiert. Kepler schreibt dementsprechend an Mästlin: „Ich habe eine Gattin gefreit aus einem vermöglichen Haus“ (Briefe I: 141). Die steirischen Landstände überreichen Kepler als Ehrengeschenk anlässlich der Eheschließung einen silbernen Becher im Wert von 27 Gulden. Barbara bringt eine siebenjährige Tochter namens Regina, Tochter des Hoftischlers Wolf Lorenz, in die Ehe mit, die der Stiefvater sehr ins Herz schließt. Die Ehe wird mehr als vierzehn Jahre dauern – bis zum Tode Barbara Keplers in Prag im Sommer 1611. Aus der Zeit kurz nach ihrem Tod sind ambivalente Urteile Keplers über seine Frau erhalten. So schreibt er einerseits sehr positiv über sie:
Bildnis Keplers aus der Zeit seiner ersten Hochzeit.
„Ich hatte […] eine Frau, der die öffentliche Meinung die Palme der Ehrbarkeit, Rechtschaffenheit und Sittsamkeit darreichte, womit sie unstreitig in seltenster Weise Schönheit des Äußeren und Heiterkeit des Gemüts verband, um von den nach außen hin verborgenen Eigenschaften zu schweigen, der Frömmigkeit gegenüber Gott und der Wohltätigkeit gegenüber den Armen.“ (Briefe I: 393)
Andererseits hält er an eine unbekannte Frau zu seiner eigenen Rechtfertigung, da offenbar negative Aussagen über seine erste Ehe in Umlauf gekommen waren, fest:
„Summa sie ist zorniger Art gewest, und wan sie eines Menschens wegen stättiger beywohnung gewohnt, hatt sie all Ir begehrn mit zorn fürgebracht, da hab Ich mich hingegen zum Streit auffbringen lassen und sie geraitzet, ist mir laid, hab mich wegen meines studirens nit allweg besunnen: hab aber an Ir lehrgelt geben und gelehrnet gedult zu haben.“ (Briefe II: 17)
Aufgrund dieser widersprüchlichen Äußerungen ist es schwierig, sich ein Bild davon zu machen, wie das Zusammenleben von Barbara und Johannes Kepler verlaufen ist. Doch die zweite zitierte Stelle respektive der ganze zugehörige Brief weist auf oftmalige Streitigkeiten hin.
Einen wesentlichen Ort des Zusammenlebens der beiden Eheleute kann man in Gestalt des mutmaßlichen Wohnhauses bis heute besuchen. Er befindet sich in der Grazer Innenstadt, unweit des Landhauses, jenes prächtigen Renaissancegebäudes, wo die protestantischen steirischen Landstände ihren Sitz hatten. Hat man das Landhaus und die Herrengasse im Rücken und geht man Richtung Osten zum jetzigen Bischofsplatz, durchschreitet man die Stempfergasse, wo Keplers Braut schon vor der Eheschließung, der Astronom aber erst ab 1597 wohnte. Das Haus mit der Nummer 6 beherbergt in seinem Innenhof Arkadengänge im Renaissance-Stil. In diesem schönen Gebäude – Eigentum des Georg Hartmann von Stubenberg – befindet sich die Studierstube des Astronomen sowie der Wohnbereich von Barbara und Johannes Kepler. Außerdem steht Kepler der Landsitz Mühleck in Gössendorf – neun Kilometer südlich der Stadt in der Aulandschaft der Mur – gelegentlich als Arbeits- und Wohnbereich zur Verfügung. Sein Schwiegervater ist der Besitzer dieses großzügigen Anwesens, in dessen Dachstuhl ein kleiner astronomischer Turm für den Forscher eingebaut wird. Eine Inschrift-Tafel an der Nordseite dieser alten Mauern erzählt: „Hier an der Heimstätte seiner geliebten Hausfrau Barbara Müller von Mühleck (geb. 1573, verheiratet seit 27. April 1597), lebte und forschte der Astronom Johannes Kepler in den Jahren 1597 bis 1599.“ (Schmidt: 70)
Von der Stempfergasse hat es Kepler nicht weit zur Evangelischen Stiftsschule im Paradeishof, die ihrem Bildungsanspruch nach einer Universität gleichzuhalten ist. Keplers Mathematik-Unterricht verläuft jedoch nicht gerade wunschgemäß. Im ersten Jahr hat er nur wenige Schüler, im zweiten Jahr überhaupt „khaine Auditores“ (GW 19: 8). Das pädagogische Talent Keplers ist wohl nicht sehr groß. Vor allem aber steht die Mathematik nicht im Mittelpunkt des Interesses der Studenten – oder mit anderen Worten: „Mathematicum studium“ ist „nit jedermanns thuen“ (so ein Bericht der Schulinspektoren; GW 19: 8). Ein dritter wichtiger Faktor, der die Entfaltungsmöglichkeiten des jungen Mathematik-Professors einschränkt, ist die schon erwähnte konfessionelle Spaltung. Die 1585 gegründete Grazer Jesuiten-Universität, an der ebenfalls Mathematik unterrichtet wird, zieht in zunehmendem Maße Studenten an. Ihr gegenüber hat es die Evangelische Stiftsschule mit zunehmender Dauer der Gegenreformation schwer, sich zu behaupten. Auch finanziell ist die Lage für die Evangelische Stiftsschule nicht einfach, hat sie doch in der Regel verheiratete Lehrer mit Familien zu versorgen. Für die Jesuiten-Universität gilt dies nicht. Zugleich hat diese einen besseren finanziellen Hintergrund durch reiche, sie fördernde Klöster wie etwa jenes von Seckau. Im Übrigen bleibt es nicht bei einer bloß passiven Konkurrenz zwischen Jesuiten-Universität und Stiftsschule. Vielmehr kommt es zu scharfen Polemiken, zu einer wechselseitigen Störung des Unterrichtsbetriebs, ja sogar zu Handgreiflichkeiten, sodass selbst der Landeshauptmann, Freiherr von Herberstein, schlichtend eingreifen muss.
Das Schloss Mühleck südlich von Graz: Landsitz Keplers und seiner Frau in den Jahren 1597 bis 1599.
Neben den mathematischen Gegenständen unterrichtet Kepler an der Grazer Stiftsschule auch Rhetorik, lateinische Literatur – namentlich Vergil –, später sogar Ethik und Geschichte. In einem Empfehlungsschreiben der Landstände vom 4. September 1600 heißt es, er habe „neben solcher seiner ‚ordinari‘ ihm anbefohlenen mathematischen auch historicam und ethicam professionem treues Fleißes […] verrichtet …“ (Andritsch: 195). Damit folgt er einerseits praktischen Notwendigkeiten, die durch die geringe Zahl an Mathematik-Schülern entstanden sind, andererseits liegt die Möglichkeit zu einem ordentlichen Unterricht dieser Fächer in der Vielseitigkeit Keplers begründet.
Im Jahre 1596 veröffentlicht er jenes Werk, das heute unter dem Titel Weltgeheimnis bekannt ist. Der Originaltitel der Schrift ist allerdings wesentlich länger. Er lautet – immer noch etwas abgekürzt: Prodromus Dissertationum Cosmographicarum, continens Mysterium Cosmographicum De Admirabili Proportione Orbium Coelestium, deque causis coelorum numeri, magnitudinis, motuumque periodicorum (Vorbote Kosmographischer Abhandlungen enthaltend das Weltgeheimnis bezüglich der bewunderungswürdigen Verhältnisse zwischen den Himmelssphären, bezüglich der wahren und eigentlichen Ursachen für Zahl und Größe der Himmelssphären sowie für ihre periodischen Bewegungen). Wie zur damaligen Zeit üblich, fungiert der Titel zugleich als ein kleines Inhaltsverzeichnis, daher die ausführliche Wiedergabe. Er verrät uns, dass es in dieser Erstlingsschrift um die Zahlenverhältnisse der Planetenbahnen geht sowie um die Maßzahlen der periodischen Bewegungen. Das Weltgeheimnis erscheint in Tübingen, also in der ursprünglichen akademischen Heimatstadt des schwäbischen Astronomen, die für ihn ein bleibender Bezugs- und Sehnsuchtsort ist. Als Verleger firmiert der bedeutende und sehr aktive Buchdrucker Georg Gruppenbach. Gewidmet ist das Werk Siegmund Friedrich Freiherrn von Herberstein, dem Landeshauptmann der Steiermark. Das Widmungsdatum ist der 15. Mai. Einen „Vorboten“ nennt Kepler sein erstes Buch, weil diesem ursprünglich vier weitere Bücher über geographische und kosmographische Fragen folgen sollen – ein Plan, der so allerdings nicht zur Ausführung gelangt, auch 1621 nicht, als eine zweite Auflage erscheint.
Kepler ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 25 Jahre alt. Er bekennt sich mutig zum heliozentrischen Weltbild, das seit 1543 – seit der Veröffentlichung von Copernicus’ Werk Sechs Bücher über die Umschwünge der himmlischen Sphären – zur Diskussion steht. Seine Argumente für das heliozentrische Weltbild gehen unter anderem von der Feststellung aus, dass das alternative, geozentrische Weltbild zu viele willkürliche Annahmen enthält. Dabei beschäftigt ihn nicht nur die Frage, ob die Erde oder die Sonne in den Mittelpunkt unseres Planetensystems zu stellen sei, sondern zugleich die Anzahl und Anordnung der Kreise bzw. der aus Kreisen zusammengesetzten Bahnen der Planeten. Diesbezüglich schreibt Kepler im ersten Kapitel, „daß die Hypothesen der Alten einer Reihe von wichtigen Fragen überhaupt nicht Rechnung tragen. Dazu zählt die Tatsache, daß sie für die Anzahl, die Größe und die Zeit der rückläufigen Bewegungen keine Ursachen kennen“ (GW 8: 32). Mit den „Alten“ meint Kepler hier die Anhänger des von Ptolemäus entworfenen Weltmodells. Ihnen stellt er resolut die Forderung entgegen: „Die Natur liebt Einfachheit, sie liebt Einheitlichkeit.“ Und Einfachheit sieht Kepler im copernicanischen Weltmodell viel eher erreicht als im ptolemäischen. Copernicus, so Kepler, habe „nicht nur die Natur von jenem lästigen und unnützen Hausrat der ganzen großen Zahl von Sphären befreit“; er habe zudem „einen immer noch unerschöpflichen Schatz von wahrhaft göttlichen Einsichten in die so wunderschöne Ordnung der ganzen Welt und aller Körper erschlossen“ (GW 8: 33).
Keplersche Vision des Planetensystems im „Mysterium Cosmographicum“ mit den fünf Platonischen Körpern als Anordnungsprinzip.
Der Hauptgedanke des keplerschen Erstlingswerkes geht jedoch über Copernicus weit hinaus: Die Abstände der Planeten von der Sonne folgen einem bestimmten mathematischen Schema. Seit der Antike kannte man die fünf regulären Polyeder, die auch unter dem Namen „Platonische Körper“ bekannt sind: Tetraeder, Oktaeder, Würfel, Dodekaeder und Ikosaeder. Mehr als diese Polyeder lassen sich aus gleichseitigen kongruenten zweidimensionalen Figuren nicht konstruieren, wie Euklid bewiesen hat. Kepler findet eine Möglichkeit, diese Polyeder so ineinander zu verschachteln, dass die ihnen umschriebenen und eingeschriebenen Kugeln die Bahnen der Planeten enthalten und sich dadurch ihre Abstände von der Sonne in guter Näherung darstellen lassen. Der junge Forscher ruft dazu im 14. Kapitel von Weltgeheimnis begeistert aus: „Und nun siehe, wie entsprechende Zahlen einander nahekommen.“ Die Übereinstimmung zwischen den Werten liegt tatsächlich bei 5 % Genauigkeit – bis auf Jupiter.
Verhältnisse zwischen den Planetenbahn-Radien, einerseits nach der Rechnung Keplers auf der Grundlage des Polyeder-Modells, andererseits nach dem Stand des damaligen empirischen Wissens („Wert nach Copernicus“).
Eine Konsequenz aus diesem Entwurf ist die daraus abgeleitete Aussage, dass es nur sechs Planeten in unserem Sonnensystem gebe: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn. In der Tat sind dies die seit dem Altertum bekannten, mit freiem Auge sichtbaren Planeten. Zwischen den sechs Planetenbahnen ergeben sich fünf Zwischenräume. Heute kennen wir allerdings noch zwei weitere äußere Planeten: Uranus, der 1781 von William Herschel entdeckt wurde, und den 1846 aufgrund einer theoretischen Vorhersage gefundenen Neptun. Außerdem verfügen wir seit dem 18. Jahrhundert über die Titius-Bode-Reihe – eine geometrische Zahlenfolge, welche die Abstände der Planeten von der Sonne mit größerer Exaktheit liefert als Keplers Polyeder-Ansatz, wobei sie aber keine Obergrenze für die Gesamtzahl der Planeten impliziert. Aus diesen beiden Gründen wird das Modell Keplers und somit ein zentraler Inhalt des Weltgeheimnisses heute nicht mehr so hoch geschätzt. Dabei wird allerdings etwas verkannt: Keplers intensive Suche nach Zahlen oder geometrischen Strukturen, welche die relativen Planetenabstände beschreiben, ist im Prinzip immer noch ein relevanter Ansatz, als dessen moderne Fortführung man die Suche nach Resonanzen in Planetensystemen ansehen kann. Resonanzen sind ganzzahlige Verhältnisse zwischen den Umlaufzeiten von Planeten, Kleinplaneten und Monden, die einen stabilisierenden Effekt auf die Bahnen haben können.
Die Frage, ob hinter den relativen Distanzen der Planeten von der Sonne eine Systematik steckt, wird Johannes Kepler noch ein Vierteljahrhundert lang beschäftigen. Sie mündet schließlich in die Auffindung des Dritten Keplerschen Gesetzes, das seinerseits eine sehr wichtige Vorstufe zum universellen Gravitationsgesetz Newtons ist. Mit anderen Worten: Schon 1596 hat Kepler die Intuition, „daß die Bewegung (der Planeten) der Enfernung zu folgen scheint“. Modern ausgedrückt: Zwischen Sonnenabstand und Bahngeschwindigkeit besteht ein funktionaler Zusammenhang. Erst im Mai 1618 wird er die Funktion finden, die hinter diesem Zusammenhang steht. Und erst 1687 wird Newton das daraus abgeleitete universale Gravitationsgesetz publizieren. Allerdings fasst Kepler selbst schon im Weltgeheimnis den Gedanken ins Auge, die Sonne sei Sitz einer bewegenden Kraft und dadurch Ursprung der Planetenumläufe. So wird er zum Wegbereiter des Übergangs von der jahrhundertelang dominierenden geometrischen Auffassung der Himmelsbewegungen zu einer physikalischen Erforschung derselben.
Ein schöner allgemeiner Gedanke, der im Widmungsbrief des Weltgeheimnisses enthalten ist, betrifft die Zweckfreiheit der naturwissenschaftlichen Arbeit. Kepler stellt sie auf dieselbe Stufe wie den Selbstzweck-Charakter der Kunst und der Naturschönheit:
„Ja, wir fragen nicht, welchen Nutzen erhofft das Vöglein, wenn es singt […]. Ebenso dürfen wir nicht fragen, warum der menschliche Geist soviel Mühe aufwendet, um die Geheimnisse des Weltalls zu erforschen. Unser Bildner hat zu den Sinnen den Geist gefügt […], daß wir vom Sein der Dinge, die wir mit Augen betrachten, zu den Ursachen ihres Seins und Werdens vordringen, wenn auch weiter kein Nutzen damit verbunden ist.“
Damals wie heute ist das Bekenntnis zur Wissenschaft als in sich selbst begründeter, nicht durch äußeren Nutzen legitimierter Tätigkeit alles andere als selbstverständlich.
Am Ende des Weltgeheimnisses findet sich ein längeres Gebet, aus dem hier einige Verse wiedergegeben seien:
„Ich aber suche die Spur deines Geistes draußen im Weltall, / Schaue verzückt die Pracht des mächtigen Himmelsgebäudes, / Dieses kunstvolle Werk, deiner Allmacht herrliche Wunder. / Schaue, wie du nach fünffacher Norm die Bahnen gesetzt hast, / Mitten darin, um Leben und Licht zu spenden, die Sonne. / Schaue, nach welchem Gesetz sie regelt den Umlauf der Sterne, / Wie der Mond seine Wechsel vollzieht, welche Arbeit er leistet, / Wie du Millionen von Sternen ausstreust auf des Himmels Gefilde. / […] Gott, du Schöpfer der Welt, unser aller ewiger Herrscher! / Laut erschallet dein Lob ringsum durch die Weite der Erde!“ (GW 8: 127f.)
Diese Zeilen fassen verschiedene Aspekte des Erkenntnisstrebens von Kepler zusammen. Sie reichen von der Suche nach den Gesetzen der Planetenbewegung bis zum Erfassen der transzendenten Dimension der kosmischen Phänomene: ihres Ursprungs im Geist des Schöpfers. Kepler hat übrigens im Laufe seines Lebens insgesamt 36 Gedichte mit insgesamt 1600 Zeilen verfasst, was einerseits seine Begabung für dichterischen Ausdruck zeigt, aber für einen Naturforscher des 16. und 17. Jahrhunderts nicht ungewöhnlich war.
Es bleibt zu erwähnen, dass es mehrere Jahre dauert, bis Kepler die Druckkosten für sein Weltgeheimnis rückerstattet bekommt. Im Februar 1599 stellt er in einem Brief an Mästlin enttäuscht fest, er habe die Hoffnung darauf, diese Ausgabe von den Landständen ersetzt zu bekommen, aufgegeben (Briefe I: 99; 26.2.1599). Im Februar 1600 sollte der steirische Landtag endlich doch noch beschließen, eine Summe von zweihundert Talern auszuzahlen. So heißt es in einem Dokument aus jener Zeit, dessen Original sich im steiermärkischen Landesarchiv befindet:
„Ist beratschlagt: Weillen ein Ersame Lanndschafft an des Supplicanten gehorsamen diennsten bißheer ein benüegiges gfallen, vnnd iederzeit genaigt gewest, gelerten leüthen, welche sich löblicher Khünsten vnnd Thuegendten beflissen, füerdernuß zuerweisen, hat Sy ein ersame Lanndschafft, Ime zu etlicher massen ergezung seiner gehabten Mhüe vnnd aufgewenndten vncostens des in Trueckh verfertigten wercks Zwayhundert Taller verehrt …“ (GW 19: 27).
Nach der Veröffentlichung des Weltgeheimnisses nimmt Kepler erstmals mit Galileo Galilei brieflich Kontakt auf. Er schickt dem um sieben Jahre älteren italienischen, in Padua tätigen Naturforscher sein Erstlingswerk und ist sehr neugierig auf dessen Urteil. Galileis Reaktion, die in Form eines Schreibens vom 4. August 1597 überliefert ist, wirkt sonderbar kühl. Schon wenige Stunden nach Erhalt des Werkes und lediglich nach der Lektüre der Einleitung schreibt der „Mathematiker an der Akademie in Padua“, wie er sich selbst nennt, er habe bereits aus den wenigen überflogenen Seiten in etwa Keplers Absicht erkannt und beglückwünsche sich, „einen solchen Mann als Gefährten bei der Erforschung der Wahrheit“ zu haben. Was das Eintreten für das heliozentrische Weltbild betrifft, so meint Galilei unverblümt opportunistisch, er würde es nur dann wagen, mit seinen Gedankengängen an die Öffentlichkeit zu treten, wenn es bereits mehr Copernicaner gäbe. Da dies nicht der Fall sei, wolle er diesen Schritt einstweilen unterlassen (Briefe I: 58; 4.8.1597). Wie sehr hoffte der jugendlich enthusiastische Kepler gewiss auf einen weiteren Brief Galileis! Wir können dies seiner Antwort an den italienischen Kollegen vom 13. Oktober 1597 entnehmen, worin es heißt: „Ich glaube nämlich, daß Ihr inzwischen, wenn es Eure Zeit erlaubte, mein Büchlein eingehender kennen gelernt habt. Da hat mich nun ein heftiges Verlangen ergriffen, Euer Urteil zu erfahren […] antwortet mir mit einem recht langen Brief“ (Briefe I: 58ff.). Im selben Brief macht Kepler einen Vorschlag für ein Beobachtungsprogramm zum empirischen Beweis der Erdbewegung um die Sonne und sucht Galilei dazu zu bewegen, ebenfalls öffentlich für die copernicanische Lehre einzutreten. All dies bleibt vergeblich. Galilei schweigt beharrlich. Der Briefwechsel zwischen dem deutschen und dem italienischen Astronomen kommt nach dem zumindest von einer Seite her schwungvollen Anfang für mehr als ein Jahrzehnt zum Erliegen. Erst im Zuge des erstmaligen Einsatzes des neu erfundenen Teleskops für astronomische Beobachtungen wird die Korrespondenz im Jahre 1610 wieder aufleben. Einer kontinuierlichen Korrespondenz über viele Jahre hinweg steht im Weg, dass die beiden Forscher sehr unterschiedliche Charaktere haben, wobei Galilei weniger auf Dialog und offenen Gedankenaustausch hin orientiert ist, dafür umso mehr ein in sich ruhendes Überlegenheitsgefühl, vielleicht sogar eine Portion Narzissmus besitzt. Auch weltanschaulich gibt es deutliche Unterschiede: Galilei ist, um es mit einem modernen Wort zu sagen, eher metaphysikkritisch, während Kepler seine Erneuerung der Astronomie in Fortführung, nicht in Abhebung von der antiken Naturphilosophie und Metaphysik zu vollziehen sucht.
Deutlich mehr Glück als bei Galilei hat Kepler mit seinem Erstlingswerk bei dem dänischen Astronomen Tycho Brahe. Für diesen, den genauesten astronomischen Beobachter der damaligen Zeit, hegt Kepler – und nicht nur er – große Bewunderung. Insgeheim hofft er auf eine Zusammenarbeit mit dem Dänen. Dies geht aus der 1627 veröffentlichten Widmung der Rudolphinischen Tafeln (Tabulae Rudolphinae) an Kaiser Ferdinand II. hervor, wo Kepler rückblickend auf die frühen 1590er-Jahre schreibt: „Noch nicht schickte damals Tycho regelmäßig seine Briefe an mich; noch nicht war jener nach Böhmen gekommen. Freilich ein Gefühl für das unmittelbar bevorstehende schicksalhafte Ereignis [= die Begegnung mit Tycho] zeigte meine Wünsche an.“ (Tafeln: 7).
Seinen eigenen hochfliegenden Wünschen entsprechend sendet Kepler Tycho Brahe sein Erstlingswerk. Der Däne hat zu dieser Zeit seine Heimat bereits verlassen, ist aber noch nicht in Prag eingetroffen. Er weilt auf Schloss Rantzau bei Hamburg, wohin seine Bibliothek und seine Instrumente transferiert worden sind. Im Gegensatz zu Galilei teilt er Kepler in einem Brief vom 11. April 1598 mit, dessen Weltgeheimnis als Ganzes durchgelesen zu haben – zumindest „soweit es anderweitige Arbeiten gestatteten“. Er lobt den feinen Verstand und das scharfsinnige Studium des deutschen Astronomen, bringt aber zugleich eine gewisse inhaltliche Kritik an seinem Polyeder-Modell des Sonnensystems vor. Zwar zweifelt Tycho Brahe nicht daran, „daß im Weltall von Gott alles nach einer bestimmten Harmonie und Proportion aufeinander bezogen und geordnet ist“ (Briefe I: 64), doch meldet er Zweifel an, ob es möglich sei, eine durchgängige Übereinstimmung zwischen a priori gefundenen Bahnradien und deren empirisch zu ermittelnden Werten zu erzielen. Tycho Brahes Stärke ist die genaue Beobachtung des Himmels, was ihn allerdings nicht hindert, ein eigenes Weltsystem zu entwerfen, in dem die Sonne um die Erde kreist, alle andere Planeten aber um die Sonne. Tycho Brahe ist nach heutigem Sprachgebrauch ein beobachtender Astronom, und zwar einer, der seine Kunst präziser als alle Zeitgenossen beherrscht. Dies mag seine Zweifel an Keplers (noch) nicht primär auf Beobachtungsdaten gegründetem Polyedermodell motivieren. Doch auch Kepler, dessen Stärke mehr in der theoretischen Astronomie liegt, bevorzugt im Prinzip empirische Daten als Quelle der Erkenntnis. Allerdings fehlt ihm oft der Zugang zu solchen Daten, und seine Versuche, sie selbst zu gewinnen, bleiben vielfach unzulänglich. Es wird sich daher als Segen für Kepler und Tycho Brahe sowie für den Erkenntnisfortschritt der Menschheit erweisen, dass die beiden später, wenn auch nur für wenige Monate, in Prag zusammenarbeiten. Von Keplers Reise nach Böhmen Anfang des Jahres 1600 – dem eigentlichen Ausgangspunkt der Kooperation zweier großer Forscher – wird noch zu berichten sein.
Wie weit Kepler von den Beobachtungskünsten Tycho Brahes entfernt ist, aber auch, dass er sich sehr um eigene Himmelsbeobachtungen bemüht, zeigt die folgende Episode aus seiner Grazer Zeit. Zwischen dem 2. Oktober 1597 und dem 25. September 1598 führt der Astronom eine Serie von Himmelsbeobachtungen durch, die eine genaue Bestimmung der Höhe des Polarsterns zum Ziel haben. Er bringt dabei ein von ihm selbst aus Holzlatten zusammengebautes Winkelmessgerät zum Einsatz. Als Beobachtungsplatz dient ihm eine turmartige Erhöhung, die sich glücklicherweise an einem Nachbarhaus in der Stempfergasse befindet.
Der Grundgedanke bei Keplers Beobachtungsprojekt ist zukunftsweisend: Wenn sich die Erde um die Sonne bewegt, wie Copernicus lehrt, dann muss sich eine geringfügige Positionsänderung der Fixsterne im Jahreslauf nachweisen lassen. Der Polarstern ist das ganze Jahr hindurch an derselben Stelle des Himmels zu sehen, also liegt es nahe, die erwartete Positionsänderung anhand dieses Sterns zu studieren. Sollte sich eine winzig kleine elliptische Bewegung des Polarsterns im Jahreslauf nachweisen lassen, so dürfte Kepler wie einst Archimedes ausrufen: „Heureka!“. Denn dann hätte er als erster Mensch in der Geschichte ein direktes Maß für die Fixsternentfernung gefunden. Leider fällt seine Messserie negativ aus: Mit seinem armseligen Instrument, über das er sich sogar selbst lustig macht und dessen Messgenauigkeit er mit nur acht Bogenminuten angibt, kann er keine Höhenänderung des Polarsterns über Graz feststellen. Doch auch dieses negative Ergebnis ist ein Ergebnis. Es liefert nämlich eine untere Schranke für die Entfernung des Sterns Polaris. In moderner Terminologie ausgedrückt lautet das Ergebnis: Der Polarstern ist mindestens fünfhundert Astronomische Einheiten von der Erde entfernt (Briefe I: 88f.; 16.12.1598). Seit den 1830er-Jahren wissen wir, dass die nächstgelegenen Fixsterne etwa tausend Mal weiter entfernt sind, als Kepler aus seiner Beobachtungsserie ableitet. Es wird also im Nachhinein deutlich, dass er anno 1598 – noch ohne teleskopische Hilfsmittel, mit einem behelfsmäßigen Instrument – keine Höhenänderung des Polarsterns im Jahreslauf messen kann.
Das Jahr 1598 bringt ein interessantes astronomisches Ereignis, doch mehrere für Kepler schmerzhafte Vorfälle mit sich. Das astronomische Ereignis ist eine teilweise Verfinsterung der Sonne am 7. März, von der Kepler schreibt: „die hab ich zu Grätz observirt“. Und weiter: Die „gantze wehrung“, also die Gesamtdauer der Finsternis, habe dreieinhalb Stunden betragen – von 10.20 Uhr bis „fünff minuten vor 1 uhr“. Zufrieden stellt Kepler in seinem Bericht fest, dass jene beobachteten Anfangs- und End-Zeitpunkte in guter Übereinstimmung mit seinen Berechnungen standen, die 10.27 Uhr bis 12.52 Uhr als Dauer der Finsternis ergaben (Opera Omnia 8: 15).
Nun aber zu den turbulenten politischen Ereignissen. Am 11. Juni 1598 teilt Kepler seinem Lehrer Mästlin mit: „Wir aber wollen ihn [= Gott] bitten, er möge den unschuldigen Sinn des so jungen Fürsten gegen seine so verderblichen Ratgeber wappnen.“ (Briefe I: 76) Mit dem jungen Fürsten ist der damals zwanzigjährige Erzherzog Ferdinand von Innerösterreich gemeint. In der Hoffnung auf einen „unschuldigen Sinn“ desselben sollte sich Kepler täuschen. Der junge Erzherzog wird sich sehr bald als Fanatiker erweisen, als ein Mensch, der fest dazu entschlossen ist, alle Regungen protestantischen Geistes in seinem Herrschaftsgebiet zu ersticken. Ein Vierteljahrhundert später – während seiner Linzer und Saganer Zeit – wird Kepler demselben Mann als römisch-deutschem Kaiser gegenüberstehen.
Im September 1598 erfolgt auf Erzherzog Ferdinands Befehl die Schließung der Grazer Evangelischen Stiftsschule. Eine Institution, die sich vierundzwanzig Jahre lang unter teilweise schwierigen Umständen halten konnte und die mit ihren Gelehrten das Potenzial zu einer bedeutenden Universität hatte, ist damit fast über Nacht Geschichte. Noch mehrere Jahre später bedauert Kepler in seinem Werk Über den neuen Stern im Fuß des Schlangenträgers (De Stella Nova in Pede Serpentarii), dass das Jahr 1598 ihm große Sorgen gebracht und „eine Art von astronomischem Stillstand“ bei ihm bewirkt habe.
Mit sofortiger Wirkung werden die protestantischen Prediger und Lehrer des Grazer Stifts kraft einer Verordnung des Erzherzogs Ferdinand des Landes verwiesen – sie müssen also Innerösterreich verlassen. Mit „Zehrgeld“ (GW 19: 24) ausgestattet, nehmen Kepler und eine Schar weiterer Exulanten den Weg durch das Tal der Mur (teils wohl über den Fluss selbst) nach Süden und in weiterer Folge nach Osten. Dabei regnet es tagelang ungewöhnlich stark, was Kepler einer Konjunktion von Mars und Merkur sowie einem „langweiligen Sextil von Mars und Venus“ zuschreibt (GW 4: 254). Kurz nach Bad Radkersburg überqueren sie die Grenze zur ungarischen Reichshälfte, in der sie am 2. Oktober eintreffen. Die protestantischen Landstände haben zeitgleich mit der Abreise der Ausgewiesenen zwei ungarischen Grafen die Bitte übermittelt, ob sie aus christlicher Liebe diesen Personen vorübergehend Zuflucht gewähren könnten. Und in der Tat: Auf der neun Kilometer südöstlich von Radkersburg gelegenen Wasserburg von Petanzen (heute: Petanjci) findet Kepler für einige Zeit Schutz und Unterkunft. Die Burg ist Herrschaftssitz des Grafen Thomas Nádasdy und liegt im Gebiet des Kaisers, über das Erzherzog Ferdinand nicht herrscht. Keplers Frau Barbara bleibt, soweit wir wissen, in Graz oder im heimatlichen Schloss Mühleck zurück. Ihr Gatte wollte ursprünglich seine Flucht bis nach Varaždin im heutigen Kroatien fortsetzen, doch die aus den starken Niederschlägen resultierenden Überschwemmungen vereiteln seinen Plan. Der Astronom wohnt also vorerst auf der Nádasdy-Burg – dem mit 46°39′ geographischer Breite südlichsten Punkt auf der Erde, den er je erreichen sollte.
Unverhofft erhält der Exilierte noch im Oktober die Nachricht, er dürfe, im Unterschied zu seinen Glaubensgenossen, doch in die Steiermark zurückkehren und seine Stelle als Mathematiker der Landstände – freilich nicht mehr als Lehrer – einnehmen. Doch solle er künftig „gebürliche beschaidenheit gebrauchen“, damit der Erzherzog keinen Anlass haben möge, die dem Forscher erwiesene „gnad“ wieder aufzuheben. (GW 19: 24)
Man hat darüber gerätselt, warum für Kepler eine Ausnahmeregelung erlassen worden ist. Dies liegt wohl daran, dass er – wegen seiner eher ökumenischen Orientierung und seiner Kontakte zu katholischen Gelehrten – einflussreiche Fürsprecher am Grazer Hof und darüber hinaus hat. Doch hat er sich nicht etwa dem katholischen Hof angebiedert, sondern aus tiefster Überzeugung höhnische Polemiken und spöttische Predigten seiner evangelischen Glaubensbrüder, die über ihr Ziel hinausschossen, abgelehnt und sich klar davon distanziert. In einem Brief an den am Münchner Hof in leitender Stellung tätigen Herwart von Hohenburg schreibt er zu dieser Zeit die bekannt gewordenen Worte:
„Ich bin ein Christ, die Augsburger Konfession habe ich aus der Belehrung von meinen Eltern her, in wiederholter Erforschung ihrer Begründung [!], in täglichen Erprobungen in mich aufgenommen, an ihr halte ich fest. Heucheln habe ich nicht gelernt. Mit der Religion ist es mir ernst, ich treibe kein Spiel mit ihr.“ (Briefe I: 91)
Herwart von Hohenburg ist im Übrigen selbst ein hervorragendes Beispiel für Keplers Freunde katholischer Konfession. Mit ihm verbindet ihn eine jahrelange und von großer Nähe zeugende Korrespondenz.
Auch den Vertretern der Gegenreformation ist es „ernst“ mit der Religion, allerdings in einem völlig anderen Sinne. Ihnen geht es um ein machtbewusstes Streben, das nicht eher ruht, als bis es zu seinem Ziel gelangt. So kontrolliert man jetzt an den Stadttoren, ob keine protestantischen Bücher mehr importiert werden. Man stellt die Lektüre der Lutherbibel unter Strafe und verbietet das Singen evangelischer Choräle. Vorbei sind die Zeiten des erst zwanzig Jahre zuvor verabschiedeten Brucker Libells, in denen man den Protestanten noch freie Religionsausübung zugestanden hatte.
Doch damit nicht genug. Der kleine Heinrich Kepler – gleichen Namens wie der Vater und der Bruder des Astronomen –, geboren im Februar 1598, stirbt schon Anfang April. Die kleine Susanna Kepler, geboren im Sommer 1599, wird nur 35 Tage alt. Als Todesursache gilt in beiden Fällen eine Gehirnhautentzündung. Der verzweifelte Vater schreibt an Mästlin nach dem Verlust seines zweiten Kindes: „Gott hat auch diese Frucht dargeboten, um sie wieder wegzunehmen.“ Sollte er selbst „bald nachfolgen […], so träfe ihn dieses Geschick nicht unerwartet.“ (Briefe I: 112) Er fürchtet nämlich im Sommer 1599, an einer Seuche zu erkranken. Auch seine Frau stürzt der Tod der beiden Kinder in tiefe Verzweiflung.
Schwierigkeiten hat das Ehepaar sogar mit der Bestattung der sterblichen Überreste der Tochter, und zwar wiederum aus konfessionellen Gründen. Da Kepler beim Begräbnis die städtische katholische Geistlichkeit übergangen hat, wird ihm eine Strafe von zehn Talern auferlegt, von der man ihm auf sein Ersuchen nur die Hälfte erlässt.
Trotz seiner seit einem Jahr bestehenden Schwierigkeiten, trotz seiner gefahrvollen Lage, trotz des Todes von Heinrich und Susanna konzipiert Kepler im Sommer 1599 die ersten Umrisse zu einem Buch, mit dem er später in die Wissenschaftsgeschichte eingehen wird, die Weltharmonik. Dies geht aus der Korrespondenz mit Herwart von Hohenburg hervor, unter anderem aus einem Brief vom 14. Dezember 1599. Als vorläufigen Buchtitel gibt Kepler an: De Harmonice Mundi Dissertatio cosmographica. Doch erst der lange, mühselige Umweg über die Analyse der Planetenbeobachtungen Tycho Brahes wird das projektierte Werk zu dem machen, was es zwanzig Jahre später werden sollte.
Die Geschichte der Annäherung Johannes Keplers an Tycho Brahe ist überaus merkwürdig und spannungsreich. Kepler selbst sieht darin das Wirken einer göttlichen Vorsehung. Es bedurfte für die Begegnung und Zusammenarbeit der beiden Forscher der Kombination vieler Faktoren, die – wie die Aufgabe der jeweiligen Heimatstätte – für die Beteiligten alles andere als angenehm waren. Tycho Brahe gehört zu jenen Autoritäten der astronomischen Fachwelt, von denen der aufstrebende Forscher Ende 1597 Anerkennung erhofft. Aber erst als die Lage der Protestanten in Graz eine ganz und gar verzweifelte geworden ist, spricht Kepler offen einen Gedanken aus: „Ich spähe überall nach einer Gelegenheit aus, wie ich ohne Kosten nach Prag zu Tycho gelangen kann, wo ich vielleicht nach einem Besuch bei ihm die Gelegenheit finden werde, mich auf die Wahl eines Wohnortes zu besinnen.“ (GW 14: 87; an Mästlin, 22.11.1599) Nun ergibt es sich, dass Tycho Brahe im Dezember 1599 einen Brief an Kepler sendet, in dem er nochmals sehr positiv auf dessen Erstlingswerk Bezug nimmt und den 25 Jahre jüngeren deutschen Astronomen zu sich nach Böhmen einlädt.
Anfang Januar 1600 reist Kepler von Graz in Richtung Böhmen ab, in der Hoffnung, dort zu Tycho Brahe in persönlichen Kontakt treten zu können. Die Hoffnung wird zusätzlich genährt durch Johann Friedrich Hoffmann Freiherr zu Grünbühel und Strechau, der Kepler schätzt, Tycho Brahe kennt, Hofrat bei Kaiser Rudolph in Prag ist und ebenfalls dorthin reist. Seine Stammgüter Grünbühel und Burg Strechau liegen bei Rottenmann in der Obersteiermark, etwa auf halbem Weg von Graz Richtung Linz. Die Feste Strechau, auf einem hohen Felsen gelegen, kann man heute noch als die zweitgrößte Burg der Steiermark bestaunen. Sie überragt die nahe Stadt Rottenmann um 200 Meter und liegt 864 Meter über dem Meeresspiegel. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Kepler und Hoffmann dort auf ihrer Reise von Graz nordwärts, an der Schwelle zum Tal der Enns, übernachtet haben. Von dort aus ist der Weg nach Prag allerdings noch weit. Aus Dankbarkeit für das Weggeleit und die Vermittlung des Kontakts zu Tycho Brahe widmet Kepler 1606 Johann Friedrich Hoffmann seine kleine Schrift Vom Stern dritter Größe im Schwan (De stella incognita cygni). Den Protestanten aus dem Geschlecht der Hoffmann zu Grünbühel und Strechau sollte später die Ausweisung aus der Steiermark ebenfalls nicht erspart bleiben.
Das Schloss Benatek, wo Kepler und Tycho einander erstmals begegneten.
Tycho Brahe hat sich zuvor, 1599, auf Schloss Benatek, etwa 35 Kilometer nordöstlich von Prag, niedergelassen. Kaiser Rudolph II., der große Förderer der Künste und Wissenschaften, hat ihm dies ermöglicht, und Tycho Brahe zieht zunächst ein ruhiges Schloss auf dem Land der geschäftigen Stadt vor. Am 4. Februar – wenige Tage vor dem tragischen Tod Giordano Brunos auf einem Scheiterhaufen in Rom – trifft Kepler in Benatek ein. Trotz des grundsätzlichen Wohlwollens des dänischen Astronomen und der Vermittlung des Freiherrn Hoffmann ist es für den Gast aus dem Süden nicht einfach, Tycho Brahe auf Augenhöhe zu begegnen. Zwar ist auch Tycho Brahe zu jener Zeit ein Mann, der seine Heimat mit der zunächst unsicheren Fremde vertauscht hat; doch auch in Benatek ist er ein Schlossherr mit Dienern und Gehilfen, er ist ein arrivierter Forscher und steht in kaiserlichen Diensten. Er hat eine Position erreicht, die Kepler erst noch sucht. So kann es kaum ausbleiben, dass Konflikte zwischen Tycho Brahe und seinem Gast entstehen, die bis zu einem Zerwürfnis Anfang April reichen, als Kepler, der sich gedemütigt fühlt, voller Grimm nach Prag reist. Es folgt ein kurzer brieflicher Schlagabtausch zwischen den beiden, der damit endet, dass Kepler alle Schuld auf sich nimmt und um Verzeihung bittet. Im Mai kommt es zu einem zukunftsweisenden Vertrag zwischen Tycho Brahe und Kepler, in welchem letzterer verspricht, dem Dänen „zwei Jahre lang an die Hand zu gehen“ (Briefe I: 143) – also ihm für die Auswertung seiner umfangreichen Beobachtungsdaten zur Verfügung zu stehen. Ersterer verspricht Kepler dafür, seiner Not durch Empfehlungen beim Kaiser Abhilfe zu schaffen.
Am 1. Juni 1600 reist Kepler von Benatek Richtung Graz ab. Er wählt auf der Rückreise den Weg über Wien, da ihn ein gewisser Friedrich Rosenkrantz in seinem Wagen dorthin mitnimmt. Kepler hofft, später mit seiner Familie als gut bezahlter Astronom nach Böhmen zurückzukehren. So schreibt er im Vorwort zu den 1627 erschienenen Rudolphinischen Tafeln: „Nachdem ich mit ihm [= Tycho Brahe] einig geworden war, bin ich im Juni in die Steiermark zurückgekehrt, um meine Familie und meine Bibliotheksausrüstung zu holen.“ (Tafeln: 23) Dennoch wird er in den kommenden Monaten wegen der Ungewissheit der ihm in Prag gebotenen Perspektive durchaus auch Versuche unternehmen, andernorts eine Anstellung zu erhalten, nicht zuletzt in seiner alten Heimat Württemberg. Wie groß Keplers Unsicherheit ist, ob er wirklich am Prager Hof eine Zukunft hat, können wir daraus ersehen, dass er im Herbst 1600 bei seiner abermaligen Fahrt von von Graz sogar seine Habe in Linz deponieren wird, um von dort nötigenfalls donauaufwärts Richtung Tübingen zu gelangen.
Die steirischen Landstände dagegen machen ihrerseits dem zurückgekehrten Kepler im Sommer 1600 einen Vorschlag zur beruflichen Neuorientierung, wie man heute sagen würde. Sie raten ihm, sich nach Italien zu begeben, um sich dort einem weiteren Studium – jenem der Medizin – zu widmen, am besten an der Universität von Padua. Hätte Kepler diesen Vorschlag aufgegriffen, so wäre er für einige Zeit an derselben Universität gewesen wie Galilei – allerdings als Student, während jener dort eine Professur innehatte. Doch mit Recht erscheint Kepler ein neues Studium in Padua als ein unvernünftiges Ansinnen. Die Unvernünftigkeit liegt dabei nicht so sehr in der Fremdheit des Fachs Medizin, denn dieses war zur Zeit der Renaissance nicht so von Astronomie und Astrologie entfernt, als dass er sich nicht prinzipiell in die Heilkunde hätte einarbeiten können. In einer Anmerkung zu seinem Buch Der Traum, oder: Mond-Astronomie schreibt er sogar: „Medizin und Astronomie sind verwandte Wissenschaften, sie stammen aus derselben Quelle: dem Wunsch, die Naturerscheinungen zu verstehen.“ (Traum: 33) Auch Copernicus hatte die Grundlagen der Medizin studiert und als Arzt gearbeitet. Aber gerade jetzt, wo Tycho Brahes Beobachtungsdaten einer Aufarbeitung harren, wo Kepler die Kraft in sich fühlt, der Astronomie ein neues Fundament zu geben, erscheint ihm ein Studium im fernen Italien, um dann etwas vorgeblich Nützlicheres zu leisten, als der falsche Weg. So bleibt er vorerst in Graz.
Am 10. Juli 1600 trägt sich eine teilweise Verfinsterung der Sonne zu. Von der innerösterreichischen Landeshauptstadt aus gesehen wird im Maximum der Finsternis knapp die Hälfte der sichtbaren Sonnenoberfläche vom Mond verdeckt. Es wird also an jenem Tag gegen 13.35 Uhr merklich dunkler als gewöhnlich um diese Zeit bei klarem Himmel. In Teilen Spaniens und Portugals tritt sogar eine totale Sonnenfinsternis ein. Kepler begibt sich zur Beobachtung des seltenen Himmelsereignisses auf den Hauptplatz der Stadt und bringt ein von ihm selbst verfertigtes Instrument auf Lochkamera-Basis zum Einsatz. Er stellt fest, dass der scheinbare Durchmesser des vor der Sonne stehenden Mondes in der Projektion durch die Lochkamera kleiner ist als bei direkter Beobachtung. Dieses Phänomen erklärt er nach den Gesetzen der geometrischen Optik: Keineswegs wird der Mond selbst während der partiellen Phasen einer Sonnenfinsternis kleiner, sondern das Bild der Sonnensichel wird aufgrund der Unschärfe der Lochkamera-Abbildung vergleichsweise größer. Der Effekt macht immerhin rund zehn Prozent aus. Ein lange bestehendes Rätsel ist gelöst.
Im Verlauf der Finsternis wird der in finanziellen Dingen immer wieder von Unglück heimgesuchte Kepler bestohlen. Ein Dieb nutzt das Himmelsereignis aus, um ihm ganze dreißig Gulden – fast zwei Monatsgehälter – zu entwenden. Kepler schreibt dazu an Mästlin:
„Während ich auf die Herstellung eines besonderen Instruments und auf die Errichtung eines Gestells unter freiem Himmel bedacht war, hat ein anderer ebenfalls die Gelegenheit wahrgenommen, um eine andere Finsternis zu erforschen; er hat zwar nicht bei der Sonne, aber in meinem Geldbeutel ein Schwinden verursacht, indem er mir 30 Gulden weggenommen hat. Wahrlich eine teure Finsternis!“ (Briefe I: 140)
Ebenfalls im Juli wird die religiös-politische Lage in Graz vollends inquisitionsartig. Erzherzog Ferdinand erlässt eine Verordnung, in der allen Bürgern und Einwohnern der Stadt mit Ausnahme der Altadligen unter Androhung einer Geldstrafe befohlen wird, am 31. Juli frühmorgens in der Kirche zu erscheinen und ihre Konfession anzugeben. Wer dann nicht angibt, „römisch-katholisch“ zu sein oder es schleunigst wird, hat binnen kurzer Frist des Erzherzogs Länder zu verlassen. Man stelle sich dieses schreckliche Verhör vor, das Hunderten Einwohnern der Stadt angetan wird. Fünfzig von ihnen entscheiden sich unter dem enormen psychischen Druck zum Übertritt. Kepler aber bleibt standhaft und bekennt sich weiterhin zur lutherischen Konfession. Dennoch werden am 3. August Gerüchte in Umlauf gebracht, Kepler sei zum Katholizismus konvertiert. Diese Gerüchte müssen schon tags darauf widerrufen werden. Knappe zwei Monate schreibt Kepler in einem Brief: „Ich hätte nicht geglaubt, daß es so süß ist, in Gemeinschaft mit etlichen Brüdern für die Religion, für Christi Ruhm Schaden und Schimpf zu erleiden, Haus, Äcker, Freunde und Heimat zu verlassen.“ (Briefe I: 142) Er geht sogar noch weiter und äußert, er sei bereit, wenn nötig, für den Glauben zu sterben. In Graz wird anno 1600 zwar kein Mensch als Ketzer verbrannt, wohl aber kommt es zu einer großen Bücherverbrennung am Abend des 8. August. In der Nähe eines der Stadttore, beim sogenannten Paulustor, werden zehntausend lutherische Bücher aufgetürmt und verbrannt. Wenige Tage zuvor, am 3. August, schreibt der innerösterreichische Kanzler Wolfgang Jöchlinger an Erzherzog Ferdinand: „Das Rathauß ist voll der sectischen Büecher. Man wirt es [sie] nothwendig verprennen: vnd das hauß lären müessen: damit die vbrigen auch hinein bracht mögen werden.“ (GW 19: 28)
Eine Konsequenz jener Vorgänge ist, dass Kepler mit seiner Familie im September 1600 die Steiermark verlassen muss. Es ist dies ein besonders für Keplers Frau schmerzhaftes Vertriebenwerden, es ist eine Flucht in ein fremdes Land, wo unter Kaiser Rudolph II. größere religiöse Toleranz herrscht, doch es ist kein Abschied ohne Wiederkehr. Denn von April bis September 1601 wird der Astronom wieder in Graz sein, um eine Erbschaftsangelegenheit zu regeln, ohne dabei von der Regierung behelligt zu werden. Glücklicherweise findet er schon jetzt, zum Zeitpunkt seiner Ausweisung, einen Pächter für die Güter seiner Frau. Auch diese wird zwei Jahre später noch einmal ihre Heimat wiedersehen.
Von großer Schönheit, aber auch von wissenschaftlichem Wert ist die Beschreibung einer Expedition auf das 1445 Meter hohe Kalkstein-Massiv des Schöckels, die Kepler im Sommer 1601 durchführt. Zeitlich gehört diese Wanderung zwar schon in die Zeit nach der Übersiedlung nach Prag, aber geographisch gehört sie zu den Grazer Jahren. Kepler beschreibt seine Erlebnisse in einem Brief an David Fabricius so:
„In der Steiermark ist ein Berg Schöckel; wenn dieser sich mit einer kleinen Kappe bedeckt, steht sicher ein Unwetter bevor. Es ist dies ein Berg von steiler ungeheurer Höhe, der die umliegenden Berge, die wahrlich auch nicht niedrig sind, um die Hälfte einer deutschen Viertelmeile überragt […]. Als ich auf ihm eine Beobachtung über die Krümmung der Erde mit Hilfe der Berge ohne den Himmel anstellte, sah ich […] viel Ergötzliches. Als wir an einem Sonntag hinaufstiegen, herrschte erst eine klare heiße Luft. Als wir auf dem Gipfel des ragenden Felsen standen, erhoben sich unterhalb des Berges allmählich Nebel. In Graz […] herrschte ein starkes Gewitter mit Donnerschlägen, die wir nicht hörten. Wir sahen alles unter uns. Die unteren Berge, nach denen wir zu visieren hatten, sah man durch die dunstige, dampfende Luft nur schlecht, nach der Zerteilung des Gewitters besser. Neben und unter uns sahen wir in der Luft hängende Wolken, schreckhaft geborsten, von ungeheurer Geschwindigkeit. Bisher hatte uns immer die Sonne geschienen. Plötzlich umringte uns ein Nebel, der wie rasend ungestüm vom Fuß des Berges zum Gipfel heraufstieß und schräg an uns vorbeistrich. Einige Augenblicke lang brach ein Regen vermischt mit kaltem Hagel los. Wo zuvor jene Seite vom Nebel bedeckt gewesen war, auf der sich vom Berg aus eine Aussicht weithin nach Ungarn und nach dem türkischen Gebiet auftut, zeigte sich ein wunderbarer Anblick. Über uns war Nebel, der den Himmel verhüllte, unter uns strahlendste Helle. Denn die Sonne beleuchtete nun das unter uns liegende Land […]. Die Flüsse aber glänzten, obwohl sie gerade stürmisch waren, überaus hell.“ (Briefe I: 177f.)
Später wird der Astronom seine bei dieser Bergbesteigung gemachten Beobachtungen für eine Analogiebetrachtung zwischen irdischen und lunaren Landschaften verwerten.