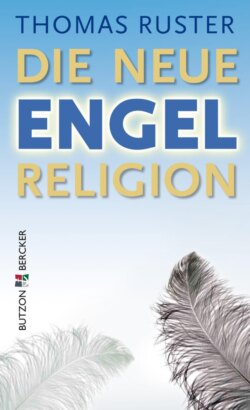Читать книгу Die neue Engelreligion - Thomas Ruster - Страница 12
6. Der Himmel ist wieder offen!
ОглавлениеTrotz dieser Zweideutigkeit der Engelreligion, die nur christlich-theologisch aufzulösen sein wird – dazu später mehr –, die gute Nachricht lautet: Es gibt in unserer Zeit wieder eine richtige Religion!77 Der Himmel ist wieder offen! Die himmlischen Mächte, die guten wie die bösen, werden wieder wahrgenommen, und es werden wieder die Beziehungen zwischen der Erde und dem Himmel geregelt, wie es eben in Religionen geschieht. Denn dies ist ja eigentlich die Aufgabe von Religion: dass sie die Verhältnisse zwischen dem Vertrauten und dem Unvertrauten, dem Empirischen und dem Numinosen, dem „Natürlichen“ und dem „Übernatürlichen“, letztlich zwischen der Erde und dem Himmel beobachtet und behandelbar macht. Religion gibt dem Unvertrauten einen Platz im Vertrauten. Sie benennt heilige Orte und Zeiten, sie liefert Bilder des Unsichtbaren, entwickelt Rituale für den Verkehr mit dem Göttlichen und schafft auf diese Weise Formen des Umgangs mit dem Bereich der Welt, der der direkten Beobachtung unzugänglich ist.78 Genau dies geschieht in der Engelreligion – bis hin zur Angabe von konkreten Methoden, von Orten und Zeiten zur Kontaktaufnahme mit den Engeln.
Die Engelreligion hat den Bann gebrochen, der mehr als 200 Jahre über der ,aufgeklärten‘ Welt lag. Gemäß der Aufklärung sollte sich die Erkenntnis auf das Empirische, Nachprüfbare und Berechenbare beschränken, und daraus ist unser Begriff von Wissen und auch von Wissenschaft entstanden. Der Himmel mit seinen Mächten war von diesem Begriff des Wissens ausgeschlossen und folglich auch aus der Wissenschaft. Der Himmel, der Bereich übermenschlicher Kräfte und Mächte, wurde dem mythologischen Weltbild zugeordnet, das aus der Kraft menschlicher Vernunft zu überwinden die Philosophie der Aufklärung angetreten war. Religion im beschriebenen Sinn wanderte in die Esoterik und den Okkultismus ab. Das Christentum, insoweit es in der Moderne noch geduldet werden wollte, sah sich gezwungen, sich von seinen ,mythologischen‘ Elementen zu reinigen. In der weltweit verbreiteten Engelreligion ist nun dieser Bann gebrochen. Das esoterische Wissen schickt sich an exoterisch zu werden, wie Jana Haas richtig bemerkt. Und von Seiten der Philosophie her mehren sich die Stimmen, die erklären, dass die Aufklärung ihr Ziel nicht erreicht hat, dass sie in ihrer eigenen „Dialektik“ verfangen geblieben ist. Die Moderne hat die mythologischen, naturgeschichtlichen Zwänge nicht durchbrechen können, die sie überwinden wollte, diese sind vielmehr in der Gestalt der alles beherrschenden Markt- und Warengesellschaft wiedergekommen.79 So ist auch von dieser Seite her wieder Raum für die Religion in der Moderne geschaffen worden. Das Christentum wird diese Wiederkehr der Religion mit Freude begrüßen können, denn ohne das Wissen um die himmlischen Mächte ist ein Weltbild unvollständig und blind.
Die Engelreligion tritt das Erbe der gesamten Religionsgeschichte an. In der Gothic-Szene ist uns die keltische und altgermanische Religion begegnet, man nimmt Bezug auf den Schamanismus, den alten russischen Geisterglauben, das asiatische Wissen um feinstoffliche Energien, die Lehre vom Karma und von der Wiedergeburt, den Voodoo-Kult, afrikanischen Ahnenkult, indianische Religion usw. usw. Die Liste ließe sich beliebig erweitern. Und das ist so in Ordnung. Egon Wenberg, ein Kenner der Wissenschaft von den Engeln, sagt mit Recht: „Die Engel sind älter als alle Religionen der Welt. […] Es gibt keine nur christlichen Engel. […] In jeder Religion gibt es Engel. Die Religionswissenschaften sprechen auch von Begleitgöttern, von Geistwesen, von dienenden göttlichen Wesen“80, oder einfach, so ist hinzuzufügen, von Göttern, denn die Götter des Polytheismus sind nichts anderes als himmlische Mächte, also das, was später unter dem Einfluss der Bibel angeloi bzw. Engel genannt worden ist. Der Reichtum der alten Religionen kehrt in der Engelreligion in unsere Zeit zurück, damit auch ihre Weisheit, ihre Himmels-„Wissenschaft“, das heißt ihre Kenntnis der himmlischen Mächte, deren Einfluss auf das irdische Leben in Rechnung zu stellen ist. Das ist ein Gewinn, eine Erweiterung unserer Erkenntnis! Zwar treffen die Vertreterinnen und Vertreter der Engelreligion ihre Auswahl aus dem reichen Stoff der Tradition je nach ihrer Erfahrung mit dem Himmlischen, aber darin bestätigt sich nur ein Moment, das für die Entwicklung der Religionen überhaupt typisch ist. Nicht zu allen Zeiten ist der Himmel gleich, nicht immer sind es dieselben Mächte, die vom Himmel her wirken, und darum ist es verständlich, dass eine neue Religion nur auf jene Elemente früherer Himmelskenntnis zurückgreift, die ihre gegenwärtige Himmelswahrnehmung bestätigen. Nicht von ungefähr kommen in der Gothic-Szene die germanischen Gottheiten wieder hervor, die unter dem Einfluss des Christentums in den Hintergrund getreten waren, stimmt doch die Erfahrung destruktiver Mächte, wie sie die Gesellschaft heute bietet, mit der germanischen, gewaltbestimmten Mythologie viel besser zusammen als mit der Religion der Liebe und Gnade. Und doch werden wir feststellen können, dass der Durchgang durch das Christentum die Engelreligion unserer Tage tiefgreifend geprägt hat. Nicht nur sind die Engels- und Teufelsvorstellungen81, die Engelsnamen, die Vorstellungen von einer Ordnung und Hierarchie der Engel von der christlichen Tradition her genommen, sondern auch die Tatsache, dass jedenfalls in der lichten Engelreligion so viel von Liebe gesprochen wird, ist ein Beleg für die religionsgeschichtliche Wirkung des Christentums. Der christliche Glaube hat gewirkt, er hat in der Engelreligion maßgebliche Spuren hinterlassen! Ist es doch keineswegs selbstverständlich, dass aus der himmlischen Welt Liebe und positive Energie auf die Erde strömen.
Nehmen wir einmal zum Vergleich die Religion des alten Griechenland, wie sie uns in der Theogonie des Hesiod entgegentritt.82 Dieses Werk des 8. Jahrhunderts v. Chr. soll hier exemplarisch für die ,alte Engelreligion‘ stehen. Es beschreibt die Entstehung der Götter und der Welt, und es zeichnet ein keineswegs freundliches Bild des Götterhimmels. Am Anfang sind da nur das dunkle Chaos, mit dem sich „die breitbrüstige Gaia“ (117) verbindet, sowie „Eros, der schönste unter den unsterblichen Göttern, der gliederlösende“ (120). Aus der Verbindung zwischen der Erde und dem dunklen Abgrund geht Uranos, der Himmel, hervor – die Unterscheidung von Erde und Himmel ist in der Tat die grundreligiöse Unterscheidung! Dass aber Eros keineswegs Liebe bedeutet, sondern nur die Macht der Begierde, zeigt sich in der weiteren Geschichte. Uranos überzieht Gaia mit einer Serie von Begattungen, die viel eher Vergewaltigungen sind, und das Schlimmste ist: Alle Kinder, die daraus hervorgehen, „waren dem Vater verhaßt“ (155). Sobald eines von ihnen geboren ist, stopft er es in die Erde zurück und lässt es nicht ans Licht. Gaia weiß sich keinen anderen Rat mehr, als Kronos (die Zeit), ihrem jüngstem Kind, eine „scharfzahnige Sichel“ (175) in die Hand zu geben, mit der dieser den Vater blutig entmannt (aus dem ins Meer geworfenen Genital des Uranos geht dann Aphrodite hervor, die Schaumgeborene. Aphrodite – eine genitale Männerphantasie? Richtig ist aber: Es ist die Zeit, das Alter, das den Vater aus seiner sexuell dominanten Rolle verdrängt.). Aber auch Kronos geht mit seinen Nachkommen nicht gerade freundlich um. Da er darauf sinnt, „daß nicht von den ehrwürdigen Himmelsabkömmlingen ein anderer unter den Unsterblichen die Königswürde innehätte“ (461 f.), hält „Kronos nicht unachtsam Wacht, sondern auf der Lauer liegend verschlang er seine Kinder“ (466 f.). Rheia, die Gemahlin des Kronos, ist untröstlich, und sie sucht bei Gaia und Uranos Rat, wie sie „rächen könne die Frevel an ihrem Vater und ihren Kindern, die der gewaltige, hinterlistige Kronos verschlungen hatte“ (473). Man sucht Kronos zu überlisten, und es gelingt auch: Als er seinen letztgeborenen Sohn Zeus verschlingen will, reicht man ihm stattdessen einen Stein. So kann Zeus überleben. Herangewachsen, befreit er sowohl die Kinder des Uranos – die Titanen – wie auch seine Geschwister, die Kinder des Kronos, aus ihrer Gefangenschaft. Zwischen beiden Göttergruppen entbrennt ein entsetzlicher, jahrelanger Krieg um die Herrschaft im Himmel. „Furchtbar hallte wider das endlose Meer. Die große Erde dröhnte. Es stöhnte der Himmel, erbebend, von Grund auf wurde der hohe Olymp erschüttert vom Ansturm der Unsterblichen“ (678 – 681). Schließlich gelingt es Zeus und den Seinen, die Titanen zu besiegen. Er verbannt sie in die Tiefen des Tartaros, die Unterwelt, ein vielfach gesichertes Gefängnis, aus dem sie bis auf weiteres nicht entfliehen können. Als bedrohlich-rumorende Gewalt bleiben sie aber weiterhin präsent. Zeus ist nun der unumschränkte Herrscher über die Sterblichen und die Unsterblichen, und der Dichter Hesiod kann nicht genug daran tun, sein Regiment zu preisen, denn Zeus regiert nach Recht und Gerechtigkeit. „Gut aber hat er jegliches den Unsterblichen festgesetzt und zugleich (ihnen) ihre Würden zugesprochen“ (74) – er schafft Ordnung im Himmel –, auf Erden aber begünstigt er den König, der „Urteile fällt mit gerechtem Spruch“ (85). So ist also eine einigermaßen zuträgliche Weltordnung begründet. Von Zeus hören wir weiterhin, wie er sich diversen „schönfüßigen“ oder „schönwangigen“ oder sonstwie liebreizenden Göttinnen und Menschentöchtern naht und mit ihnen eine Unzahl von Kindern zeugt. Es ist also die Kraft des Eros, die das Geschehen in Gang hält. Als aber Prometheus auftritt und mit List für die Menschen das Feuer vom Himmel holt, da reagiert Zeus empfindlich. Er bindet Prometheus „mit unauflöslichen Banden, mit schmerzenden Fesseln“ an einen Felsen und stachelt seinen Adler an, täglich seine „unsterbliche Leber“ zu fressen (521 – 524). Und über das gesamte Menschengeschlecht, das heißt bis dato nur über die Männer, wird vom Obergott eine besonders gemeine Strafe verhängt. Er erschafft das „unheilvolle Geschlecht der Frauen und ihre Arten“, die hinfort „als großes Unglück wohnen unter den sterblichen Männern“ (591 f.). Die Frauen sind nämlich wie die Drohnen, die die fleißigen Bienen für sich arbeiten lassen, dabei aber „drinnen bleiben in den schattigen Bienenstöcken und ernten für sich in ihren Bauch das von fremden Händen Erarbeitete“ (598 f. – bei den Bienen ist es wohl umgekehrt). Für besonders fatal hält es Hesiod, dass der Mann im Alter auf die Pflege durch die Ehefrau angewiesen ist. Deshalb „lebt er mit unaufhörlichem Schmerz in der Brust, im Sinn und Herzen, und unheilbar ist das Übel. So ist es nicht möglich, den Verstand des Zeus zu täuschen und zu umgehen“ (611 – 613).
Sehr frauenfreundlich ist das nicht, und nicht sehr menschenfreundlich. Schauen wir auf die Himmelswelt der Griechen: Sie besteht zuletzt nur aus einer Orgie der Begierde und der Gewalt. Nicht zu bestreiten ist, dass in Hesiods Theogonie eine wirkliche Wahrnehmung himmlischer Mächte vorliegt. Da ist die Rivalität der Väter auf die Söhne, in die diese ohne ihren Willen hineingeboren werden und die sie tödlich bedroht. Da ist der Zwang für die Söhne, ihre Eigenständigkeit nur im Widerstand gegen den Vater erringen zu können. Hesiod zeichnet ein fluchbeladenes Geschick, in dem List, Betrug und Gewalt, also schuldhaftes Verhalten, unvermeidlich sind. Ohne Schuld kann es kein menschliches Leben geben – eine Art griechische Version der Erbsündenlehre. Dann ist da die Herrschsucht, der Kampf um die Macht als eine Gewalt, der die Götter unterliegen und die von ihnen kommt. Und es ist Eros, der erste Gott, die Macht der Begierde und der Bedürfnisse, die Götter und Menschen in ihrem Bann hält. Sie kann aus männlicher Sicht leicht in abstruse Frauenfeindlichkeit umschlagen, wie es bei Hesiod geschieht. Und zuletzt steht über allem die menschenverschlingende Gewalt der Vergänglichkeit, sind doch alle Götter Kroniden, Nachkommen des Kronos. Umso stärker muss der Neid zwischen den Unsterblichen und den Sterblichen sein, wie er anlässlich des Falls Prometheus sich gewaltsam auswirkt. Hesiod ist aufmerksam für die Errungenschaften der Kultur, die die Macht des Schicksals begrenzen. Man gibt dem Kronos Steine zu fressen – mit steinernen Bauten ist ein schwaches Mittel gegen die Vergänglichkeit errichtet. Und doch bleibt das Leben der Menschen von Mächten und Gewalten bedroht. Vom Himmel her ein lüsterner, neidischer Gott, von der Unterwelt her die bedrohlichen Titanen. Wie mag es sich in einem solchen Weltbild gelebt haben? Von Liebe ist bei alledem keine Spur.
Der Durchgang durch das Christentum hat also die Engelreligion bereichert. Wenn Doreen Virtue Gott bzw. die Engel auch als „Liebe, reine Liebe“ bezeichnet, wenn Jana Haas ein goldenes Zeitalter der höheren Spiritualität heraufkommen sieht, das sich in der Abkehr von Gewalt und Unmenschlichkeit ankündigt, wenn Helga Schaub echten Glauben, Gebet und liebevolle Gedanken gegen die dunklen Mächte aufbietet, dann hat der christliche Glaube offenbar Wirkung gezeigt. Das ist dankbar anzuerkennen. Manche meinen, der christliche Glaube in seiner speziellen Form habe sich damit erübrigt, er sei aufgegangen in einer universalen Religion der Liebe und habe damit sein Bestes gegeben, aber wir werden sehen, dass dem nicht so ist. Doch zunächst ist darauf aufmerksam zu machen, dass die Engelreligion auch umgekehrt das heutige Christentum bereichert. Sie gibt Christen, die sich darauf einlassen – und das sind nicht wenige – die verlorene Religion zurück. Man denke einmal an die katholische Kirche im Zeitalter des Barock. Über zwei Jahrhunderte – von der Mitte des 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts – war die barocke Kultur in den katholischen Ländern Süd- und Osteuropas, in der Alpenreligion, in Südamerika und in etwas anderer Weise auch in Frankreich höchst lebendig. Das Barockzeitalter war vielleicht die letzte Epoche einer integralen, den biblischen Glauben mit der Religion verbindenden Katholizität. Betritt man eine Barockkirche, sieht man sofort, welch eine überragende Rolle die Engel hier spielen. Geradezu in Überfülle sind sie dort vertreten – nicht nur in den Kirchen, sondern auch in der Literatur der Zeit. Zuhauf treten sie in den beliebten Jesuitendramen auf, die davon erzählen, wie Menschen von Teufeln verführt und von Engeln beschützt werden. Bei den Aufführungen wurde auch mit szenischen Tricks nicht gespart: Die Teufel treten aus einer Versenkung auf der Bühne, die Engel schweben mittels einer komplizierten Maschinerie vom Himmel herab und zum Himmel zurück. Beliebt war das Motiv des versöhnten Teufels, eines armen Wesens, das sich im Grunde nach Liebe und Erlösung sehnt – so in Friedrich Gottlieb Klopstocks „Messias“.83 Helga Schaub könnte ihre Freude daran haben. Barocke katholische Religiosität war Christentum inklusive Engelreligion. Und dadurch war es eine Religiosität, die einen ungezwungenen Zugang zur Welt der Geister, Naturwesen und der Magie hatte. Der Historiker und Barockforscher Peter Hersche spricht von der „kirchlichen Halbmagie“ jener Zeit.84 „Magie gehörte damals zur selbstverständlichen Lebenswirklichkeit“, in vielfacher Weise war sie auch im kirchlichen Leben verankert. Schon die kirchlichen Segnungen und Weihen profaner Gegenstände sowie die Reliquienverehrung reichten in den Bereich der Magie hinein. Daneben gab es den Wettersegen, verbunden mit „Schauermessen“, Hagelprozessionen und dem Wetterläuten bei aufziehendem Gewitter, dem man eine abwehrende Kraft gegen die Blitze zuschrieb. Segnungen gegen Ungeziefer wurden gegen Mäuseplage und Engerlinge eingesetzt. Allerhand heilkräftige Gegenstände, Kreuze, Andachtsbilder, geweihte Wässer und Amulette waren im Umlauf, besonders beliebt waren die so genannten Kompositamulette, die aus tausenden unterschiedlicher Ingredienzien zusammengesetzt sein konnten: gesegneten Wässern und Kräutern, Reliquienteilen, Wachsen und Ölen, geschriebenen Segen hoher kirchlicher Funktionäre bis hin zu den Päpsten. „Das alles wurde [in Klöstern] zusammengemengt, pulverisiert, in Rollen verpackt anderen Konventen zugesandt, von diesen portionsweise weiterverteilt und, versehen mit einer geistlichen Gebrauchsanweisung, als Mittel gegen sämtliche denkbaren Leiden benutzt.“ Auch Liebeszauber waren beliebt. Wunder kamen häufig vor. Große Bedeutung hatte der Exorzismus, der auch gegen Tierseuchen eingesetzt wurde. Als ein besonders krasses Beispiel der kirchlichen Halbmagie nennt Hersche den Brauch des so genannten Kinderzeichnens. Totgeborene Kinder wurden, damit sie nicht der ewigen Verdammnis anheimfielen, durch Wärmeeinwirkung scheinbar wiederbelebt und dann getauft. Letzteres hatte nicht die offizielle Billigung der Kirche, wurde aber geduldet, schon wegen der Verzweiflung der Eltern. Insgesamt versuchte die katholische Kirche „eine Integration bzw. Umwandlung magischer Vorstellungen in religiöse.“ Die Magie wurde verkirchlicht, dadurch zugleich anerkannt, begrenzt und integriert. Die Protestanten ihrerseits hatten Gelegenheit, sich über den katholischen ,Aberglauben‘ aufzuregen und ihre Abgrenzung gegen das Katholische zu betonen. Die barocke Religiosität ist dann unter dem Einfluss der Aufklärung, des Josephinismus in Österreich, der Revolution in Frankreich, der Säkularisierung in Deutschland vom Ende des 18. Jahrhunderts an rigide zurückgedrängt worden. Sie überlebte nur in Restbeständen der Volksreligion, am längsten in den katholischen Mittelmeerländern. Der im barocken Katholizismus enthaltene Anteil von Religion, das heißt vom Umgang mit übersinnlichen und himmlischen Mächten, ist im Gefolge des 2. Vatikanischen Konzils praktisch ganz aus der katholischen Kirche ausgemerzt worden.85 Und dann kommt die Engelreligion und lässt all das, zumindest sehr viel davon, wieder aufleben! Viele katholische Christen nehmen das dankbar an. So zum Beispiel die Italienerin Paola Giovetti, die ein hinreißendes Buch über die „unsichtbaren Helfer der Menschen“ geschrieben hat.86 Sie ist katholisch und findet die Existenz der Engel und anderer übersinnlicher Wesen einfach überall belegt. Andachtsvoll zitiert sie Worte des Papstes Johannes Paul II. über die Engel, berichtet von Engelwundern bei Heiligen und an Wallfahrtsorten, bezieht aber auch die Naturgeister Rudolf Steiners, die Lichtwesen Raymond Moodys und die Engellehre Emanuel Swedenborgs problemlos mit ein. Sie erzählt sensationelle Geschichten der wunderbaren Rettung durch Engel, die auch bei Giulia Siegel oder Doreen Virtue stehen könnten. Sie überlässt es den Lesern, sich das alles zusammenzureimen. In das gleiche Spektrum gehören die viel gelesenen Bücher Uwe Wolffs.87 Der katholische Theologe führt kenntnisreich und gekonnt durch die bunte und bisweilen düstere Welt der Engel und Dämonen. Von Geburt an, ja schon vorgeburtlich beeinflussen machtvolle Gestalten den Menschen im Guten wie im Bösen. So wusste es das frühere Christentum, so wissen es aber auch allerhand angeführte Zeugnisse aus den Religionen, der Literatur und der Parapsychologie. Ausführlich erzählt Wolff von Teufelspakten und Teufelsaustreibungen. Auch ihm ist ein Stück seiner Religion wiedergegeben worden, das er genüsslich schaudernd durchstreift. Seinen theologischen Lehrern in Münster konnte er nichts davon sagen, es hätte sonst passieren können, dass ihm der Professor für Neues Testament die Seminararbeit über die Dämonenaustreibung in der Synagoge von Kafarnaum aberkennt.88
So besteht also kein grundsätzlicher Widerspruch zwischen der Engelreligion und dem Christentum, jedenfalls in seiner katholischen Gestalt. Nachdrücklich muss aber auch das andere gesagt werden: Es führt kein direkter Weg von der Engelreligion zum Gott des christlichen Glaubens! Von diesem Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Gott des Mose und dem Gott Jesu Christi ist in der ganzen einschlägigen Engelliteratur nicht die Rede. Zwar fällt verschiedentlich das Wort Gott oder es wird vom Göttlichen gesprochen, aber damit ist nicht der Gott des christlichen Glaubens gemeint. Der Pan-Angelismus dieser Religion ist vielmehr ein Pantheismus; ,Gott‘ gilt als Chiffre für das Universum, für die Welt der Engel allgemein, für spirituelle Energie. Die Engelreligion bezieht sich nur auf die Erfahrung himmlischer Mächte, Gott aber ist der Schöpfer des Himmels. Wie sollten sie auch auf Gott stoßen, wo Gott doch in der Welt nicht vorkommt? So ist denn auch kein Glaube gefordert, sondern nur eine besondere Wahrnehmungsfähigkeit für spirituelle Energien. Der Begriff Engel – von angeloi, Boten –, der aus der Bibel übernommen ist, wird demgemäß eigentlich ungenau oder sogar missbräuchlich verwendet, denn Boten Gottes oder Vermittler zu Gott können die Engel in dieser Religion nicht sein. Sie gelten selbst als göttlich. Sie verweisen offensichtlich nicht auf ihren Schöpfer. Somit ist übrigens der Beweis erbracht, dass die in der Religionspädagogik vielfach wiederholte These, die Weckung natürlicher Religiosität bereite von selbst auf den christlichen Glauben vor, nicht stimmt. Hier haben wir es mit einer voll ausgebildeten Religion zu tun, aber Gott kommt darin nicht vor.
Die Engelreligion ist eine Religion ohne Gott. Sie ist die Fortsetzung des vor- und außerchristlichen Polytheismus unter den Bedingungen der Moderne, nur dass die Götter jetzt Engel heißen. Sie weiß nichts von der Offenbarung des wahren Gottes. Deshalb ist sie auf immer neue Offenbarungen der Engel-Medien und spirituellen Seherinnen angewiesen. Wie viele dieser Engelbücher behaupten doch nicht von sich, sie seien „im Auftrag der geistigen Welt“ entstanden89, oder man hat gleich einen heißen Draht zur himmlischen Führung wie Doreen Virtue. Diese Offenbarungen wuchern aus, sie verlieren sich ins Unentscheidbare und Unübersehbare.90 Und doch ist eine Religion ohne Gott immer noch die einfachere Religion. Sie braucht sich ja nur an ihre Wahrnehmungen zu halten und kann das unergründliche Geheimnis Gottes aussparen. In der Engelreligion äußert sich ein zeitgemäßes Bedürfnis nach religiöser Komplexitätsreduktion. Es wird Ordnung in der Religion geschaffen. Immer wieder trifft man auf Versuche, den religiösen Kosmos zu vereinheitlichen, Engelordnungen und -hierarchien aufzustellen, die zwar zueinander nicht widerspruchsfrei sind, aber doch jeweils für sich ein stimmiges Bild ergeben. Sieben Erzengel für sieben Tage, verbunden mit sieben Energiechakren, das passt. Und wenn die Bibel nur mit drei Erzengeln dienen kann, dann müssen eben vier weitere gefunden werden. Entsprechende Hellsichtigkeit kommt hier wie bei Jana Haas gerade recht.
Christen können sich damit nicht zufriedengeben. Nicht, weil das Christentum unter allen Umständen Recht behalten muss. Sondern weil der Engelreligion eine wilde und maßlose, eine verwilderte Angelologie zugrunde liegt.91 Und diese kann leicht gefährlich werden. Wie gezeigt, fügt sie sich allzu sehr unseren Bedürfnissen und damit der Maßlosigkeit unserer Ökonomie, der sie nichts entgegenzusetzen hat, die sie vielmehr ins Religiöse hinein verlängert. Und wo die dunkle Seite des Himmels gesehen wird, da bleibt Erlösung aus. Die lichte Seite dieser Religion wird mit der Macht des Bösen nicht fertig, sie ist ja nur ihre andere Seite. An die Stelle von im Glauben begründeter Erlösungshoffnung treten Todessehnsucht, Gewaltfantasien und Satanismus, nicht selten und nicht zufällig verbunden mit fanatischem Antichristentum. Die Wiederkehr der germanischen Kampfgottheiten in der Gothic-Szene zeigt einen schlimmen Zustand der Religion an. Heinrich Heine hat es vorausgesehen: „Das Christentum – und das ist sein schönstes Verdienst – hat jene brutale germanische Kampflust einigermaßen besänftigt, konnte sie jedoch nicht zerstören, und wenn einst der zähmende Talisman, das Kreuz, zerbricht, dann rasselt wieder empor die Wildheit der alten Kämpfer, die unsinnige Berserkerwut, wovon die nordischen Dichter soviel singen und sagen. Jener Talisman ist morsch, und kommen wird der Tag, wo er kläglich zusammenbricht. Die alten steinernen Götter erheben sich dann aus dem verschollenen Schutt und reiben sich den tausendjährigen Staub aus den Augen, und Thor mit dem Riesenhammer springt endlich empor und zerschlägt die gotischen Dome.“92