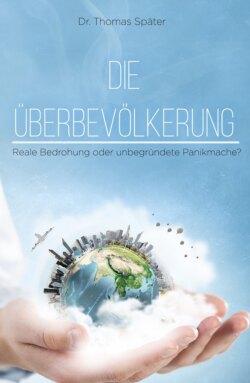Читать книгу Die Überbevölkerung - Thomas Später - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWir haben Probleme - und davon ziemlich viele! Zumindest wird uns das täglich so suggeriert. ob nun von Medien oder im Gespräch mit Familie, Freunden oder Arbeitskollegen; es entsteht das Gefühl, wir wären von permanenter Panikmache und Aussichtslosigkeit umgeben. Und das, ohne im Detail überhaupt zu wissen, um was es eigentlich geht. Überbevölkerung, Altersarmut, Verdrängung der Religion im eigenen Land, Immigrationskrise, Ressourcenverschwendung. Es ist nahezu unmöglich, sich eine ausreichend fundierte Wissensgrundlage aktueller Themen so anzueignen, dass man auf Augenhöhe mit Experten darüber diskutieren könnte. Sind doch die Wenigsten von uns Demografen, Immigrationspolitiker oder Naturwissenschaftler.
Bezüglich einer möglichen Informationsbeschaffung stellen sich also einige grundlegend wichtige Fragen: Woher kann ein „normaler“ Bürger mit durchschnittlichem Bildungsniveau, unter der Annahme, dass er sich diese Arbeit überhaupt machen wolle, seine Informationen beziehen? Werden Inhalte und etwaige Quellenangaben kritisch hinterfragt und auf ihre Richtigkeit und Kompetenz der Autoren/Autorinnen geprüft? Und schlussendlich: Werden Texte und Aussagen richtig interpretiert oder diese dann unter Umständen doch nur in Form gefährlichen Halbwissens weiterverbreitet? Immerhin leben wir in einer Zeit, in der die Beschaffung von Informationen und Antworten so leicht scheint wie das Stellen einer Frage selbst.
Seit Beginn der kommerziellen Nutzung des Internets im Jahre 1990 sind wir alle mittlerweile nur noch einen „Klick“ von dem entfernt, was wir zu jedem gegebenen Moment unseres Lebens wissen wollen. Es ist für mich fast schon unvorstellbar, dass Menschen zum Zeitpunkt meiner Geburt im Jahre 1984 in eine Bibliothek oder einen Fachhandel laufen mussten, um sich ein Buch auszuleihen oder zu kaufen, während Google mir in genau diesem Moment innerhalb von 0,49 Sekunden 5.760.000.000 Ergebnisse zu der Frage ausspuckt, wie viele Menschen denn heute, knapp 36 Jahre später, überhaupt noch ein Buch lesen („how many people still read a book?“).
Und wir sind nicht nur gut darin geworden, Fragen in enorm ausgefallener, kreativer und spezifischer Form zu stellen, sondern auch darin, entsprechende Ergebnisse und Sachverhalte einfach so hinzunehmen wie sie sind. „Wenn das da so steht, wird es schon stimmen“ oder „Wenn die Nachrichtenredakteurin im Abendprogramm des öffentlichen Rundfunks das so sagt, kann es ja wohl schlecht gelogen sein“ sind da nur zwei Beispiele, die mir im persönlichen Alltag genauso oder in leichter Abwandlung bereits mehrfach begegnet sind. Kaum einer sieht noch eine Notwendigkeit darin, sich im Detail über Dinge informieren zu müssen, geschweige denn zu wollen. Zu einfach ist es, sich jedem beliebigen Gespräch eben mal kurz mit dem Wissen anzuschließen, das man beiläufig irgendwo mal aufgeschnappt hat. Und selbst diejenigen, die sich unter Umständen gerne über gewisse Themen ernsthaft informieren möchten, wissen oft gar nicht so recht über welchen Weg sie dies tun sollen. Wem kann man denn hinsichtlich einer Berichterstattung in Zeiten von „Fake-News“ noch vertrauen?
In Anbetracht der Tatsache, dass es zu bestimmten, vor allem aktuellen Thematiken oft (noch) keine entsprechenden Fachbücher gibt, erweist sich die Wahl einer zweiten und alternativen Informationsquelle für die meisten vielmals als sehr schwierig. So erfolgt der Nachrichtenkonsum in der Regel über den Weg der Massenmedien, also Presse, Rundfunk, Fernsehen und Internet. Mit anderen Worten: Zu jeder Zeit und überall. Da ist es nicht verwunderlich, dass kaum jemand von uns noch die Fähigkeit zu besitzen scheint, Wesentliches von Unwichtigem zu unterscheiden. Sehen wir uns als Paradebeispiel der Massenmedien kurz Facebook als Vertreter sozialer Netzwerke an. Die 2004 gegründete Online-Plattform ist mit weltweit knapp 2,5 Milliarden aktiven Nutzern die beliebteste Plattform seiner Art.
Zum Thema der Informationsbeschaffung konnte das Pew Research Center (Washington, D.C., USA) im Jahr 2013 mittels einer Umfrage zeigen, dass 16 % aller Befragten Facebook-Nutzer die Internetplattform nicht etwa ausschließlich dazu nutzen, um mit Mitmenschen in Kontakt zu bleiben oder sich Fotos und Videos anzusehen, sondern auch, um newstechnisch auf dem neuesten Stand zu bleiben. Natürlich bedeutet dies nicht, dass die hier genannten 16 % der Befragten ihre Informationen ausschließlich über soziale Netzwerke beziehen. So kann es daher eben auch sein, dass ein Teil dieses Kollektivs auf soziale Medien nur ab und an zur Beschaffung von Informationen zurückgreift. Ob dies nun aber ab und zu oder regelmäßig passiert, spielt dabei eine eher untergeordnete Rolle, denn auch eine sporadische Nutzung unkontrollierter Informationsquellen kann bereits zu einer verzerrten Meinungsbildung führen. Dazu später mehr. Auch wenn 16 % im ersten Moment nicht sehr hoch scheinen, so sollte man sich dennoch einmal genauer anschauen, was sich hinter dieser Zahl verbirgt. Gingen wir davon aus, dass sich diese Statistik auf alle aktiven Facebook-Nutzer 1: 1 übertragen ließe, würde dies bedeuten, dass weltweit knapp 384 Millionen Menschen eine Plattform als Informationsquelle nutzen, auf der nun wirklich jeder problemlos und mehr oder weniger unkontrolliert Inhalte erstellen und verbreiten kann. Zumindest bis aufgrund illegaler Inhalte eventuell eine Zensur vom Netzwerkbetreiber erfolgt.
Auch die Nutzung intelligenter Lautsprecher trägt seit einigen wenigen Jahren zum Problem der unkontrollierten Nachrichtenbeschaffung bei. Hierbei werden sprachgesteuerte Gadgets, wie beispielsweise das Amazon-Produkt Alexa, verwendet, um auf Informationen zurückzugreifen. Hierbei handelt es sich allerdings nicht immer um interne Informationen von Amazog, sondern auch um solche von Drittanbietern. Auch hier gehe ich davon aus, dass jene Menschen, die aus Bequemlichkeitsgründen Informationen von einem sprachgesteuerten Lautsprecher beziehen, wenig Eigeninitiative erbringen werden, diese zu kontrollieren. Verglichen mit dem notwendigen Aufwand, den man zum Lesen von Texten betreiben muss, wird uns die Beschaffung von Informationen auf diese Weise zwar erneut erleichtert, verbleibt vermehrt aber auch wieder verschleiert und unkontrolliert. Wenn es um die Generierung von Wissen geht, sollte man von fragwürdigen Beiträgen nicht bekannter Internetseiten also dringend Abstand nehmen. Manche von uns tun das, andere wiederum nicht. Das Problem liegt darin, dass jeder Einzelne für sich entscheiden muss, welche Quelle er als vertrauenswürdig einstuft und welche nicht. Und auch wenn sich neben unzähligen - oft auch unbekannten - Internet-Newsdiensten auch die uns bekannten Printmedien die sozialen Netzwerke zum Erreichen ihrer Leser und Leserinnen zu Nutze machen, um ihre Leser zu erreichen, so ist auch hier für manche meist nicht ganz ersichtlich, welche davon zu den seriösen Anbietern gehören und welche eher als „Tratschblatt“ einzustufen sind. Wobei es die Möglichkeit, zumindest grob einen Eindruck über die Glaubwürdigkeit von Medien zu bekommen, natürlich durchaus besteht. Es ist nur eben mit einem gewissen Aufwand verbunden.
In einem 2011 veröffentlichten Artikel hat der Hamburger Medienökonom Christian W. Wellbrock beispielsweise die journalistische Qualität von Zeitungen und Nachrichten-Websites in Deutschland untersucht. In seinen Ergebnissen konnte er in einer Qualitätsrangfolge, basierend auf der Befragung von 56 Medienexperten, eine klare Wertung darüber abgeben, welches die seriösesten Nachrichtendienste unseres Landes sind. Ein klein wenig Begeisterung für Recherche in Kombination mit etwas Fingerspitzengefühl für Sinnhaftigkeit erleichtert uns die Suche nach brauchbaren Informationen also schon etwas. Wenn wir das wollen.
Falls es zu aktuellen Geschehnissen allerdings gerade keine Informationen zu geben scheint, ist es meist ebenso sinnvoll einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Viele der Themen, die uns Tag und Nacht beschäftigen, hat man sich nämlich schon oft im Detail angesehen, ausgearbeitet und relevante Ergebnisse dazu veröffentlicht. Und auch wenn ein gewisser zeitlicher Versatz zwischen diesen Veröffentlichungen und dem heutigen Tag liegen mag, so können Ergebnisse, Prognosen und Schlussfolgerungen oft zumindest teilweise auf die Gegenwart übertragen werden. Allerdings sprechen wir nun von einer Informationsquelle, die den wenigsten bekannt und noch dazu nicht unbegrenzt für jeden zugänglich ist. Die Rede ist von wissenschaftlichen Publikationen.
Solche Veröffentlichungen gelten als zuverlässige Quelle des modernen Denkens und sind, was Inhalt und Wertigkeit angeht, meist unumstritten. Die Vertrauenswürdigkeit solcher Publikationen ist der Tatsache geschuldet, dass sie sich vor ihrer Veröffentlichung einem strengen Gutachten unterziehen müssen, welches ausschließlich von mehreren akademischen Experten des jeweiligen Fachgebietes durchgeführt wird. Diese kontrollieren das eingereichte Dokument auf mögliche Fehler und geben am Ende eine Wertung ab. Je nachdem wie dieses Gutachten ausfällt, wird die eingereichte Arbeit entweder akzeptiert, abgelehnt oder muss überarbeitet werden. Es ist an dieser Stelle allerdings zu erwähnen, dass das hier angewandte Verfahren natürlich nicht immer gewährleistet, dass der Inhalt insbesondere älterer Publikationen zweifelsfrei und zu 100 % wahr sein muss. Es bedeutet lediglich, dass alle in ihr gemachten Angaben und Beweise nach einer gründlichen Begutachtung von Fachpersonal und unter Berücksichtigung des aktuellen wissenschaftlichen Standes zum Zeitpunkt der Prüfung als glaubwürdig eingestuft wurden.
Fairerweise muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass die Veröffentlichung solcher Publikationen in sogenannten Journals erfolgt, welche in ihrer Qualität stark variieren. So kann es beispielsweise sein, dass sich Publikationen, welche in einem eher qualitativ niedrig eingestuften Journal veröffentlicht wurden, sich einem weniger strengen Gutachten unterziehen mussten und somit einen erhöhten Anteil falscher Informationen beinhalten können als solche Publikationen, die in einem renommierten und hochrangigen Journal (beispielsweise NATURE) erschienen sind. Erfahrungsgemäß haben qualitativ niedrig publizierte Arbeiten aber einen verschwindend geringen Einfluss auf die wissenschaftliche Community und fallen daher kaum ins Gewicht.
Im vorliegenden Buch möchte ich mir genau diese Art der Fachliteratur als primäre Wissensquelle zu Nutze machen, um eine Thematik aufzuarbeiten, die mir persönlich sehr am Herzen liegt: Die Überbevölkerung. Genauer gesagt möchte ich klären, was man unter einer Überbevölkerung eigentlich versteht, ob diese tatsächlich existiert, was die Gründe dafür sein könnten und welche Möglichkeiten es gibt, eine solche zu verhindern. Fragen, die sich viele von uns schon gar nicht mehr stellen, denn täglich erleben wir es doch selbst: Maßlos überfüllte Einkaufshäuser, nicht endende Staus auf Autobahnen oder den leidigen Kampf um eine Mietwohnung aufgrund zu hoher Nachfrage. Reicht uns das als Antwort nicht schon?
Zudem sind Beweislage und Berichterstattung insbesondere in den zuvor beschriebenen Massenmedien während der letzten Jahrzehnte zu eindeutig geworden. So unverkennbar und erdrückend, dass es natürlich nicht mehr spurlos an uns vorbei geht. Eine graue Großstadt, in der die hohe Luftverschmutzung das Erblicken der Sonne noch nicht einmal mehr an wolkenlosen Tagen ermöglicht. Oder etwa die sommerliche Aufnahme eines überfüllten Strandes, an dem man den fein glitzernden Sand bestenfalls noch zwischen den ausgebreiteten Handtüchern erahnen kann. Bilder wie diese haben sich regelrecht in unsere Köpfe eingebrannt. Dass die rasant wachsende Weltbevölkerung geradezu ein Problem darstellen muss, lässt sich für viele von uns also nun (scheinbar) wirklich nicht mehr von der Hand weisen. Eines wissen wir daher mit Sicherheit: Unser Planet ist überbevölkert. Oder etwa doch nicht? In Wahrheit, und das war bereits vor meiner Recherche im Rahme dieses Buches ersichtlich, ist die Sachlage um einiges komplexer als es die meisten von uns glauben. Man versucht die Frage nach der möglichen Existenz einer Überbevölkerung schon lange nicht mehr nur mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten. Vielmehr geht es daher eher darum herauszufinden, unter welchen Umständen und wo genau eine solche vorliegt. Diese und weitere Punkte sollen im vorliegenden Buch unter Berücksichtigung entsprechend gekennzeichneter Fachliteratur betrachtet und analysiert werden. Dabei handelt es sich um keine hoch akademische Ausarbeitung des Themas, sondern vielmehr um eine kurze und für Laien nachvollziehbare Zusammenfassung historischer Eckdaten und wichtiger themenbezogener Aspekte, an deren Ende der Hauptschwerpunkt auf einer ernüchternden Schlussfolgerung liegen wird:
Ohne staatliche Regulierungen und Einschränkungen unserer Regierungen werden wir es nicht schaffen, die Erde, so wie wir sie kennen, zu retten.
Da es noch immer wenig eindeutige Definitionen rund um die Thematik der Überbevölkerung zu geben scheint, werde ich nach einem kurzen geschichtlichen Rückblick zunächst auf einige der wichtigsten Populationstheorien eingehen. Diese zu verstehen ist grundlegend wichtig, wenn man sich ein ausreichend differenziertes Bild über die momentane Situation und angestrebte Lösungsansätze machen möchte. Weiterhin werde ich darauf eingehen, wie eng verbunden Überbevölkerung und globale Erwärmung miteinander sind und auch darauf, welche Rolle erneuerbare Energien in unserer Gesellschaft spielen. Hierbei soll ebenso angeführt werden, weshalb solche „grünen Alternativen“ nicht ganz so vielversprechend sind wie viele von uns denken. Der Hauptfokus aller Kapitel wird dabei stets auf uns liegen, der Bevölkerung. Beziehungsweise auf uns Menschen als Individuen. Dabei werde ich detailliert darauf eingehen, warum ein Einschreiten seitens unserer Regierung in Bezug auf populationsabhängige Probleme unverzichtbar ist und in welch vielfältiger Form wir Menschen mit unserem Unwissen und unserer Ignoranz dazu beitragen, unseren Planeten zu zerstören. Beginnend möchte ich nun aber zunächst auf das Wort „Überbevölkerung“ eingehen. Es suggeriert nämlich lediglich, dass wir ein Platzproblem auf unserer Erde haben. Zu viele Menschen auf nicht ausreichendem Raum. Dass diese Interpretation völlig falsch und das Wort „Überbevölkerung“ daher irreführend ist, möchte ich mit Hilfe eines kurzen Beispiels aufzeigen.
Zurzeit leben knapp 7,7 Milliarden Menschen auf der Erde. Grönland, als willkürliches Beispiel gewählt, hat eine Fläche von ca. 2,1 Millionen Quadratkilometern. Würde man also alle auf unserem Planeten lebenden Menschen nach Grönland umsiedeln, so hätte bei gleicher Aufteilung der verfügbaren Landfläche dort jeder einen Wohnraum von knapp 278 Quadratmetern! Und das, während der Rest unserer Erde komplett menschenleer wäre (Abbildung 1).
Abbildung 1: Verdeutlichung des Verhältnisses zwischen freier und belegter Landfläche unseres Planeten. Würden alle zurzeit lebenden Menschen unserer Erde (7,7 Milliarden) in Grönland wohnen, hätte jeder dort eine verfügbare Wohnfläche von knapp 278 Quadratmetern. Der Rest unserer Erde wäre zeitgleich komplett menschenleer.
Mangelnder Platz (bzw. zu viele Menschen) kann mit dem Begriff „Überbevölkerung“ also offensichtlich nicht gemeint sein. Zumindest nicht, wenn man es verallgemeinernd und ohne Berücksichtigung anderer Faktoren betrachten möchte. So herrscht in Ballungszentren städtischer Gebiete natürlich schon ein gewisser Platzmangel, den es in ländlichen Regionen so nicht gibt.
Aber was bedeutet „Überbevölkerung“ denn nun genau? Eine Frage, die sich unmöglich „mal eben so“ beantworten lässt. Denn entgegen der weitverbreiteten Meinung, es würde sich hierbei um eine Fragestellung der Gegenwart handeln, haben sich Menschen diesbezüglich vor langer Zeit bereits Gedanken gemacht. Wir sprechen hier also nicht etwa über ein Phänomen, das plötzlich aufgetreten ist, sondern über einen Sachverhalt, der bereits seit Jahrtausenden diskutiert wird. Ansichten und Definitionen, die sich immer wieder änderten und dies auch heute noch tun. Und auch wenn es sich als schwierig erweist, den Werdegang solcher Gedankengänge zweifelsfrei bis zu ihrem Ursprung zurückzuverfolgen, so hilft uns ein kurzer Blick in deren geschichtliche Anfänge dennoch dabei, zu verstehen wie komplex die im vorliegenden Buch beschriebene Angelegenheit der Überbevölkerung tatsächlich ist.