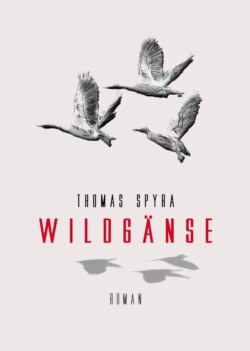Читать книгу Wildgänse - Thomas Spyra - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Aufbruch 1736
ОглавлениеBlutend an den Händen und aus der Nase, mit brummendem Schädel lag Andreas Christoph Bartel im Gebüsch. Mucksmäuschenstill lag er da und wartete ängstlich darauf, wie es weiter gehen würde, hatte er doch gemeint, sein letztes Stündlein sei angebrochen. Immer noch wütete die Bande und er rührte sich nicht, aus Angst die Straßenräuber würden ihn doch noch entdecken.
Langsam kreisten seine Gedanken um die Ereignisse der letzten Tage.
Alles war schief gegangen, seit der Schneidermeister mit seiner Frau in Windsheim, einer kleinen fränkischen Stadt, eine gute Tagesreise westlich von Nürnberg gelegen, aufgebrochen war.
Aus dem einst großen, kräftigen und immer lustigen Burschen, den Anna Maria geheiratet hatte, war im Laufe der Jahre ein etwas beleibter, schon leicht grauhaariger Mann geworden. Aschfahl war seine Haut vom tagelangen Sitzen in der dunklen Werkstatt. Nur sonntags bei schönem Wetter kam er an die frische Luft und in die Sonne, wenn er mit seinen wenigen Freunden auf dem Kornmarkt am Brunnen beim Frühschoppen saß.
Er gehörte zu jenen Menschen, die ein ausgesprochenes Selbstbewusstsein an den Tag legten und die meinten, sie müssten die ganze Welt verbessern. Immer und überall setzte er sich für die kleinen Leute ein und stellte sich damit nicht nur einmal gegen die Obrigkeit. Dabei stand er sich oft selbst im Weg, stieß wegen mangelnder Bildung an seine Grenzen.
„Ein Schneidermeister sollte sich um seine Sachen kümmern und das Reden und Philosophieren den Studierten überlassen.“ Nicht nur einmal bekam er dies gesagt. Aber er schlug alle wohlgemeinten Ratschläge in den Wind.
Zweimal wurde ihm in Windsheim eine besondere Ehre zuteil. Man berief ihn zum Siebener; dies sind Feldgeschworene, die für die Ordnung der Grenzsteine zuständig sind. Etwas später wählte man ihn zum Ratsherrn in den Äußeren Rat.
Leider verhinderte sein Unvermögen, sich gewissen gesellschaftlichen Regeln zu unterwerfen, eine Wiederwahl.
Die größte Stütze in dieser nicht immer leichten Zeit war seine von ihm über alles geliebte Frau Anna Maria. Sie war über zwölf Jahre älter als er, aber das sah man ihr nicht an. Mit ihren fast 53 Jahren war sie immer noch ein Energiebündel und eine schöne Frau. Sie strahlte zwar die Reife einer älteren Frau aus, hatte sich jedoch die Geschmeidigkeit der Jugend erhalten. Freilich war die Zeit an ihr auch nicht spurlos vorübergegangen. Aber die Lachfalten unter den hellgrün leuchtenden Augen und das rotblonde, schon leicht grau werdende Haar, das unter der Haube hervorspitzte, hatten sie nur noch hübscher werden lassen. Manch einer fragte sich, was sie an dem jüngeren und blassen Schneidermeister fand.
„Sei du selbst! Lass dich nicht beugen und unterkriegen. Jeder Mensch ist ein Individuum!“ Mit diesen Thesen der Aufklärung ermunterte ihn seine Frau immer wieder, so weiter zu machen, wie er begonnen hatte.
Er grübelte viel über sich und die Welt nach. Viel Zeit für den Aufbau einer eigenen Werkstatt, für das Erlangen von Ansehen und Reichtum lag hinter ihm. Er hatte es mithilfe seiner Frau zu etwas gebracht. Aber dann vor knapp einem Jahr wurde er aus der Zunft ausgeschlossen und nun durfte er keine eigene Werkstatt mehr betreiben. Er war mit seinen aufrührerischen Reden bei den Stadtoberen unerwünscht. Wer Gleichheit und Brüderlichkeit für alle Menschen forderte, war ein Querulant und so einen wollte man nicht innerhalb der Stadtmauern haben.
So hatte er seinen beruflichen und gesellschaftlichen Auf- und Abstieg in der Freien Reichsstadt Windsheim erlebt. Zu guter Letzt blieben ihm nur noch Flickschneiderei und Gelegenheitsarbeiten, sodass er für sich und seine Frau keine Zukunft mehr in der Stadt gesehen hatte.
Am ersten Montag im März 1736 hatten sie sich gemeinsam in aller Herrgottsfrühe auf den Weg gemacht. Frierend saß er auf dem Kutschbock, zog die Decke fester um sich. Die ersten Morgennebel lichteten sich bereits im Aischtal. Rotglühend schimmerte die aufgehende Sonne durch die Bäume des dichten Waldes. Der Morgensonne entgegen hinauf in Richtung Frankenhöhe, einer Hügellandschaft zwischen dem Aisch- und Zenntal im Rangau, ging die Reise. Dichte Eichen- und Buchenwälder bestimmten die Landschaft, nur unterbrochen von kleinen Dörfern und Weilern, hauptsächlich Besitzungen, die sich die verschiedenen Familien der Reichsfreiherren von Seckendorff mit den Rittern des Deutschherrnordens teilten. Zwielichtiges Gesindel, umherziehende Soldaten und Räuber sollten in den dunklen Wäldern hausen. Nur gemeinsam trauten sich die Bauern, ihre Schweine und Kühe auf die wenigen Hutungen zu treiben.
“Hü, ho, los vorwärts, hü”, schrie Christoph und trieb die Pferde mit dem schwer beladenen Reisewagen den steilen, steinigen Weg hinauf vorbei an der Burg Hoheneck. Er hatte zwar die Zusage des Burgherrn auf einen unversehrten Durchzug durch die dichten Wälder des Hohenecker Schussbachforstes, aber trotzdem war er froh, als sie das etwas lichtere und sichere Zenntal erreichten.
Bis zum Abend wollten sie bei einem Freund, dem berühmten Kupferstecher Johann Adam Delsenbach in Nürnberg sein, der ihnen durch seine guten Verbindungen zu den Händlern eine Mitreisegelegenheit in einem Nürnberger Handelszug verschaffen wollte. Immer noch war es gefährlich, alleine oder in kleinen Gruppen zu reisen.
Sie näherten sich der Freien Reichsstadt Nürnberg, eine der größten und reichsten Städte im ganzen Land. Vor vielen Jahren hatte Christoph hier seine Lehr- und Wanderjahre beendet und die Fertigkeiten eines Meisters erlangt.
Sie fuhren aus dem Wald heraus und erschraken, als plötzlich vor ihnen Todesvögel aufflogen. Hunderte schwarzer Raben kreisten, verdunkelten den Himmel und ein markerschütterndes Krächzen und Kreischen lag in der Luft. Christoph brachte den Wagen abrupt zum Stehen und sprang vom Bock. Auf dem Acker hier vor der Stadt sahen sie viele aufgeworfene Erdhügel. Der Gestank des Todes brannte beißend in der Nase. Vermummte Gestalten mit Kapuzen und Tüchern vorm Gesicht zerrten von einem Karren Stofffetzen und Leichenreste auf einen brennenden Holzstoß. Andere waren dabei, Gruben auszuheben und Leichen hineinzuwerfen. Sie bestreuten die Toten mit Kalk und schaufelten die Gräber wieder zu.
„Heda, macht, dass ihr weiterkommt“, rief ihnen einer der Wachen zu, „hier in den Dörfern vor der Stadt Nürnberg erntet der Schwarze Tod.“
Entsetzt blickten die Bartels auf das Geschehen und rasch kletterte Christoph wieder auf seinen Kutschbock. Er hatte gedacht, diese Seuche sei endlich ausgerottet. Sie fuhren weiter in Richtung Spittlertor.
Als sie am späten Nachmittag dort ankamen, fanden sie das Tor der Stadt verschlossen. Auf Anordnung des Stadtrates durfte niemand hinein oder heraus. Alle Reisenden mussten sich erst in ein Gehöft vor den Mauern der Stadt in Quarantäne begeben und dort zwei Wochen warten, bevor sie die Stadt betreten durften.
Soviel Zeit hatten die Bartels nicht, sie wollten ja zügig weiter. Christoph gelang es, einen der Stadtwachen zu überreden, seinen Freund ans Tor holen zu lassen. Es dauerte sehr lange, bis Delsenbach auf der Stadtmauer erschien.
„Grüß Gott Christoph, Ihr seid spät dran. Fang auf, hier habe ich ein Empfehlungsschreiben des Patriziers Abraham Levi Rosenzweig“, damit warf er ihnen den Brief von der Stadtmauer hinunter, „versucht es in den kleineren Städten und Dörfern nördlich der Stadt. Viel Glück und eine gute und gesunde Reise. Schreibt einmal, wenn Ihr angekommen seid.“ Delsenbach winkte ihnen noch einmal zum Abschied zu, bevor ihn einer der Wachen wegdrängte.
Heute, drei Tage nach ihrer Abreise aus Windsheim, waren sie mit einigen Kaufleuten, denen sie sich angeschlossen hatten, bis kurz vor die fürstbischöfliche Residenzstadt Bamberg gekommen, als das Unglück über sie hereinbrach. Sie fuhren in einem mit herrlich weißblühenden Schlehengebüsch gesäumten Hohlweg einen steilen Berg hinunter. Lauer Frühlingsduft lag in der Luft.
Christoph hatte Mühe, die Pferde zu zügeln. Obwohl er den Bremshebel fest angezogen hatte, schob der vollgepackte Wagen die Pferde abwärts. Plötzlich, mit lautem, markerschütterndem Geschrei stürzten von den seitlichen Hängen und den Bäumen maskierte Wegelagerer über den Kaufmannszug her. Alles ging sehr schnell. Des Meisters Pferde scheuten und brachen aus. Sie rasten mit der immer noch voll gebremsten Kutsche den Bergweg hinunter und rammten einen umgekippten Kaufmannswagen. Unten an der Kurve brach das Fuhrwerk nach links aus und flog über eine Böschung seitlich ins Gebüsch. Christoph wurde vom Bock geschleudert und landete durch das kratzende Dornengestrüpp in blühendem Bärlauch. Er konnte gerade noch erkennen, wie der Wagen umkippte und das Gespann mit lautem Krachen nach unten verschwand.
Völlig benommen lag er da, alles tat ihm weh. Der starke Knoblauchduft des Bärlauchs trieb ihn in die Höhe, er rappelte sich auf und sah entsetzt, wie die Räuberbande wütete. Wahllos stachen sie auf die Reisenden ein, rissen den Toten die Kleider von den Leibern und sackten alles ein, was sie gebrauchen konnten. Er hörte das laute und erbärmliche Schreien, Heulen und Betteln seiner Reisegefährten. Ängstlich kroch er tiefer zurück ins Gebüsch. Endlich zog die Bande mit den noch heil gebliebenen und nun vollgepackten Wagen der Reisegruppe ab. Noch eine kleine Weile, dann war Ruhe. Eine unheimliche Stille – Totenstille.
Vorsichtig stand er auf und rannte erst leise, dann immer lauter rufend zur Schlucht: „Anna Maria!“ Keine Antwort. „Frau? Anna Maria!“ Stille - ihm war, als hielte die Natur den Atem an, die Angst kroch in ihm hoch. Lebte Anna Maria noch? Tränen brannten in seinen Augen, wo war sie?
Dann - nahe am Abgrund fand er seine Frau, in sich zusammengekauert und schluchzend. Sie hatte gerade noch aus dem Wagen springen können.
Gott sei Dank, auch sie war nur leicht verletzt und blutete aus einer kleinen Platzwunde am Kopf. Verzweifelt und glücklich zugleich klammerten sich beide aneinander. Sie hatten überlebt!
Lautes Pferdewiehern drang von unten herauf. Christoph kroch an den Rand der Schlucht und entdeckte etwa acht Ellen tiefer seine zerschellte Kutsche und zuckende Pferdeleiber in einem knietiefen Bach.
„Bleib hier und rühr dich nicht vom Fleck, man weiß ja nie, ob die nicht noch einmal zurückkommen. Ich klettere hinunter und sehe nach, ob noch etwas zu retten ist.“
Vorsichtig rutschte Christoph den steilen Hang hinab, sich immer wieder am Gebüsch und an kleinen Bäumen festhaltend. Unten angekommen zerschnitt er die Riemen der eingespannten Pferde und löste sie vom Wagen. Er versuchte die Gäule einen nach dem anderen hochzuziehen. Aber es gelang ihm nicht. Laut wieherten die Pferde vor Schmerzen und knickten immer wieder ein, wenn er versuchte ihnen aufzuhelfen. Offensichtlich waren beide schwer verletzt, hatten sich Fesseln oder Beine gebrochen. Schweren Herzens erlöste er sie von ihrem Leiden und schnitt ihnen die Halsschlagadern durch. Das zweite Pferd zuckte noch einmal auf und ein großer Schwall Blut spritzte Christoph von oben bis unten voll.
Die Kutsche war nur noch ein Trümmerhaufen. Zusammen mit Anna Maria, die ihm nachgerutscht war, blieb ihm nichts anderes übrig, als die schweren Reisetruhen und ihre sonstige Habe aus dem Bach ans trockene Ufer zu ziehen. Aus dem nun offen stehenden Geheimversteck am Wagenboden nahm Christoph seine Gold- und Schmuckstücke an sich und versteckte sie in seinem weiten Mantel.
Erschöpft setzten sie sich auf eine der Kisten. Sie hatten Glück im Unglück gehabt. Dadurch, dass ihr Wagen das Steilufer hinabgestürzt war, hatten die Räuber sich nicht die Mühe gemacht, sie auszurauben.
Betend sanken beide in die Knie: „Herr, wir danken dir, dass du unser Leben gerettet hast. Bitte hilf uns jetzt weiter.“ Eng kuschelten sich die Eheleute aneinander, um sich gegenseitig zu wärmen. Jetzt im März war das Wasser doch recht kalt.
„Es wird bald Nacht, ich laufe zurück zum letzten Dorf, durch das wir vor etwa zwei Stunden gekommen sind, und hole Hilfe.“
„Bleib hier, bitte lass mich nicht alleine, ich habe Angst, die Räuber könnten zurückkommen. Warten wir lieber, bis jemand vorbeikommt“, flehte ihn seine Frau an.
„Also gut! Sehen wir erst einmal nach, was mit den anderen ist.“
Beide kletterten den Hang hinauf und schlichen vorsichtig zum Weg zurück. Nichts rührte sich mehr. Auf dem schmalen Hohlweg verstreut lagen die Ermordeten, grausam verstümmelt, halbnackt, ihrer Kleidung beraubt. Erbarmungslos hatten die Halunken auf die wehrlosen Kaufleute und ihre Gehilfen eingestochen, Hälse aufgeschlitzt und Köpfe eingeschlagen.
„Christoph, komm, hier lebt noch einer!“, rief Anna Maria plötzlich.
Nach weiterem Suchen fanden Christoph und Anna Maria nochmal einen schwer verletzten Kaufmann und eine ältere Dienstmagd. Diese hatte ebenso viel Glück gehabt wie sie und lediglich einige Abschürfungen davongetragen. Aber nervlich war sie völlig am Ende, zitterte und schluchzte in einem fort. Nur mühsam brachten sie aus ihr heraus, dass sie neben ihrer Herrschaft auch ihren Mann und ihren Sohn, beide Kutscher, bei dem Überfall verloren hatte.
Mit Stoffstreifen aus zerrissenen Kleidern, die verstreut herumlagen, verbanden sie notdürftig die Wunden der beiden Händler. Sie beratschlagten gerade, wie es nun weiter gehen solle, als sie Pferdegetrappel näherkommen hörten. Eilig zogen sie die Verletzten mit sich ins Gebüsch.
Eine schwer bewaffnete Eskorte geleitete mehrere Wagen den Weg herunter und näherte sich ihrem Versteck. Als die Soldaten die vielen Leichen sahen, stoppten sie und sicherten ihren Wagentreck sofort nach allen Seiten. Ein vornehm gekleideter Herr rief aus einer prachtvollen Karosse: „Herr Hauptmann, was ist da los? Lass Er nachschauen!“
Christoph erhob sich und trat vorsichtig aus dem Gebüsch. Sofort hielt ihn ein Bewaffneter mit einer Lanze in Schach.
„Helft uns Herr! Wir sind Räubern in die Hände gefallen“, flehte er zu dem hohen Herrn hinüber.
„Was geht uns das an! Wir sind in Eile!“, damit drängte ein Offizier hoch zu Ross Christoph zur Seite. „Macht Platz und belästigt seine Exzellenz Bischof Johann Theodor von Bayern nicht länger.“
Auf einen Wink des Hauptmannes wollten die Soldaten Bartel zur Seite drängen, aber der fiel auf die Knie und bettelte laut schreiend: „Exzellenz, bitte …! Es wird bald dunkel. Wenn Ihr uns schon nicht mitnehmt, dann wenigstens die beiden Schwerverletzten, die brauchen einen Medikus, sonst sterben sie.“ Christoph zeigte auf die beiden Kaufleute, welche die Frauen aus dem Gebüsch herausschleiften.
„Hört Ihr schlecht! Macht Platz! Wir sind in einer sehr wichtigen Mission zum Fürstbischof unterwegs und werden noch heute Abend erwartet“, schrie ihn der Hauptmann an.
„Bitte! Eure Exzellenz, denkt doch an die Worte Jesu in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wir sind auch unter die Räuber gefallen und solltet Ihr nun nicht genauso handeln, wie es in der Bibel steht?“ Bartel war zwischen den Soldaten hindurchgeschlüpft und hatte sich vor der Kutsche abermals auf die Knie geworfen.
„Was fällt Euch ein, mich, einen Bischof der Kurie, an die Heilige Schrift zu erinnern. Überhaupt, was wisst Ihr davon, Ihr als einfacher Handwerker, könnt Ihr überhaupt lesen? Am Ende seid Ihr ein Ketzer bei Eurem Betragen“, echauffierte sich der Angesprochene.
Offensichtlich hatte aber der Hinweis auf die Bibel den Bischof nach kurzem Zögern umstimmen können.
„Also gut, wir nehmen Euch mit. Ladet die Verletzten auf!“, gab er den Befehl. „Zwei meiner Männer werden Euch helfen und der Marketenderwagen soll Euch aufnehmen. Aber beeilt Euch! Wir warten nicht!“ Der Reisezug setzte sich wieder in Bewegung.
Die verletzten Kaufleute wurden auf den letzten Wagen gebettet und gegen ein kleines Trinkgeld waren die beiden Soldaten sogar bereit, die Truhen der Bartels zu holen und aufzuladen.
Mittlerweile dämmerte es bereits und in rasanter Fahrt hetzten sie den Vorausfahrenden hinterher. Kurz vor dem Stadttor holten sie den Tross ein, gerade noch rechtzeitig, bevor die Tore geschlossen wurden.
Der Wagen hielt neben einem stattlichen Anwesen, dem Gasthaus Zum Roten Ochsen.
„Hier könnt Ihr bleiben“, meinte einer der Soldaten und half bereits den beiden Frauen vom Wagen. Auch der Wirt war mit ein paar seiner Knechte eifrig zur Stelle, als er das Bischofswappen auf dem Wagen erkannte.
„Die zwei Verletzten bringen wir ins Spital.“ Mit einem kurzen Gruß verabschiedeten sich die Soldaten und fuhren weiter.
Anna Maria schaltete, bevor der Wirt es sich anders überlegen konnte: „Ein schönes Zimmer für meinen Mann und mich und eine Kammer für unsere Magd.“
In der Zwischenzeit hatten sich die beiden Frauen darauf geeinigt, dass Elisabeth als Magd für Kost und Logis mit den Bartels reisen würde.
Christoph zählte dem Wirt die ausgehandelte Summe in die Hand und erkundigte sich: „Wir sind auf dem Weg nach Bremen, dort will ich mich in Diensten der Hadson Companie nach Amerika einschiffen. Wir möchten uns gerne einem Handelszug in Richtung Norden anschließen. Könnt Ihr uns da weiter helfen?“
„Oh, da habt Ihr aber Pech. Alle Reisegruppen in diese Richtung sind in den letzten Tagen aufgebrochen. Da wären nur noch ein paar aus Schwäbisch Hall, die mit einer Ladung Salz nach Leipzig wollen. Ich mach Euch später bekannt.“ Damit verließ der Wirt das geräumige Zimmer, das er den Bartels vermietet hatte.
„Gerne könnt Ihr Euch uns anschließen, Meister Bartel. Von Leipzig aus kommt Ihr in gut zwei Tagen nach Torgau an die Elbe. Von dort könntet Ihr ein Schiff nehmen, das Euch den Fluss abwärts bis Hamburg bringt. Es ist der schnellste und sicherste Weg.“
Froh nahm Christoph das Angebot des Handelsherrn an.
Auch der Wirt riet ihm dazu: „Schließt Euch dem schwerbewaffneten Treck der Schwäbisch Haller an. Man weiß nie, wann sich wieder so eine günstige Gelegenheit ergibt.“
Nachdem der Zug erst in zwei Tagen aufbrechen wollte, hatte der Meister Zeit und Muße, sich die Bischofsstadt genauer anzusehen. Am Nachmittag stand er am Prachttor vor dem Bamberger Dom und betrachtete erstaunt eine aus Sandstein gehauene Figur. Die bildhübsche Jungfrau hatte einen zerbrochenen Stab in der rechten Hand und zehn Ziegel in der linken. Ihre Augen waren mit einem Tuch verbunden. Seltsam, dachte er und schüttelte den Kopf.
„Werter Herr, Ihr seid nicht von hier - oder?“, fragte ihn ein kleines spindeldürres Männchen, das ihn schon seit einiger Zeit beobachtete. „Kennt Ihr die Geschichte?“
Bartel schüttelte den Kopf und sah ihn fragend an.
„Man nennt die Figur die blinde Jungfrau, oder auch die blinde Gerechtigkeit und erzählt sich Folgendes: Eine Jungfrau wurde einst der Unzucht beschuldigt, sie beteuerte aber immer wieder ihre Unschuld. Vergebens – trotz ihres Flehens wurde sie gefoltert und schon halbtot erst vor den Dom und dann zum alten Schloss vors Gericht geschleppt. Verzweifelt bettelte sie zum Himmel: Der Mensch hat kein Erbarmen mit meiner Unschuld, ihr Ziegel auf dem Dache habt´s noch eher, so erbarmt ihr euch meiner! Kaum hatte sie das gerufen, fielen zehn Ziegel vom Dach und schlugen sie tot. Volk und Richter nahmen es als Himmelszeichen ihrer Unschuld. Seitdem mahnt das steinerne Bildnis der Jungfrau hier. Allerdings vergaß der Bildhauer die Augenbinde, die das blinde Urteil bedeuten soll. Darum verbindet man ihr nun die Augen mit einem Tuch ,und immer, wenn der Stoff verfault herabfällt, soll die Jungfrau um Mitternacht auf dem Domplatz auf- und niederschweben.
Einige Wachposten, die sie gesehen haben wollen, hatten nicht den Mut, sie anzurufen. Es heißt, sie pocht solange an die Wohnungen der Domherren und schwebt hier herum, bis sie wieder eine frische Augenbinde bekommt.“
Kopfschüttelnd über so viel Dummheit und Herzlosigkeit meinte der Meister: „Nun das hat ihr auch nicht mehr geholfen. Aber wenigstens ein gnädiger Tod."
Von einem nahegelegenen Fuhrbetrieb erstand Bartel zu einem angemessenen Preis einen stabilen Planwagen und zwei starke Kaltblüter.
„Gebt den Pferden Bier, wenn Ihr einmal eine Höchstleistung von ihnen wollt, sie haben zu einer Brauerei gehört und sind das Biersaufen gewöhnt“, riet der Verkäufer Christoph lachend.
Bereits zwei Tage später fuhren sie in Richtung Norden, naja, vielleicht etwas zu weit nach Nordosten.
Am Tag bevor sie losfahren wollten, war ein großer Handelszug aus Nürnberg angekommen. Es hatten nun alle beschlossen, erst gemeinsam nach deren Ziel Halle und dann weiter nach Leipzig zu reisen. Vielleicht ergab sich unterwegs noch eine Gelegenheit für Christoph und Anna Maria, sich einer anderen Reisegruppe anzuschließen, deren Weg besser für ihre geplante Richtung passte. Nun waren sie ein großer Treck mit über 40 Wagen und fast 80 Söldnern. So waren sie sicher, von keinem Gesindel überfallen zu werden. Allerdings ging es etwas langsamer, es dauerte seine Zeit, bis sich dieser Wagenzug jedes Mal wieder in Bewegung setzte.
Nach neun Tagen erreichten sie Halle, eine schmucke kleine Stadt mit einer sehr alten Universität. Gut drei Wochen waren nun seit dem Aufbruch in Windsheim vergangen. Je länger sie darüber nachdachten, umsomehr waren die beiden Eheleute überzeugt, dass Gott trotz allen Unglücks seine schützende Hand über sie gehalten hatte und sie glimpflich davongekommen waren.
Christoph entschloss sich, erst einmal eine größere Rast einzulegen und die Reise bei einer günstigen Gelegenheit nach Bremen fortzusetzen. Sie mieteten sich in einem kleinen, sauberen Gasthaus nahe der Universität ein - sehr preiswert, darum verkehrten hier mehr Studenten als Reisende. Mit dem Wirtsknecht vom Gasthaus Zum Wilden Mann, einem der führenden Häuser, in dem die durchreisenden Handelszüge haltmachten, hatte er vereinbart, dass dieser ihm Nachricht gab, sobald eine geeignete Reisegesellschaft ankäme.
Am zweiten Abend, die Bartels saßen gerade beim Abendbrot in einer Ecke des Wirtshauses, fragte sie der Wirt, nachdem er jedem einen großen Humpen Bier serviert hatte: „Wo seid Ihr eigentlich her? Ihr sprecht schon etwas anders als wir.“
„Wir kommen aus Windsheim, einer Reichsstadt zwischen Rothenburg und Nürnberg. Etwa zehn Tagesreisen südlich von hier, im Frankenland“, antwortete Christoph dem freundlichen Mann.
„Windsheim? Das habe ich doch schon mal gehört - Else!“, schrie er nach hinten, „woher kennen wir Windsheim?“
„Na einer der Studenten, der Medikus, der Große! Wie hieß er doch gleich nochmal? Der war schon einige Zeit fertig mit dem Studium, hatte nur noch keine rechte Lust zum Arbeiten“, erklärte seine Frau.
„Ach, du meinst den Stellers Georg, oder?“
„Ja, genau den!“
„Der ist doch im letzten Jahr nach St. Petersburg aufgebrochen, an die Akademie des Zaren.“
„Meint Ihr den Georg Wilhelm Steller, einen Studenten der Medizin, der Theologie und vieler anderen Wissenschaften?“, fragte Christoph nach.
„Ja, aber der ist wie gesagt kein Student mehr. Der ist schon fertig mit seinem Studium und ist nun ein Arzt“, erwiderte der Wirt, „der Meiers Friedrich, einer der Philosophiestudenten, der kennt ihn gut. Ist auch so ´n Eigenbrötler wie der Steller. Morgen am Sonntag, da kommt er gewöhnlich zum Mittag vorbei. Soll ich Euch miteinander bekannt machen?“
„Wenn sie wollen“, Christoph war nicht sehr begeistert, er kannte den Steller ja nur aus seiner Anfangszeit vor über zehn Jahren in Windsheim, da war er ihm ein paar Mal begegnet. Was wollte er nun mit diesem Meier? Aber was soll´s, war vielleicht eine kleine Abwechslung während der Warterei.
Am nächsten Tag stellte der Wirt die beiden einander vor: „Meister Bartel kommt, setzt Euch hier an den Tisch. Das ist der Student Meier, er kann Euch weiterhelfen.“
Widerwillig setzte sich Christoph.
Es wurde erfreulicherweise ein lustiger und unterhaltsamer Nachmittag, den man in der Sonne sitzend vor dem Wirtshaus gemeinsam verbrachte. Von dem Studenten der Philosophie und Theologie erfuhr der Schneidermeister, dass von den Abgesandten des Zaren immer noch Wissenschaftler aller Fachrichtungen und auch Handwerker zur Erkundung des großen russischen Reiches gesucht wurden. Auch Steller versuchte dort sein Glück.
„Wäre das nicht etwas für uns?“, fragte Anna Maria ihren Mann, „Wir bräuchten dann nicht über das große Meer.“
Im Grunde war das die größte Angst der Windsheimerin, das durfte sie sich aber nicht anmerken lassen, denn ihr Mann zeigte dafür kein Verständnis.
„Fahrt nach Leipzig, dort ist die Gesandtschaft. Zahlen sollen die auch recht gut. Viele Studenten von hier sind schon in deren Dienste getreten“, riet Meier ihnen.
„Das müssen wir noch einmal in Ruhe besprechen. Habt jedenfalls vielen Dank. Sollten wir nächsten Sonntag immer noch hier sein, junger Freund, so seid Ihr gerne zum Mittagessen eingeladen“, damit verabschiedete sich Christoph.
Später am Abend drängte Anna Maria ihren Mann: „Nun sag doch schon was! Was hältst du davon? Gehen wir nach Russland! Neu anfangen wolltest du doch, warum nicht im Osten statt im Westen? Seit der Zarin Katharina sprechen doch viele Russen auch deutsch.“
„Ich weiß nicht. Amerika soll das Land der Freiheit sein. Dort in Russland herrscht genauso der Adel wie bei uns. Aber wenn du meinst, können wir uns ja in Leipzig bei der Gesandtschaft erkundigen.“
Die Zarin Anna Iwanowna setzte die wissenschaftlichen Forschungen ihres vor drei Jahren gestorbenen Onkels, Zar Peter, fort. Sie sei als eine Freundin der Deutschen bekannt, hatten ihm Meier und seine Kommilitonen erzählt. „Vielleicht kann ich dort mein neues Glück versuchen. Forschungsreisen - so richtig vorstellen, was das ist, kann ich mir nicht”, meinte Christoph zu seiner Frau, als er das Licht ausblies, „schlaf jetzt, morgen wird ein harter Tag.“
Lange noch blieb Christoph in dieser Nacht wach liegen und grübelte vor sich hin. Vielleicht kam er dort, in den Weiten des russischen Reiches, zur Ruhe?