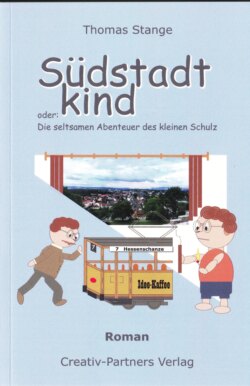Читать книгу Südstadtkind - Thomas Stange - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.
ОглавлениеWie wir bereits gehört haben, hatte der kleine Schulz zu dieser Zeit eine ganze Menge Freunde. Es waren meist Nachbarskinder, mit denen er sich seine viele freie Zeit vertrieb; Nikodemus, Michael, Florian und noch ein paar andere, die man beobachten konnte, wie sie an der „Kleinen Fulda“ nebenan nach versunkenen Schätzen fischten, wie sie mit ihren Rollern und kleinen Fahrrädern über die Auewege rund um den großen Spielplatz fegten oder wie sie mit Stöcken nach den Kastanien warfen, die sich von ihrem angestammten Baum einfach nicht verabschieden wollten.
Doch der kleine Schulz hatte noch einen weiteren Freund. Dieser Freund war so ganz anders, als die Jungen aus der Nachbarschaft. Das mochte zum einen daran liegen, dass dieser viel älter war als die anderen Freunde vom kleinen Schulz. Und eigentlich war er auch schon viel zu alt, um ein Freund vom kleinen Schulz zu sein, zu alt, um sich mit so einem kleinen Jungen wie dem kleinen Schulz abzugeben. Schließlich zählte er bereits zwölf Lenze und der kleine Schulz brachte es gerade einmal auf deren fünf.
Trotzdem war Rainer – so hieß der Junge nämlich – der Freund vom kleinen Schulz, denn Rainer war eben anders. Anders als andere Zwölfjährige. Stiller, leiser als andere. In sich gekehrt. Voller Phantasie. Voller Träume. Voller Interesse für alles Technische. Doch war er mit einem schlimmen Handicap belastet, überhaupt und besonders für einen Zwölfjährigen: Rainer fiel es sehr schwer, sich zu artikulieren. Nicht, dass er nicht hätte sprechen können, nicht, dass er gestottert hätte, nicht, dass er unfähig gewesen wäre zu einem klaren Gedanken.
Nein, es waren einfach die Worte, die bei ihm nicht fließen wollten, besonders, wenn er unter Druck stand, wenn er aufgefordert wurde zu sprechen, etwa von anderen Kindern oder vom Lehrer in der Schule oder von seinen Eltern, die damals noch kein Verständnis für seine Behinderung hatten und meinten, ihr Sohn müsse sich doch nur gefälligst zusammenreißen, denn er könne doch sprechen, wenn er nur wolle.
Immer wenn es so kam, stockten Rainer die Worte. Wer ihn dabei beobachtete, mit offenen Augen und offener Seele, der konnte sehen, konnte fühlen, wie sich die Worte, die Sätze in seinem Kopf stauten, wie sie sich drängten auf ihrem Weg zu seiner Kehle, seinen Stimmbändern, um hinaus zu gelangen, der konnte Zeuge werden des Kampfes, den der Junge dabei mit sich selbst ausfocht und der manchmal in Form eines wilden Wortschwalles zu seinen Gunsten ausging, den er jedoch sehr viel häufiger verlor.
Rainer und der kleine Schulz waren die besten Freunde. Denn in Gegenwart vom kleinen Schulz hatte Rainer nie das Gefühl, Rede und Antwort stehen zu müssen, denn der kleine Schulz erwartete von Rainer nichts, außer dass der ihn an seiner Phantasie, an seinen Träumen und seinem Wissen teilhaben ließ. Doch der Reihe nach.
Alle zwei Wochen, zumeist an einem Mittwoch oder Donnerstag, nahm Mutter Schulz nach dem Mittagessen ihren Sprössling zur Hand, tauschte dessen Räuberzivil gegen einen gesellschaftsfähigen Anzug, machte sich selber stadtfein, nahm ihren Jungen an die Hand und verließ die Wohnung. Hand in Hand ging es das kurze Stück die Auestraße hinauf bis zur Frankfurter Chaussee, von dieser gegenüber die Tischbeinstraße abzweigt. Wer dort hinwollte, hatte zuvor vier Fahrspuren plus zwei Straßenbahngeleise zu überqueren. Es galt also abzuwarten, bis die Fußgängerampel auf grün springen und damit den Weg freigeben würde.
Als Mutter Schulz nebst Anhang die Kreuzung erreichte, wechselte die Fußgängerampel gerade von Grün auf Rot. Die Auto- und Lastwagenwelle, ampelgebändigt, brandete ohrenbetäubend, angsteinflößend, Qualm verbreitend auf und rollte brüllend die „Beamtenlaufbahn“ hinauf; Hupen, Quietschen, Heulen, Knattern, in schwarz, weiß, grau und braun – der kleine Schulz kam sich vor wie im Paradies. Seine Augen huschten von PKW zu LKW zu PKW im schnellen Erfassen, Erkennen und Klassifizieren jedes einzelnen Autotyps, jeder Lastwagenbauart, denn der kleine Schulz war ein Junge seiner Zeit, und alle Automarken zu kennen und zu erkennen war für einen richtigen Jungen Ehrensache.
Dann begannen die ersten Autos abzubremsen, die Welle schien wieder zum Stillstand kommen zu wollen. Dann verharrten die Autos, und die Fußgängerampel sprang auf Grün. Mutter Schulz fasste ihren Sohn fester und marschierte schnellen Schrittes los. Die aus der Tischbeinstraße nach rechts auf die Frankfurter Straße abbiegenden Autos hatten den querenden Fußgängern Vorrang zu gewähren. Mutter Schulz maß das zuvorderst haltende Auto samt dessen Fahrer mit bitterbösem Blick, auf das er ja nicht auf die Idee kommen solle anzufahren, während sich Frau Schulz noch auf der Fahrbahn befand.
Dann war das rettende Trottoire auf der anderen Straßenseite erreicht und der kleine Schulz strebte neugierig zu dem an der Ecke befindlichen Blumenladen, denn bei dem gab es Blumensträuße aus dem Automaten, was dem kleinen Schulz wie das achte Weltwunder erscheinen wollte. Mutter Schulz indes würdigte den Automaten keines Blickes; Automatenblumen widersprachen ihrem Weltbild fundamental.
Weiter ging es nun die Tischbeinstraße entlang, vorbei an den Garagen der Autowerkstatt, deren große Blechtore den kleinen Schulz auf merkwürdige Weise erschauern ließen. Dann kam die kleine Tankstelle, die von all‘ jenen Autofahrern gern genutzt wurde, die vom Stadtteil Wehlheiden in die Südstadt und von dort weiter ins Zentrum wollten und zur Sicherheit noch ein paar Liter Benzin mit auf den Weg zu nehmen gedachten.
Dann kam auf der anderen Straßenseite bereits das große Gebäude der Druckerei in Sicht und noch eine Tankstelle – und der Abzweig mit den geheimnisvollen Straßen, die von dort kopfsteingepflastert links und rechts den Weinberg hinauf und hinab führten.
Hatten wir schon erwähnt, dass der kleine Schulz vom lieben Gott mit einem großen Vorrat an Phantasie versehen worden war? Alles, was er nicht kannte, war für ihn nicht einfach nur neu, sondern höchst geheimnisvoll. Wege, die er noch nicht gegangen war, wo mochten sie hinführen? Welche Geheimnisse mochten sich an ihrem Ende verbergen? Straßen, die er nicht einfach kennen lernte, sondern entdeckte; welche neuen Einblicke in die Welt mochten sie vor seinen, des kleinen Schulz‘, Augen verbergen?
Und so war es eben auch mit den harmlosen Nebenstraßen, die die „Tischbein“ mit dem Wohngebieten am Südhang des Weinberges verbanden; jedes Mal, wenn der kleine Schulz an der Hand seiner Mutter an ihnen vorbei kam, fühlte er sich erneut von deren Geheimnissen fasziniert.
Vielleicht sollte man an dieser Stelle anmerken, dass die Tischbeinstraße die Stadtteile Wehlheiden und Südstadt miteinander verbindet und dabei durch einen tiefen Taleinschnitt führt, der auf der einen Seite vom Südhang des Weinberges und auf der anderen vom Nordhang des Auefeldes begrenzt wird. Was für den kleinen Schulz die Wanderung an der Hand der Mutter zum Faszinosum machte. Welche Geheimnisse bargen die Berge zur Rechten und zur Linken? Was war dort oben? Wie sah es dort aus? Welche Abenteuer warteten dort darauf, vom kleinen Schulz endlich erlebt zu werden? Fragen über Fragen, durchträumt vom kleinen Schulz, während er gedankenversunken an der Hand seiner Mutter daher tändelte.
Vorbei geht es nun an dem Kiosk, der sich auf der anderen Straßenseite befindet und zu dessen Passage Mutter Schulz lieber die gesamte Straßenbreite zwischen sich und ihm weiß, denn es steht „Trinkhalle“ an der Bretterbude angeschlagen, und man weiß schließlich nie, wer dort so alles trinkt und in welchem Zustand der sich gerade befindet, und überhaupt und schon gar nicht, wenn sie das Kind dabei hat. Das Kind hätte gerne ein Eis gehabt, denn es ist warm an diesem Sommertag, und Eis gibt es in solch kleinen Geschäften, das weiß der kleine Schulz und sieht deshalb die Trinkhalle mit einigem Bedauern in seinem Rücken entschwinden.
Sie sind nun schon eine ganze Weile unterwegs, eine halbe Stunde vielleicht, die Straße zieht sich dahin, und der Weg ist eigentlich ziemlich weit für einen kleinen Jungen, doch der ist das ja gewöhnt, schließlich ist er gut im Training, von den Märschen in die Stadt mit seiner Großmutter, weshalb er auch nicht quengelt oder zaudert, als die Mutter jetzt an einem Fußgängerüberweg verhält, demonstrativ nach rechts und nach links schaut, „Die Straße ist frei“ sagt (denn das Kind soll stets etwas fürs Leben lernen), und dann forschen Schrittes die Straße überquert.
Immer mehr Geheimnisse zweigen nun rechts und links von der Tischbeinstraße ab. An einem von ihnen steht „Kantstraße“ daran. Grobes Kopfsteinpflaster, rechts und links hohe Vorkriegshäuser. Dahinein biegen sie ab. Allerdings hat diese Straße nichts Geheimnisvolles mehr an sich, denn der kleine Schulz kennt sie gut und auch das Haus, vor dem sie nun stehen bleiben. Viele Klingelknöpfe, ein altes, schönes, dunkles, knarrendes Holztreppenhaus mit breiten, flachen Stufen und halbverglasten Flurtüren.
Mutter Schulz drückte auf einen der Klingelknöpfe. „Reichenbach“ stand auf dem kleinen Schildchen daneben. Der kleine Schulz spürte die Vorfreude in sich aufsteigen. Die Vorfreude auf Rainer.
Martha Reichenbach war Mutter Schulz‘ Schwester und Rainer war ihr Sohn. Eine Tochter gab es auch. Die hieß Inge, war älter als Rainer, ging bereits in die Lehre und war daher meist nicht zuhause. Und auch Rainers Vater Walter Reichenbach war nicht daheim, sondern an der Arbeit, wie übrigens auch Vater Schulz, der sich nach Dienstschluss ebenfalls bei Reichenbachs einfinden würde, um nach einer schnellen Tasse Kaffee seine kleine Familie per Auto nach Hause zu befördern.
Die beiden Schwestern trafen sich also zum Kaffeetrinken, während sich die beiden Söhne zunächst ebenfalls an der Kaffeetafel nicht nur einzufinden hatten, sondern von ihnen auch artiges, höfliches, zurückhaltendes und, vor allem, stilles Verhalten erwartet wurde. Was Rainer niemals schwerfiel, dem kleinen Schulz jedoch einiges Bemühen abverlangen würde. Nach dem Kaffee würden sie sich die Zeit dann alleine vertreiben dürfen.
Rainer war da. Natürlich. Schließlich hatte er den Besuch erwartet. Der kleine Schulz kam. Darauf hatte er sich gefreut. Auf seine Weise. Wortkarg eben.
Und auch der kleine Schulz war glücklich. Allerdings zunächst nur auf Sparflamme. Denn das gemeinschaftliche Kaffeetrinken zog sich hin, nicht zuletzt deshalb, weil Rainer, für sein Alter hochgewachsen und dabei von spindeldürrem Körperbau, ungeahnte Mengen an Kuchen vertilgen konnte. Schließlich beantwortete er die Frage nach einem weiteren Stück jedoch mit einem langgezogenen Nnnnneiiin!“ und trank mit einer etwas eckigen Bewegung seine Kakaotasse leer. Damit war der Weg frei.
Die Kinder wurden gnädig vom Tisch und aus der Gesellschaft der Erwachsenen entlassen. Rainer und der kleine Schulz trollten sich in Rainers Jugendzimmer. Dies sah eigentlich mitnichten so aus, wie man sich den Zustand eines Jugendzimmers der damaligen Zeit vielleicht gemeinhin vorstellen mochte. Denn Rainers Zimmer war still, lautmalerisch gesprochen. Keine übertriebene Ordnung, aber auch keinerlei Unordnung fand sich darin, dafür eine Reihe von Gegenständen, denen man ansah, dass sie bereits seit geraumer Zeit nicht mehr zur Hand genommen worden waren. Staub. Nicht übermäßig, aber sichtbar. Dazu viele Zeugnisse der vielfältigen naturwissenschaftlichen Interessen seines Bewohners. Kakteen verschiedener Arten und Größen auf dem Fensterbrett. Posthornschnecken, Flohkrebse und Amöben in verschiedenen Aufzuchtstadien, eine komplette Tümpelfauna in Weckgläsern und Glasvasen an und rund um das einzige Fenster, das den Blick auf einen düsteren, teils buschbewachsenen, teils gepflasterten Hinterhof freigab. Und trotzdem oder gerade deshalb strahlte dieses Zimmer in den Augen des kleinen Schulz das pure Leben aus. Es war voller Energie, voller Träume, voller Phantasie; es stand für alles, was sich der kleine Schulz schon immer gewünscht hatte und was er in seinem eigenen Zuhause entbehren musste – ja, er hatte ja noch nicht einmal ein eigenes Zimmer; mithin galt es, diesen Besuch bis auf den Bodensatz auszukosten.
Rainer wusste dies alles oder ahnte und fühlte es zumindest. Da er jedoch, auch schon als Zwölfjähriger, viel nachdachte, über sich und seine Behinderung, die er als Krankheit empfand, was zu erkennen sich seine Eltern jedoch standhaft weigerten, da er also viel nachdachte, wusste er noch viel mehr. Er wusste zum Beispiel, dass seine Kakteen und Flohkrebse und Schnecken und Amöben nichts als ein Versuch waren, aus seinem Sprachgefängnis auszubrechen. Diese ganzen winzigen Organismen bewiesen ihm, dass es Leben gab auch auf niedrigster Stufe und dass er, indem er sein Interesse diesem Winzigsten widmete, auf seine Weise Geheimnisse lüften und Abenteuer erleben konnte, wenn schon nicht draußen in der Welt, so doch mit der Lupe in der Hand und mit dem Auge am Okular seines Mikroskops. Und er wollte an seinen Abenteuern gerne jemanden teilhaben lassen. Denn die schönsten Erlebnisse verlieren ihren Reiz, wenn man sie nicht anderen erzählen kann.
Und der kleine Schulz hörte zu, wenn Rainer erzählte. Der prahlte nicht, schnitt nicht auf, übertrieb nicht. Er sprach und erzählte fließend und sachlich, da niemand da war, der ihn hätte unter Druck setzen wollen. Er berichtete und war auch nicht ungehalten, wenn ihn der kleine Schulz unterbrach, und das tat dieser häufig, denn er hatte Fragen. Nicht irgendwelche dummen Kleine-Jungen-Fragen, sondern sachliche, vernünftige Fragen. Fragen, wie sie Rainer gerne beantwortete, zeugten sie doch davon, dass man ihm, Rainer, zuhörte. Und jemand, der ihm zuhörte, voller Interesse, so jemanden hatte Rainer gewöhnlich nicht um sich.
So verstanden sie sich, die zwei, so unterschiedlich sie waren, und hörten einander zu, der Kleine dem Großen und der Große dem Kleinen, bis die Rede schließlich auf ihr Lieblingsthema kam: Die Eisenbahn.
Oh ja, sie waren beide Eisenbahnnarren, der eine kleine noch ein ganz neuer, der andere große bereits ein „arrivierter“. Der kleine Schulz hatte gerade vergangene Weihnachten eine Modelleisenbahn auf dem Gabentisch gefunden. Rainers Eisenbahn indes lag noch verpackt auf dem Dachboden, derweil die Familie seit ihrem letzten Umzug noch keinen Platz für deren Aufbau gefunden hatte. Deshalb mussten sich die zwei angehenden Eisenbahner damit begnügen, über den Gegenstand ihres Interesses zu diskutieren: über Lokomotiven - in diesen frühen sechziger Jahren natürlich über solche, die mit Dampf betrieben wurden – wobei sich herausstellte, dass der kleine Schulz von den schwarzen Ungetümen zwar sehr fasziniert war, aber noch keine Vorstellung davon hatte, wie diese wohl funktionieren mochten.
Diesem Umstand könne abgeholfen werden, meinte Rainer, begann in den unendlichen Weiten seines Kleiderschrankes zu kramen und brachte schließlich eine kleine Dampfmaschine zum Vorschein, deren deutliche Gebrauchsspuren von einem langen und überwiegend unter Hochdruck verbrachten Leben kündeten, welches ganz im Gegensatz zu den an ihr vorgenommenen Pflegearbeiten gestanden haben musste. Rainer wuchtete das schwere Stück auf seinen Schreibtisch.
„Es ist wohl Jahre her, dass ich die Maschine das letzte Mal angefeuert hab‘“ meinte Rainer. Er drückte sich zumeist sehr präzise und korrekt aus. Hin und wieder verfiel er jedoch in seinen Heimatdialekt und sprach dann breites Kasselänerisch. Jetzt bückte er sich gerade, um dem alten Gerät in die Feuerbüchse zu schauen.
„Ähh – Moment `mal“ meinte er und begann, in dem schwarzen Loch herum zu tasten. Schließlich brachte er einen kleinen Blechschieber zum Vorschein, eigentlich gedacht zur Aufnahme von Esbit-Steinen, so genanntem Trockenspiritus. Der Schieber war voller Asche und angesengter Papierschnipsel. Weiteres Tasten in der Feuerbüchse ließ weiteres Papier sowie Holzreste zum Vorschein kommen.
„Das letzte Mal hatte ich wohl kein Esbit zur Hand“ präzisierte Rainer sachlich.
„Und jetzt?“ wollte der kleine Schulz wissen, der seinen Eifer und seine Begeisterung kaum noch zu zügeln vermochte.
„…habe ich immer noch kein Esbit“ ergänzte Rainer ungerührt.
„Wo gibt es das denn?“ fragte der kleine Schulz.
„Im Spielwarenladen gegenüber; zumindest hatten sie es früher einmal“ meinte Rainer nachdenklich.
„Was meinst du, könnten wir nicht hinüber und einmal fragen, ob sie vielleicht…“ Der kleine Schulz war hoffnungsvoll.
„Nein“ entgegnete Rainer, „völlig unmöglich!“, drehte sich um und verließ das Zimmer. Ließ den kleinen Schulz einfach stehen.
Der setzte sich auf den Stuhl am Schreibtisch. Blieb sitzen und stand nicht auf, was er ja ohne weiteres hätte tun können. Er hätte auch an der Dampfmaschine herum probieren können, ohne dass ihn irgendjemand daran gehindert hätte. Aber er tat es nicht. Er stand auch nicht auf, um zu seiner Mutter und seiner Tante ins Wohnzimmer zu gehen. Nein, er blieb sitzen, wo er war, und genoss das Zimmer. Dessen Atmosphäre. Die Präsenz seines Bewohners, die deutlich zu spüren war. Auch für einen Fünfjährigen. Gerade für einen Fünfjährigen. Der kleine Schulz genoss die Stille. Und wartete. Bis die Tür aufging und Rainer wieder da war. Mit Esbit-Steinen.
Sie reinigten gemeinsam die verrußte Feuerbüchse und bekamen dabei schwarze Finger. Sie holten Tante Marthas Gießkanne, mir der diese ihre Topfpflanzen goss, füllten sie mit Wasser und füllten daraus den Kessel der Dampfmaschine. Rainer legte mehrere Esbit-Steine in den Blechschieber, hielt ein Streichholz daran, wartete, bis alle Steine gleichmäßig brannten und schob den Schieber unter den Kessel.
„Wie lange wird es dauern, bis das Wasser kocht?“ wollte der kleine Schulz wissen?
„Mindestens eine Stunde und vierzig Minuten“ antwortete Rainer verschmitzt lächelnd, während wenige Sekunden später das Wasser im Kessel bereits begann, leise zu säuseln.
In Rainers Zimmer breitete sich der intensive Geruch brennender Esbit-Steine aus, der für den kleinen Schulz von nun an für den Rest seines Lebens untrennbar mit diesem Augenblick im Zimmer seines Cousins Rainer verbunden sein würde.
Wenige Minuten später war das Säuseln im Kessel der Dampfmaschine zunächst lauter geworden, dann wieder leiser – ein sicheres Zeichen, dass das Kesselwasser zu kochen begonnen hatte. Und nun begann auch das kleine Sicherheitsventil auf der Oberseite des Kessels leise zu zischen. Rainer öffnete das Pfeifenventil - „Pfiiiiii“ – toll, wie bei einer richtigen Dampflok, verbrannte sich dabei unweigerlich die Finger – „Auuuuaaa!“ – Ventil mit flinken Fingern wieder schließen, dem Schwungrad am Dampfzylinder einen kleinen Schubs geben, um den Anlaufwiderstand zu überwinden – und schon schnurrte die Maschine los.
Der kleine Schulz war verzückt. Nein, falsch, der kleine Schulz war viel zu aufgeregt, um verzückt zu sein. Er wusste gar nicht, wohin er zuerst schauen sollte, so nahm ihn dieses Schauspiel, dieses Experiment, dieses unglaubliche Erlebnis gefangen.
Das sich blitzschnell drehend Schwungrad, die hin und her jagende Kolbenstange, der Geruch nach Öl, Brennspiritus, nach sich ausbreitendem Wasserdampf, dies alles prägte sich tief ein in die Seele des kleinen Jungen, der aus seiner Faszination erst erwachte, als die Umdrehungen des Schwungrades merklich langsamer wurden und Rainer den Schieber unter der Feuerbüchse hervor zog, um das Feuer zu löschen, bevor das Wasser im Kessel komplett verdampft sein würde – und die Zimmertür aufging, darin der von seiner Arbeit heimgekehrte Vater Reichenbach, der sich erkundigte, ob man denn noch ganz bei Trost wäre, Dampfmaschine, Dampf, Feuer, Wasser, Spiritus, geschlossenes Fenster, Radau… und was er sonst noch auszusetzen hatte.
Egal. Der kleine Schulz war seinem Freund und Cousin Rainer ganz doll dankbar. Und glücklich. Glücklich war er. Und vielleicht ahnte er, dass dieser Nachmittag für ihn eine Lebensbedeutung haben sollte.