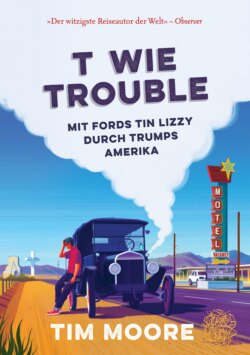Читать книгу T wie Trouble - Tim Moore - Страница 6
ОглавлениеKAPITEL 2
Zu lernen, wie man einen Ford Model T fährt, ist ein teuflischer, leidvoller und oft angsteinflößender Prozess, der ganz und gar im Widerspruch steht zur heiteren und geflissentlichen äußeren Erscheinung des Autos. Wenn Sie zum ersten Mal hinter dem Steuer eines T sitzen, nehmen Sie sich Zeit, um das vertraute Gefühl des runden Lenkrads vor Ihnen und dessen beruhigende traditionelle Beziehung zu der gewünschten Fahrtrichtung zu genießen. Ich spreche diese Empfehlung aus, weil alles andere, was Sie über das Steuern eines Kraftfahrzeugs gelernt haben – absolut alles – im Begriff ist, vor Ihren entsetzten und traurigen Augen in der Luft zerrissen, mit Füßen getreten und verbrannt zu werden.
Schauen Sie hinab auf Ihre Füße. Dort befinden sich drei Pedale, was auf ermutigende Weise dem Standard zu entsprechen scheint, jedoch trügerisch ist. Das rechte, das Sie ohne Zweifel als das Gaspedal kennengelernt haben, ist die Bremse. Das linke ist die Kupplung, aber freuen Sie sich nicht zu früh. Treten Sie es halb durch und der Wagen befindet sich im Leerlauf. Indem Sie das Pedal auf den Boden durchtreten, wählen Sie den ersten Gang; nehmen Sie den Fuß herunter, schalten Sie in den zweiten. Weitere Vorwärtsgänge gibt es nicht und auch keinen Schalthebel. Willkommen in der Welt von Henry Fords Planetengetriebe: »die automatische Schaltung, die Sie mit den Füßen fahren«. Mittlerweile wird es Sie nicht überraschen zu erfahren, dass das mittlere Pedal, das als Bremse zu schätzen Sie gelernt haben, den Rückwärtsgang einlegt.
Richten wir unsere Aufmerksamkeit nun, mit bereits vor Unbehagen zusammengekniffenen Arschbacken, auf den großen Dampfmaschinen-Hebel, der aus dem Boden aufragt und der sich intim an Ihrem linken Oberschenkel reibt. Sicher ist das eine Handbremse. Aber ja – ja, tatsächlich! Ein bisschen. Allerdings fungiert er gleichzeitig als eine Art behelfsmäßige Kupplung, die als schrullige Parodie ihres per Fuß bedienten Gegenstücks dient. Ganz nach vorne gedrückt aktiviert der Hebel den zweiten Gang. Mittig eingestellt ist der Leerlauf eingelegt, jedoch vermag der Wagen in dieser Position auch im ersten Gang oder rückwärts zu fahren. Den Hebel ganz nach hinten zu ziehen, behält den Leerlauf bei, betätigt die Bremse und treibt zwei angespitzte Bolzen durch das Lenkrad tief in Ihre Handflächen hinein. Es liefe zumindest auf das Gleiche hinaus. Ach ja, und der andere in den Boden eingelassene Hebel, derjenige, an dem Sie sich beim Einsteigen die Nüsse angeditscht haben? Nun, der bedient die Ruckstell-Zweigang-Hinterachse. Fragen Sie nicht, was es damit auf sich hat, ich habe auch keine Ahnung. Hier steht irgendwas von einer »Untersetzungsstufe«.
Nun denn, Sie glauben, es wäre an der Zeit für eine angsteinflößend chaotische Probefahrt? Immer langsam mit den Pferden. Sie wissen ja noch nicht mal, wo das Gaspedal ist. Und Sie werden es auch nicht finden. Sehen Sie die beiden stummeligen Eisenstängel, die beiderseits der Lenksäule hervorstehen, direkt hinter dem Lenkrad? Mit dem rechten geben Sie Gas. Kein Scherz: Sie drücken ihn hinunter, um zu beschleunigen. Und der linke? Dumme Frage, der korrigiert oder hemmt gegebenenfalls die Zündung. Jeder, der weiß, wie Autos funktionieren, wird genau wissen, was das bedeutet. Wäre schön, wenn einer käme und es mir erklären würde.
»Zündung hoch, Gas runter!«
Meine erste Lektion darin, einen Model T zu starten, erhielt ich von James Dean. Jenseits von Eden, inszeniert nach John Steinbecks gleichnamigem Roman, spielte in der frühen T-Ära und enthielt umsichtig eine ganze Szene, die eben dieser Übung gewidmet war und in der Dean und eine Schar von Ensemble-Kollegen die oben genannte Phrase mit manischer Begeisterung skandieren. Da in den Anfangstagen des großen Hollywood-Kinos 15 Millionen Ford Ts vom Band rollten, war es keine Überraschung, sie in unzähligen Produktionen aus der damaligen Zeit auftauchen zu sehen, allerdings verschaffte mir eine entsprechende Sichtung des Materials vor meiner Abreise keinen weiteren praktischen Rat. Die traurige Wahrheit war, dass ein Model T immer nur auf die Leinwand gerollt zu werden schien, um Hohn und Spott über ihn auszugießen. In Es geschah in einer Nacht borgt sich derjunge Clark Gable einen Model T – einen 1924er Touring genau wie meiner – für eine dringende romantische Mission, nur um dann mit anzusehen, wie seine hoffnungslose Schrottmühle von fast jedem anderen Fahrzeug auf der Straße überholt wird. Traurige Posaunen allenthalben. Besagte Szene in Jenseits von Eden drehte sich um das lustige Gewese, das erforderlich war, um einen Model T überhaupt in Gang zu bringen: Nachdem der Zündhebel rauf- und der Gashebel runtergedrückt waren, verblieben nicht weniger als sieben Handlungsschritte, die Jimmy und seine Freunde auszuführen und zu skandieren hatten. Selbst Steinbeck, ein Autor, der sich üblicherweise mit Themen wie am Straßenrand verhungernden Großeltern und der Euthanasie an sanften Riesen mit Lernschwierigkeiten beschäftigte, konnte es sich nicht verkneifen, ein paar billige Lacher auf Kosten des Model T einzuheimsen. Der T besaß etwas – seine Omnipräsenz, seine Trägheit, seine seltsame Vermählung spartanischer Tugenden mit wahnsinnig machend komplexer Bedienung –, was dieses Auto zur unwiderstehlichen Zielscheibe für Hohn und Spott machte. Folgerichtig erwies sich der Model T als wiederkehrendes Requisit in den Slapstick-Werken von Fatty Arbuckle, Buster Keaton und, ganz besonders häufig, Laurel und Hardy. Ich habe mir vor meiner Reise viele davon angesehen. Nicht zuletzt lieferten sie einen nützlichen Leitfaden, welche Miene ich aufzusetzen hätte, sollte mein T mal zwischen zwei Straßenbahnwagen zerquetscht, in einer Sägemühle halbiert oder von einem bodenlosen, schlammgefüllten Schlagloch verschluckt werden.
Doch so hilfreich James Deans Mantra gewiss sein mochte – ich würde es vor meinen ersten paar hundert Startversuchen still anstimmen –, es würde allein nicht reichen. Ich bereitete mich auf eine Fahrt vor, die mehrere Monate in Anspruch nehmen würde, in einem Auto, das zu beherrschen, wie ich gewarnt worden war, ein ganzes Jahr erforderte. Und so tauchte ich wenige Wochen vor meiner Abreise ein in das Model-T-Netzwerk des Vereinigten Königreichs, dessen pulsierende Knotenpunkte hilfreicher Aktivitäten mich bald in Kontakt mit Ross Lilleker brachten, und vereinbarte zwei Probefahrten.
Die erste führte mich auf einen matschigen Bauernhof in Buckinghamshire, in Begleitung von Neil Tuckett, einem Tacheles redenden, altgedienten T-Experten mit grauen Locken, roten Wangen und einem Overall. Die zweite, auf im Abendrot gesprenkelten Alleen im tiefsten Kent, unternahm ich mit Deke Martin und seiner Frau Rachel, die mich in stilechter Garderobe begrüßten: sie mit Glockenhut und im Blümchenkleid, er in Weste und mit Peaky Blinders-Mütze. Abgesehen von dem Großmut, der sie beide auszeichnete, waren Deke und Neil sehr unterschiedliche Charaktere mit sehr unterschiedlichen Autos. Neils Model T (beziehungsweise derjenige, den er aus seiner umfangreichen Flotte für mich auswählte) war ein frühes Modell mit großen Kutschenlampen aus Messing und hölzernen Wagenrädern: zwei Teile Chitty, zwei Teile Bang. Dekes war einer der letzten Ford T, ein gedrungener, dunkelroter 1926er Touring mit Drahtspeichenfelgen.
Zusammen brachten es diese zwei Probefahrten auf vielleicht sechs Kilometer. Aber trotz ihrer Kürze und zahlreichen Kontraste hatten die beiden Erfahrungen viele übereinstimmende Eindrücke hinterlassen. Die scheppernde Explosion des Anlassens, ein einziges Zischen, Rasseln und laterales Beben. Das schmerzhafte Dreschen und Heulen, wenn das Planetengetriebe sich in seine Bänder aus Baumwolle verbiss und ich von der Startlinie ächzte, sogleich abgelöst vom Gefühl unkontrollierbar unsteter Geschwindigkeit. Halsbrecherische Kängurusprünge, gefolgt vom tödlichen Ruck des Abwürgens. Und die unausweichliche, schleichende Angst, dass irgendetwas jederzeit kaputt gehen könnte, hauptsächlich weil in beiden Fällen genau das passiert war. Neil verbrachte seine Zeit auf dem Beifahrersitz damit, beständig mit den ölverschmierten Fingerknöcheln gegen eine an die Spritzwand geschraubte Holzkiste zu klopfen, eine Tätigkeit, die manchmal die darin befindliche Zündspule in Habachtstellung brachte, uns aber auch zweimal stumm ausrollen ließ. Deke hielt während meiner kurzen Schicht am Steuer beständig die Ohren gespitzt und als ich rumpelnd in seinem Obstgarten zum Stillstand kam, sprang er mit einem Satz heraus, klappte die Motorhaube auf und fing an, etwas über verrutschte Bänder zu murmeln. Für eine Strecke von sechs Kilometern schienen das eine Menge Probleme zu sein, vor allem zu Beginn einer Reise, die 1.500-mal länger ausfallen würde.
Und so sprach ich drei Wochen später und einen Ozean entfernt ein stilles Gebet, drückte den silbernen Knopf und zerstörte Virginias Sonntagsruhe mit dröhnendem, spuckendem Geratter. Ein wenig experimentelles Herumspielen mit Gas- und Zündhebel verstärkte die Irrenhaus-Kakophonie zu einer donnernden Doppeldecker-Flugparade, dann, vermittels einer erschütternden Salve lärmender Fehlzündungen, dämpfte es sie zu einem unregelmäßigen Tuckern. Ich wuchtete den Bremshebel nach vorn und pflanzte meinen linken Fuß schwer auf die Kupplung, was die Luft mit protestierendem Klagen erfüllte, als der T die Auffahrt hinabrollte. Wie um alles in der Welt hielt diese uralte Maschine eine so wüste und schädliche Prozedur aus? Und wie sollte ich sie jemals zähmen? Ich drehte das Lenkrad nach rechts und eierte auf der falschen Seite der Straße in den Morgen davon.
Als eine Erzählung von Verzweiflung, Umbruch und spektakulärem Triumph über bittere Not ist die Geschichte von Henry Ford eine Geschichte über das junge, erwachsen werdende Amerika. Geknechtete Massen auf der Flucht – check. Trauer und Verlust – check. Zermürbende Mühsal, ein Übermaß an Kindern, tollkühnes Draufgängertum im beharrlichen Streben nach Glück – check, check, check. Angesichts seiner bescheidenen Herkunft und seines hart erarbeiteten Ruhms könnte man Ford mit Fug und Recht zum repräsentativsten Amerikaner aller Zeiten küren. Und in der Tat habe ich soeben beschlossen, genau dies zu tun.
Henrys irischer Vater William emigrierte im Alter von 21 Jahren aus Cork, in dem Jahr, das als »schwarzes 1847« traurige Berühmtheit erlangte, dem düsteren Höhepunkt der großen Hungersnot, die mehr als eine Million Opfer forderte und fast doppelt so viele Menschen zur Flucht zwang. Williams Mutter kam auf der Reise um, so dass er und sein Vater sich fortan um sechs jüngere Geschwister kümmern mussten. Sie ließen sich in Dearborn unweit von Detroit nieder, bauten eine Holzhütte und fanden eine Anstellung als Hilfsarbeiter beim Ausbau der Michigan Central Railroad. Von einem alten irischen Bekannten erstand die Familie schließlich dreißig Hektar Waldland, das sie mühsam rodete und kultivierte. 1861, drei Jahre nachdem William seinem Vater die Hälfte der Familienfarm abgekauft hatte, heiratete er Mary Litogot, die Adoptivtochter eines ebenfalls irischen Nachbarn. Mary war die Tochter belgischer Auswanderer, die beide in Dearborn gestorben waren, bevor sie drei Jahre alt war: ihre Mutter bei der Niederkunft und ihr Vater, als er ein Gespann Ochsen über den unzureichend zugefrorenen River Rouge führte.
Henry, das älteste Kind von William und Mary, kam 1863 zur Welt, drei Wochen nachdem der Bürgerkrieg mit der Schlacht bei Gettysburg sich zugunsten der Union wendete. Fords Farm begann inzwischen zu florieren. Dank der Nähe zu den Großen Seen und Kanadas gewaltigen natürlichen Ressourcen hatte sich Detroit bereits als Verkehrsknotenpunkt und aufstrebender Industriestandort etabliert, eine Stadt, deren wachsende Bevölkerung – 80.000 im Jahr 1870, davon fast die Hälfte im Ausland geboren – einen immer hungrigeren Markt für das Getreide, Fleisch und Obst der Familie Ford darstellte. Die Farm verdoppelte ihre Größe, weitere Kinder kamen hinzu, und William – inzwischen Friedensrichter und Diakon – baute das Familienheim zu einem Zehn-Zimmer-Bungalow aus, ziemlich stattlich für damalige Verhältnisse.
Wie seinerzeit die meisten Farmerskinder in seinem Alter schuftete Klein-Henry vor und nach der Schule viele Stunden in der Scheune und auf dem Feld. Der Sonntag begann mit einem 13-Kilometer-Marsch zur Kirche und zurück. So sehr er das Landleben Zeit seines Lebens schätzte, nährte diese Routine eine tief verwurzelte Abneigung gegen manuelle und fußläufige Pflichten und eine Fixierung auf deren mechanische Erfüllung. Seine zielstrebige Neugierde auf diesem Gebiet verschaffte ihm bald den Ruf eines tollkühnen Bastlers mit einer besonders eigenwilligen Faszination für die nutzbringende Zügelung von Energie. Eines Nachmittags im Sommer machte er sich daran, einen Bach zu stauen und umzuleiten, um ein kleines Wasserrad anzutreiben, und flutete damit unabsichtlich den Kartoffelacker eines Nachbarn. Um das Potenzial von Dampf zu erforschen, füllte er einen Tontopf mit Wasser, band den Deckel sorgfältig zu und platzierte ihn verstohlen im Kamin des familiären Esszimmers. Die resultierende Explosion zerschmetterte einen Spiegel und ein Fenster und hinterließ auf seiner Stirn eine Narbe, die ihn sein Leben lang zeichnen sollte. Ein späteres und ehrgeizigeres Experiment involvierte ein 40-Liter-Fass, eine selbstgebaute Blechturbine und eine ähnlich gelagerte Katastrophe, die den Zaun des Schulgebäudes niederbrannte und Henry einen weiteren Makel bescherte, diesmal auf der linken Wange, über dessen Herkunft er bis ans Ende seiner Tage spöttisch berichten würde. Mit Hilfe von Korsettstangen und Stricknadeln, die er von seiner nachsichtigen Mutter borgte, nahm er die Taschenuhren der Nachbarn auseinander und baute sie manchmal auch wieder erfolgreich zusammen. Er büßte fast einen Finger ein, als er das Heuschneidegerät seines Vaters unter die Lupe nahm. Und alldieweil hegte er einen tiefen Hass auf landwirtschaftliche Ineffizienz in all ihren Erscheinungsformen. Vor allem das Pferd war ihm ein Gräuel: kränklich, teuer, unzuverlässig, und jedes einzelne eine lebende Erinnerung an die Demütigung, die er einst erlitten hatte, als ein Fohlen ihn, einen Stiefel im Steigbügel verfangen, den ganzen Weg nach Hause hinter sich herschleifte.
»Außer Fressen haben Pferde und Esel nichts in ihren dummen Köpfen«, zeterte der junge Henry in einem Notizbuch, seinem Ärger darüber Luft machend, dass ein Viertel des gesamten Ackerlands in den USA dazu diente, die 25 Millionen Pferde der Nation durchzufüttern. »Und ein totes Pferd lässt sich nicht mit dem Schraubenschlüssel reparieren«, fügte er unverblümt hinzu. (Viele Jahre später, nachdem er eine Million Model Ts verkauft hatte, zückte er seine stets griffbereite Kladde und kritzelte hinein: »Das Pferd ist ERLEDIGT!«)
Aber dieser heimelige, glücklose, pferdehassende Himmel wurde 1876 auf den Kopf gestellt. Zwölf Tage nachdem sie ein totgeborenes Baby zur Welt brachte, das ihr siebtes Kind gewesen wäre, starb Mary. »Ich hegte nie besondere Zuneigung zur Farm als solcher«, erinnerte sich Henry. »Es war die Mutter auf der Farm, die ich liebte.« Doch einen Monat später hatte der dreizehnjährige Henry eine Erscheinung, die eine dauerhafte Ablenkung von seinem Kummer brachte und schließlich die Welt verändern würde. Neben seinem Vater auf der Familienkutsche sitzend, wurde Henry eines klappernden, schnaufenden Radaus gewahr, der sich ein Stück weiter abspielte, und sprang hinab, um der Sache auf den Grund zu gehen. Die Quelle des Tumults war eine dampfbetriebene Lokomobile von Nichols & Shepard, das erste pferdelose Fahrzeug, das er je zu Gesicht bekommen hatte. (Damals waren im »Maisgürtel«, dem Mittleren Westen der USA, mehr als 75.000 dampfbetriebene Dresch- und Erntemaschinen im Einsatz.) Henry schaute ehrfürchtig zu der Maschine auf, dann bombardierte er den Führer mit technischen Fragen. »Diese Begegnung zeigte mir, dass ich vom Instinkt her Ingenieur war«, erinnerte er sich drei Jahrzehnte später recht fade. Als er jedoch dort inmitten des Lärms und der rußigen Schwaden stand, war sein junger Geist erfüllt von den überwältigenden Möglichkeiten eigenständiger, selbstbetriebener Beförderung. Fortan war Henry Ford ein besessener junger Mann. Für den Rest seines Lebens verwahrte er die Fotografie einer dampfbetriebenen Lokomobile an prominenter Stelle, »wo ich sie jeden Tag sehen konnte«.
An diesem Punkt legen wir besser den Finger auf die Vorspultaste und halten ihn dort, schauen zu, wie unscharfe sepiafarbene Gestalten in unterhaltsamer Hast hin und her huschen. Saus, da haben wir den 16-jährigen Henry, der nach Detroit abhaut, um in einer Tramwagenfabrik zu arbeiten. Dann in einer Werft. Dann als Maschinenschlosser-Lehrling. Drei Jahre vergehen und er wetzt wieder heim, wo er für benachbarte Farmer Lokomobile bedient und repariert. Schauen Sie, hier heiratet er Clara Bryant und sie leben auf einer Farm, die sein Dad ihnen überlassen hat. Was hat er vor? Sieht nicht nach Landwirtschaft aus. Nö, er benutzt eine Dampfmaschine, um Holz zu spalten. Zwei Jahre lang. Und jetzt – hui! – flitzt er wieder los, zieht mit Clara nach Detroit, wo er einen Job als Ingenieur bei der Edison Illuminating Company ergattert hat. Plopp! Ihr einziges Kind, Edsel, kommt im November 1893 im neuen Heim der Familie zur Welt. Bumm! Einen Monat später, an Heiligabend, bastelt unser Mann in der Küchenspüle einen kleinen Benzinmotor zusammen, wobei Clara den Brennstoff einträufelt, während Henry – ernsthaft, Alter? – ein Kabel von der Dose der Deckenlampe zur Zündkerze hält. Drei Jahre später stempelt Henry immer noch bei Edison, ist aber auch bis spät in die Nacht in seinem Holzschuppen zugange. Was er da treibt? Och, er baut nur ein Auto. Das sich allerdings – geht’s noch, Hank? – als zu groß erweist, um durch die Schuppentür zu passen, also reißt er kurzerhand die halbe Wand ein, um gegen vier Uhr in der Früh sein benzinbetriebenes Quadricycle auf Jungfernfahrt durch das verschlafene Detroit zu nehmen. Hmmm, sieht ziemlich kacke aus, das Teil, wie ein übergroßer Kinderwagen, der mit einem Kanalbootruder gesteuert wird. Dennoch erregt das Gefährt bald Aufmerksamkeit, und schauen Sie mal, hier wuselt er auch schon mit einem schicken neuen Mantel und einem stattlichen Schnauzbart herum, versteht sich prächtig mit Thomas Edison, dem Bürgermeister von Detroit und einem Haufen anderer einflussreicher Bonzen und Industrieller. Wir schreiben das Jahr 1899 und Henry hat das Elektrizitäts-Unternehmen verlassen, um die neue Detroit Automobile Company zu leiten. Aber seine Geldgeber sind nur auf eine schnelle Mark aus, und wenn wir die Handlung verlangsamen, sehen wir, wie sie die Geduld verlieren mit Henrys Vision eines perfekt ausgereiften Autos, das sich an einen Massenmarkt richtet, der nicht existiert. Binnen zwei Jahren macht der Laden dicht. Henry geht auf die 40 zu und hat bis dahin 23 Autos gebaut. Drücken wir auf Pause, gerade als er sich seinen Schnauzbart abrasiert.
Am hektischen Beginn des Automobilzeitalters hatte es Henry mit der Konkurrenz von 2.500 Neugründungen in den USA zu tun, und in den Hinterhöfen von Detroit tummelten sich mehr Autobauer als in jeder anderen Stadt. Wären die Karten anders gefallen, würden wir heute möglicherweise in Kerosene Surreys oder American Beauties, in Juveniles, Gaylords oder Cuckmobiles herumgondeln. Wie ein wegweisender, aber nicht ganz so nervtötender Richard Branson entschied Henry, dass eine große Geste nötig wäre, um sich und seine Autos von der Masse abzuheben, eine tollkühne Publicity-Aktion. Und so meldete er sich, einmal mehr jenes jugendliche Draufgängertum aufbietend, das ihn fürs Leben gezeichnet und halb Dearborn in Schutt und Asche gelegt hatte, im Herbst 1901 für das erste Autorennen an, das je in Michigan stattgefunden hatte.
Ford war inzwischen nicht mehr der Jüngste und das einzige Fahrzeug, das er mit einer gewissen Regelmäßigkeit gesteuert hatte, war das klapprige Quadricycle, das es in der Spitze auf 35 km/h brachte. Er hatte nur einen einzigen Konkurrenten um das Preisgeld von 1.000 Dollar, aber das war Alexander Winton, der steinreiche Eigner des größten Herstellers benzinbetriebener Autos in den USA und ganz nebenbei auch der berühmteste Rennfahrer der Nation. Dass Henry Ford die Herausforderung annahm, war ein eindringliches Statement, das von seiner Unnachgiebigkeit und seinem grenzenlosen Ehrgeiz kündete – und aus Claras Sicht außerdem ein starrsinnig verantwortungsloses.
Das Rennen, ausgetragen am 10. Oktober in Grosse Pointe, löste in der aufstrebenden »Motor City« große Begeisterung aus. Geschäfte blieben an diesem Tag geschlossen. Gerichte vertagten sich. 8.000 Zuschauer pilgerten zur Rennstrecke, in vollgepackten Straßenbahnen, die alle halbe Minute vom Stadtzentrum aus losfuhren. Doch als die beiden Konkurrenten zur Startlinie rollten, waren die Zuschauer bestürzt angesichts des ungleichen Wettkampfs, der ihnen offenbar bevorstand. Neben Wintons mächtigem, 70 PS starkem Bullet nahm sich Fords gebrechlich anmutender Sweepstakes mit seinem 26-PS-Motor, den Henry mit seinem jungen Kompagnon Ed Huff gebaut hatte, wie eine recht kümmerliche Maschine aus. Huff, ein autodidaktischer Elektroingenieur, der mit Ford arbeitete, seit er 16 war, hatte Sweepstakes mit einem revolutionären Einspritzsystem ausgestattet, für das er Porzellan-Isolatoren verwendete – faktisch die erste moderne Zündkerze –, die ein ansässiger Zahnarzt auf Bestellung aus Keramik angefertigt hatte. Nun aber leistete er einen noch bemerkenswerteren Beitrag: Um an der Zündvorrichtung unterwegs Justierungen vornehmen zu können, verbrachte er das ganze Rennen auf dem Trittbrett. Mit der beherzten und geschickten Anhänglichkeit, die er an diesem Nachmittag unter Beweis stellte, verdiente er sich den Spitznamen, der ihn Zeit seines Lebens begleiten sollte: Spider – die Spinne.
Als die Flagge gesenkt wurde, überraschte es niemanden, dass Bullet sofort einen imposanten Vorsprung herausfuhr. Unbeschwert von relevanter Erfahrung hatte Ford Mühe, seinen Wagen bei hundert km/h in den Kurven zu kontrollieren, was Huff zwang, seine Basteleien an der frischen Luft um dramatische Verlagerungen des Körpergewichts zu ergänzen. Doch nach fünf Runden begann das leichtere Auto die Lücke zu schließen und als Bullet in Runde acht unter Spucken und Stottern überhitzte, zog Sweepstakes vorbei. Als die labile Kombo über die Ziellinie rollte, breitete sich unter den Zuschauern so etwas wie eine Massenhysterie aus. »Die Leute drehten durch«, schrieb Clara erleichtert, aber auch erschrocken an ihren Bruder. »Ein Mann warf seinen Hut in die Höhe und als er herunterfiel, trampelte er darauf herum. Ein anderer Mann musste seine Frau auf den Kopf schlagen, damit sie nicht außer Rand und Band geriet.«
Dem Sieger die Beute. Alexander Winton, der erste Mann, der ein Lenkrad an einem Auto anbrachte, Erbauer des ersten V8-Motors und des ersten präsidialen Motorwagens, ist nicht mehr als eine Fußnote der Automobilgeschichte. Aber mit seinem denkwürdigen Triumph in seinem ersten und letzten Autorennen machte sich Henry Ford einen Namen und die Autos, die diesen Namen tragen würden, weithin bekannt. Mit Geschwindigkeit verkaufte man Autos an die wenigen Reichen, aber bei den Massen im mittleren Marktsegment besaß die »Hase und Schildkröte«- Zuverlässigkeit, mit der sich Sweepstakes durchgesetzt hatte, deutlich mehr Zugkraft. (Nur so aus Jux und Dollerei würde Henry die Nerven seiner Gattin noch ein letztes Mal strapazieren, als er, im Alter von 41 Jahren, vor den Toren Detroits auf dem zugefrorenen Lake St. Clair einen Landgeschwindigkeitsrekord von 147,05 km/h aufstellte.) »Es ist nicht uninteressant«, bemerkte recht trocken eine Zeitungsannonce, »dass der Erbauer und Fahrer dieses Wagens außerdem der Konstrukteur und Erbauer des regulären Ford Runabout ist.« Die Öffentlichkeit blieb sieben Jahre, ein weiteres gescheitertes Unternehmen und neun Modelle von nur langsam steigender Attraktivität bei der Stange, bis Henry Ford und sein Team – allen voran Ed »Spider« Huff – schließlich das selbsternannte »universelle Automobil« vorstellten, das die Welt verändern sollte: den Ford Model T.