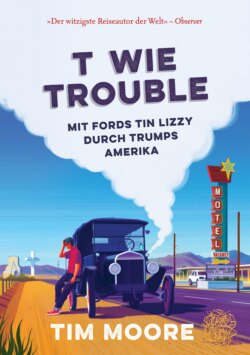Читать книгу T wie Trouble - Tim Moore - Страница 8
ОглавлениеKAPITEL 4
Das Auto, das am 27. September 1908 im Werk der Ford Motor Company an der Piquette Avenue in Detroit vom Band rollte, sah nicht gerade nach Kassenschlager aus. Mit seinen hohen Kotflügeln, den dicken Speichen der Wagenräder und den gedrungenen, kastenartigen Proportionen mutete es eher wie ein Rückschritt in das Zeitalter der Pferdekutsche an. Das Gleiche galt für den Karosseriebau: über ein Gerippe aus Hartholz gebogene Metallbleche. Der Rolls-Royce Silver Ghost, der ein Jahr zuvor vorgestellt worden war, war ungleich repräsentativer für den Automobilmarkt der damaligen Zeit: ein schnittiges Reiche-Leute-Spielzeug, das wie Samt über die glatten Straßen der europäischen Städte rollte.
Doch Ford setzte seine Hoffnungen auf die boomende amerikanische Mittelschicht, vor allem auf die Farmer, die es mit der Versorgung der wachsenden Bevölkerung der Nation zu Wohlstand gebracht hatten: Von 1900 bis 1910 schoss der Preisindex für Agrarprodukte um beispiellose 52 Prozent in die Höhe. Kein anderer Autohersteller schien zu wissen oder sich darum zu scheren, dass die meisten Amerikaner in Kleinstädten oder auf den sechs Millionen Farmen des Landes lebten. Da er selbst auf einer aufgewachsen war, wusste Henry hingegen sehr genau um die Prioritäten dieser Bevölkerungsgruppe: Robust, simpel, praktisch musste es sein. Die amerikanischen Straßen galten damals mit als die schlechtesten der Welt, die Räder des Model T waren daher so ausgelegt, dass sie sich in die Spurrillen der Fuhrwerke einfügten, und das hoch über dem Boden befindliche Chassis war dazu konstruiert, auch über extravagante Unebenheiten hinwegzufedern und -zusetzen. Klein und leicht, wie er war, konnte der T sich aus lockerstem Sand und dickstem Schlamm befreien. Seine Reichweite von rund 300 Kilometern übertraf das gesamte Netz asphaltierter Straßen der Nation um 80 Kilometer. Der Model T würde mutig dorthin gehen, wo nie ein Auto zuvor gewesen war. Und das für nur 825 Dollar, viel weniger als jegliches Konkurrenzangebot und – noch wichtiger für sein vorgesehenes Marktsegment – um die 150 Dollar billiger als ein Pferdegespann.
Henry war in höchstem Maße überzeugt von seinem »universellen Automobil«: Auf einer 2.000 Kilometer langen Testfahrt rund um die Großen Seen widerfuhr ihm nichts Schlimmeres als ein Platten. Aber weil zuvor noch niemand versucht hatte, viele Autos an viele Menschen zu verkaufen – nur zwei Prozent der Familien auf dem Lande besaßen eins –, hatte er keine Ahnung, wie sein nützliches Angebot beim Publikum ankommen würde, bis am 2. Oktober, einem Freitag, die ersten Zeitungsannoncen veröffentlicht wurden. »Kein Auto unter 2.000 Dollar bietet mehr«, schmeichelte der Text, »und kein Auto über 2.000 Dollar bietet mehr außer Schnickschnack.« Für Henry Ford, inzwischen 45 Jahre alt, war es die letzte Chance auf den großen Wurf.
Er musste nicht lange warten. »Mit der Samstags-Post«, erinnerte sich die Ford Times viele Jahre später »kamen fast eintausend Anfragen. Bereits am Montag versanken unsere Sekretäre in Post, und Dienstagabend war das Büro geradezu überschwemmt.« Kein anderes Auto hatte sich bis dahin mehr als 7.000 Mal verkauft. Der Model T erreichte die doppelte Zahl noch bevor er überhaupt in Produktion ging. Ein Händler in Pennsylvania schwärmte: »Es ist ohne Zweifel die großartigste Schöpfung im Automobilbereich, die einem Volk je dargereicht wurde.«
Im Mai 1909 sah sich das überforderte Unternehmen gezwungen, zwei Monate lang keine neuen Bestellungen anzunehmen. Binnen eines Jahres war Ford den Räumen in der Piquette Avenue entwachsen und zog um in ein neu errichtetes Werk in Highland Park. »Es war das richtige Auto zur richtigen Zeit und zum richtigen Preis«, sagte Philip Van Doren Stern, der die Erzählung schrieb, auf der Ist das Leben nicht schön basiert, und somit als glaubwürdige Autorität für Kleinstadt-Wunder gelten dürfte. Und der Preis wurde immer richtiger. 1911 verkaufte Ford 35.000 Model Ts und Henry senkte den Verkaufspreis auf 680 Dollar. Zwei Jahre später setzte er 170.000 zu je 525 Dollar ab – ein paar Dollar weniger als das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Amerikaners.
In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts fristete eine typische amerikanische Farmersfamilie nach herkömmlichen menschlichen Maßstäben ein ziemlich undankbares, wenn nicht gar rundheraus beschissenes Dasein: um vier Uhr morgens aufstehen, nach einer Nacht in einem unbeheizten Raum, und mit der Aussicht auf nichts weiter als ein Abendessen und Schlaf, wenn ein weiterer harter Tag überstanden wäre. Während Fords provinzielle Kunden sich also einredeten, einen Model T zu kaufen, um damit Getreidesäcke oder eine Rolle Stacheldraht zu transportieren, hatten sie sich in Wirklichkeit von den atemlosen, Horizont erweiternden Möglichkeiten verführen lassen, die diese Anschaffung versprach: ein Abstecher aufs Land zum Picknicken oder über die Hügel, um die Schwiegereltern zu besuchen, ein Tagesausflug zum Jahrmarkt mit heruntergeklapptem Verdeck auf offenen Straßen, einfach fahren um des reinen Fahrvergnügens willen. Aufregender Kitzel für Farmer, die sich sonst nie mehr als 15 Kilometer von zu Hause entfernten. Sehnsüchte befriedigen, von denen sie nicht einmal ahnten, dass sie sie hatten. Geschwindigkeit und Freiheit. Aus der fürchterlichen Isolation des ländlichen Lebens ausbrechen. Mit Leuten abhängen, die man tatsächlich mochte, statt mit welchen, die zufällig in der Nähe wohnten.
Norval Hawkins, Fords wegweisender Verkaufsleiter, begriff das alles. »Man verkauft keine Waren«, bemerkte er vorausschauend, »sondern Vorstellungen von Waren.« Seine Werbefeldzüge zielten auf Emotionen ab und zeigten stolze, einsame Model Ts über Slogans wie »Herr der Straße« oder »Gehorche dem Impuls«. Es gab frühe Versuche mit automobilem Sex-Appeal: Eine Anzeige zeigte einen jungen Burschen und zwei Mädels auf dem Rücksitz eines Model T, dazu die Zeile: »Sehen Sie sich das Bild an und entscheiden Sie selbst.« Henry Ford hegte ein eher nüchternes Verständnis von Marketing, glaubte aber dennoch, seine Kunden besser zu kennen als sie sich selbst. »Hätte ich die Leute gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt: ein schnelleres Pferd.«
Das Planetengetriebe, eine ernsthafte Abschreckung für diejenigen unter uns, die bereits Erfahrungen im Umgang mit Schalthebeln besitzen und sich erst in einem schmerzhaften Prozess von allen vertrauten Routinen lösen müssen, konnte von Bauern, die nie zuvor gefahren waren, rasch erlernt werden. Zudem war der Model T so konzipiert, dass er ihren Hinterwäldler-Basteltrieb ansprach: ein Auto, das von jedem Farmer mit Bindedraht und einem Hammer am Straßenrand repariert werden konnte. Als ein Indikator dafür, welchen Erfolg Henry unter der Landbevölkerung genoss, darf die Tatsache gelten, dass die Zahl der Automobilbesitzer in Iowa bis 1910 sechs Mal höher war als in New York City. Und fast jedes Auto in Iowa war seinerzeit ein Model T. In jenem Jahr stimmte das US-Landwirtschaftsministerium einen Lobgesang auf die Befreiung des ländlichen Amerikas durch den Model T an, der in der Feststellung gipfelte: »Nie zuvor haben so weite Teile der Einwohner eines Landes den erhebenden Geist gekannt, den freie Ausübung von Kraft und Unabhängigkeit bringen kann.«
1912 beschäftige Ford mehr Verkäufer als jedes andere US-Unternehmen. Der Konzern hatte 3.500 Händler im ganzen Land, und jeder von ihnen hatte jede einzelne der 5.000 Komponenten des Model T vorrätig zu haben. Eine beispiellose Reklame-Manie griff um sich, als Ford-Händler sich gegenseitig darin zu übertreffen versuchten, die erstaunlichen Möglichkeiten des Autos zu demonstrieren. Händler fuhren Ts zu Werbezwecken die Treppen des YMCA in Columbus, Nebraska, hinauf oder eine Treppe am Alamo Square in San Francisco hinunter oder gleich zwei Stockwerke rauf in den Flur eines Gerichtsgebäudes in Kentucky. Sie fuhren sie bis unters Dach beladen durch die Straßen: fünfzig Jungen in einem, drei Fässer Tabak in einem anderen, im nächsten eine ganze Abschlussklasse oder das Baseball-Team der St. Louis Browns. Ein Händler in Houston ließ seinen Wagen sechs Tage und Nächte lang mit 15 km/h laufen, ohne einmal den Motor abzustellen. Ein anderer, der beide Arme verloren hatte, zog eine Schau ab, bei der er die Anlasskurbel mit den Füßen bediente.
T-Besitzer waren nicht weniger erpicht darauf, die Möglichkeiten zu erforschen. Farmer nutzten ihre Autos als bewegliche Energiequellen zum Schälen von Getreide, zum Brettersägen und Wasserpumpen. Sie wurden an die Veranda herangefahren zum Buttern und Waschen. Prediger brachten am Heck einen Verschlag samt Schindelturm an und hatten eine mobile Kapelle. Zubehörhersteller bedienten den Sekundärmarkt und boten eine Vielzahl an Geräten und Vorrichtungen feil: Heizkörper, »Anti-Rüttel«-Vibrationsdämpfer, zigarrenförmige Sportwagen-Karosserien.
So richtig Fahrt auf nahm das Model-T-Phänomen im Jahr 1913, nachdem Ford und sein Team in Highland Park das erste Fließband vorstellten. Henry war weniger ein Erfinder als ein herausragender Innovator: Er konzentrierte sich darauf, bereits vorhandene Produkte und Methoden zu erweitern und zu verfeinern, sein Erfolgsgeheimnis war eine Zusammenführung entlehnter Techniken. Wichtigste Inspiration waren die Schlachthäuser von Chicago, wo Fleischarbeiter an einem über ihren Köpfen verlaufenden »Zerlegeband« die geschlachteten Tiere zerhackten. Ford kehrte dieses System einfach um, überzeugt davon, dass die Wiederholung einfacher manueller Aufgaben an einem Fließband wesentlich effizienter wäre als das herkömmliche Herstellungsverfahren, bei dem Teams von Facharbeitern an statischen Montagestationen Komponenten zusammenbauten.
Aber ebenso wie er es mit der Vorstellung des Model T getan hatte, wagte Henry auch hiermit einen kühnen Sprung ins Dunkel. Er baute Highland Park zur größten Fabrik der Welt aus, wo 14.000 Angestellte an Fließbändern und Hängekränen arbeiteten, die Autoteile bei gleichbleibendem Tempo von zwei Metern pro Minute in 300 Meter langen Produktionsstraßen an ihnen vorbeibeförderten. So etwas hatte man noch nie zuvor gewesen. »Wundervoll, wundervoll«, kreischte Präsident Taft nach einem Rundgang durch die neue Anlage. »Ich bin begeistert von der Größenordnung der Einrichtung und kann jetzt noch das Dröhnen der Maschinen hören!« »Das Ford-Werk ist ein Wunder«, schrieb einer der vielen nach Luft schnappenden Journalisten, die Highland Park einen Besuch abstatteten. »Hunderte von Teilen, in unfassbarem Tempo in gewaltigen Mengen hergestellt, fließen einem Punkt zu. Die Endfertigung ist die wundersamste Sache von allen.«
Tja, Henry hatte wieder mal recht behalten. Die Zeit für die Produktion eines Model T sank von dreizehn Stunden auf 93 Minuten und bald rollte in Highland Park alle elf Sekunden ein fertiges Auto vom Band. 1916 verkaufte Ford 500.000 Ts und senkte den Preis auf 345 Dollar. »Wie die biblische Geschichte vom Brot und den Fischen«, schrieb Fords Biograf Steven Watts. »Ford schien durch einen übernatürlichen Prozess die materielle Versorgung von Tausenden von Menschen zu schaffen. Seine Mitbürger reagierten mit einer Art kultischer Verehrung.« Erst jetzt prägte Henry die berühmteste Maxime des Model T. Vor 1915 hatten die Autos das Werk in den Farben Grün, Blau, Rot oder Grau verlassen, aber Schwarz war billiger und langlebiger, und angesichts einer beinahen Monopolstellung am Markt fühlte er sich ermutigt, es zur alternativlosen Wahl zu machen. 1917 stellte Ford sämtliche Reklame für das Auto ein und fing erst sieben Jahre später wieder damit an. Es war schlicht und ergreifend witzlos – dieser Wagen verkaufte sich eh von selbst. Inzwischen wurde er nicht einmal mehr vom Hersteller als »Model T« bezeichnet. Er war nun einfach »das Ford-Auto«.
Der allgegenwärtige T, ein nationales Heiligtum noch vor seinem zehnten Geburtstag, eroberte sich bald einen festen Platz in der Populärkultur. Zwangsläufig wurden Spitznamen ersonnen, zwei davon blieben haften. »Flivver«, eine umgangssprachliche Bezeichnung für billige und lustige Maschinen aller Art, war schon 1910 weit verbreitet. Niemand weiß genau, wo der Kosename »Tin Lizzy«, aus dem im Deutschen die »Blechliesel« wurde, seinen Ursprung hatte, doch das New Dictionary of American Slang wartet mit einer Herleitung auf, die heutzutage einen bitteren Beigeschmack hat: »Robust, verlässlich und schwarz wie die traditionelle, idealisierte Dienstmagd des Südens, Elizabeth genannt.« Es gab Dutzende Ford-Witzebücher und Tausende scherzhafte Postkarten, die sich mit sanftem Spott über die blecherne Klapprigkeit des kleinen Autos lustig machten oder seinen beherzten Schneid priesen. Henrys Lieblingswitz, wie er gegenüber dem Denver Express verriet, als er die Stadt 1915 besuchte, handelte von einem alten Mann, der mit seinem Ford begraben werden wollte, »denn das verfluchte Ding hat mich noch aus jedem Loch rausgeholt, in das ich geraten bin«.
In Varietés erklangen humoristische Knittelverse: »Meine Liebste hing überm Benzintank und warf hinein einen Blick, ich entzündete helfend ein Streichholz, oh, bringt mir die Liebste zurück.« Amerikas früheste Auto-Fummeleien wurden in einem populären Liedchen namens »Auf der guten alten Rückbank von Henry Ford« besungen. Am anderen Ende des kulturellen Spektrums schrieb der Avantgarde-Komponist Frederick Shepherd eine vierzehnminütige Fantasie mit dem Titel Flivver Ten Million, komponiert für echte Autohupen und mit Quietschen, Klappern und einer gewaltigen Kollision, die von der Kritik positiv aufgenommen und von mehreren namhaften Orchestern aufgeführt wurde. Das alles war gute Publicity. Ford störte sich auch nicht daran, dass Kaliber wie Laurel und Hardy sich auf der Leinwand wieder und wieder an seinen geliebten Maschinen vergingen, denn der Witz gründete darauf, dass diese plattgewalzten, halbierten und versenkten Ts weiterhin beharrlich ihren Dienst verrichteten.
Im Krieg ging Henrys universelles Automobil dann auf Weltreise, als 125.000 Ford Ts der Sache der Alliierten dienten und der schwereren europäischen Konkurrenz auf matschigen, zerschossenen Schlachtfeldern auf beeindruckende Weise den Schneid abkauften. Bald wurden Werke in Frankreich, Dänemark, Argentinien, Spanien, Uruguay, Italien, Belgien, Südafrika, Mexiko, Deutschland, Indien und auf der malaiischen Halbinsel eröffnet. Rund
300.000 Model Ts wurden im Ford-Werk in Manchester gefertigt und mehr als 750.000 von Ford Canada. Im Jahr 1921, als Ford eine Million Stück zu 325 Dollar das Stück absetzte, waren fast zwei Drittel der Autos, die es in Amerika gab, Model Ts. So wie auch die Hälfte der Autos weltweit. Und sie alle waren durch die Bank schwarz.
Den Gipfel ihrer Popularität erreichte die Blechliesel im Jahr 1924, als Ford zwei Millionen Model Ts zum Preis von je 260 Dollar das Stück baute und verkaufte. Danach ging es nur noch bergab. Doch es war ein ziemlich hoher Berg gewesen. Als die Produktion am 26. Mai 1927 eingestellt wurde, waren in 19 Jahren mehr als 15 Millionen Ford Ts hergestellt worden. Der VW Käfer brauchte fast doppelt so lange, um diese Marke einzustellen, und kein anderes Auto danach kam auch nur annähernd heran.
***
»Sie verfügen über mehr Geschwindigkeit, als Sie auf durchschnittlichen Straßen oder sogar auf allerbesten Straßen außer unter hervorragenden Bedingungen gefahrlos nutzen können, und sehr viel mehr, als Sie zu nutzen versuchen sollten, bis Sie sich mit Ihrer Maschine vollständig vertraut gemacht haben und die Bedienung von Bremse und Hebeln praktisch wie von selbst gelingt.« So lautete ein Abschnitt aus dem Benutzerhandbuch des 1909er Model T, überschrieben mit »Gehen Sie es langsam an« und gerichtet an einen Fahranfänger. Es ist eine spannende Einsicht in die Beschränkungen des frühen Automobilzeitalters, als ein Wagen mit einer Höchstgeschwindigkeit von rund 63 km/h als eine echte Gefahr erachtet werden konnte, wenn er in falsche Hände geriet.
Ich hatte zwei solcher Hände und dazu ein Paar ebensolcher Füße, die alle weit davon entfernt waren, irgendetwas wie von selbst zu bedienen. Andererseits fuhr ich auf Straßen, die besser waren als die allerbesten, die 1909 zu finden waren. Bis 1920 wurde jedes Jahr eine Milliarde Dollar in neue und verbesserte Straßen investiert und die Geschwindigkeiten wurden immer höher. Auf meinem Weg in nordwestlicher Richtung durch Virginia rollte ich geschmeidig dahin auf breitem, verwaistem Asphalt, vorbei an Briefkästen mit fünfstelligen Hausnummern, an Landplagen gelber Schulbusse, die über den Sommer abgestellt waren, an Gründerväter-Siedlungen mit Namen wie Gloucester, Essex, Port Royal. Zuversicht legte mir ihre besänftigende Hand auf die Schulter, dann begann sie verstohlen am Gashebel zu ziehen. Das GPS zeigte 63 km/h. Der T pendelte sich in einem surrenden Wohlfühlrhythmus ein. Ich entkrümmte mich ein klein wenig, entspannte mich, so gut es die Holzkugeln gestatteten, und ließ die warme, grüne Welt durch die geteilte Frontscheibe auf mich zukommen, während der geflügelte Motometer auf meinem Bug wie eine Kühlerfigur gleichmäßig auf und ab hüpfte. Das war schon besser. Das war schon viel besser.
Und so verfiel ich, für einige heiße und berauschende Tage, in so etwas wie eine Routine. Ich stand früh auf, um der Hitze zu entgehen, schüttete eine Flasche Öl nach, dann tuckerte und rumpelte ich nach Nordwesten in die ungefähre Richtung von Detroit, indem ich mich an den rötesten Flecken auf meiner Karte orientierte. Ich drang in die wohlhabenden Außenposten des Pick-up-Landes vor, vorbei an schmucken holzverschalten Farmhäusern mit ein paar dekorativen Weinstöcken davor und an Golfplätzen, die zwischen von der Sonne geküssten Maisfeldern angelegt waren. Die Straße begann sich durch Hügel zu winden und zu ziehen, die von Hickory, Eichen und Zuckerahorn bestanden waren. Es war eine Idylle, die nur von überreifen Kadavern beeinträchtigt wurde, die auf den ländlichen Asphalt gekleistert waren und Schwaden berauschender Verwesung in meine offene Kabine trugen: Waschbären, Hirsche, Füchse, Eichhörnchen, fette Opossums, das Fragezeichen einer platten schwarzen Schlange. Und diese armen kleinen Stinktiere mit ihren puscheligen Iros, deren Dünste mir schon aus einer Meile Entfernung in die Nase stiegen.
Ich füllte Benzintank und Magen an Tankstellen wieder auf, plauderte mit den ziellosen Sheriffs, die sich dort ständig zu versammeln schienen. Ziemlich häufig schlurfte ein freundlicher Senior heran und lehnte sich in die Kabine des T hinein. »Habe in so einem das Fahren gelernt«, sagte einer mit heiserem Kichern. »Das da ist die Bremse, das der Rückwärtsgang, und das da schießt dich direkt durchs Scheunentor.« Bei fast jedem dieser frühen Boxenstopps manifestierte sich irgendein drastisches Wartungsproblem. Ich prüfte den Reifendruck und stellte fest, dass er 70 Prozent unter den von Ross empfohlenen Werten lag, oder entdeckte, dass sich die Hälfte der Radmuttern gelockert hatte, oder vernahm ein schwaches Klirren, wenn ich die Tür zuwarf, stieg aus und entdeckte eine große rätselhafte Schraube auf dem Asphalt. Es war eine Art Funktionstest: Nach Jahrzehnten unbeständigen Rentner-Herumtuckerns wurde mein untadeliges altes Auto von den Härten dauerhaften Gebrauchs entzweigerüttelt.
Und ich stürzte mich wacker in den ersten ernsthaften Verkehr, gefangen in einem Netz miteinander rangelnder Spuren, wenn ich größere Ortschaften passierte. Da ich nicht wagte, einen Schulterblick durch die winzige Rückscheibe zu werfen, beschränkten sich meine Kenntnisse des rückwärtigen Geschehens auf das, was der ratternde und ruckelnde Seitenspiegel preisgab. Es war wie Toms Sicht der Welt, nachdem Jerry ihm mit der Bratpfanne eins übergezogen hat. War das nur ein Truck, der hinter mir herandampfte, oder deren sechs? Draußen auf offener Strecke war das kaum von Belang: Was auch immer sich von hinten einem Model T nähert, zieht schon bald vorbei. Mitten im Stadtverkehr aber war die Ungewissheit zutiefst beunruhigend, allen voran die unbemerkt Überholenden, die plötzlich aus meinem toten Winkel herausschossen. Ich wich behutsam, mich für einen Aufprall wappnend, auf die Kriechspur aus, die dann von einem parkenden Wohnmobil versperrt war oder zu einer Rechtsabbiegerspur wurde oder aber sich einfach im Nichts auflöste. Der Stress verschlimmerte sich noch durch die Parade roter Ampeln, mit denen Amerikas Ringstraßen reich bestückt sind: Es sollte mehr als 1.500 Kilometer dauern, bevor mir erstmals das verachtete Symbol des europäischen Gängelverkehrssozialismus begegnete, der Kreisverkehr.
Ein früher Autofahrer bezeichnete die Betätigung des Bremssystems des Ford T sehr treffend als »eher ein Ritual als eine funktionelle Tätigkeit«. In meinem Fall bestand sie aus einer unter keinem guten Stern stehenden Verknüpfung aus Untauglichkeit und eigensinniger Unbeständigkeit, die, wenn in extremis angewendet, den Wagen mit blockierten Hinterrädern und nur minimaler Drosselung der Geschwindigkeit hilflos über die Fahrbahn schleudern ließ. »Gute Bremsen ermuntern zu schlechtem Fahren«, sagte Herbert Austin, der britische Henry Ford, ein Mann, der ungerechterweise an einer Lungenentzündung verstarb.
Wenn vor mir eine Ampel von Grün auf Gelb sprang, musste ich eine schnelle Entscheidung treffen: in die Eisen gehen und riskieren, seitwärts in die Mitte der Kreuzung zu schlittern, oder Vollgas geben und mit einer Salve warnender Ahugas über Rot heizen. Und das alles, während ich gleichzeitig versuchte, in gleicher Weise das aufmunternde Winken zu erwidern, all die gegrölten und zunehmend vertrauten Fragen zu beantworten, die mir von Fenster zu Fenster gestellt wurden (»Netter Schlitten – welches Jahr?«), und mir ein Lächeln für die Fotohandys abzuringen. Wie schrecklich nah manche Überholende auf der Jagd nach dem optimalen Schnappschuss herankamen. Doch wie erschreckend es auch war, konnte ich ihnen ihre Sorglosigkeit kaum verübeln. Von all den Gedanken, die sich einem beim Überholen eines extrem alten Autos anbieten mochten – ach, wie süß; was für ein entsetzlicher Radau; gelobt sei das 21. Jahrhundert –, gab es einen, der nie aufkam: Ich wette, der Typ, der das Teil da fährt, hat absolut keine Ahnung, was er da treibt, und könnte in jedem Moment blindlings ausscheren und uns alle umbringen.
Die Boxenstopps gaben den Takt vor: Ich suchte eine weitere Tankstelle auf, um Flüssigkeiten und Nahrung nachzufüllen, und ein paar Stunden später steuerte ich die nächste an, um alles wieder abzuladen. Wie ich feststellen würde, spielte sich ein großer Teil des kleinstädtischen Lebens um die örtliche Tankstelle ab. Amerikanische Landbewohner fahren viel und zwar meist in einem Pick-up mit dem Kraftstoffverbrauch eines Eisbrechers, sie müssen daher oft nachtanken. Und nicht nur mit Bleifrei. Jede noch so winzige Tankstelle ist geradezu ummauert von Batterien mannshoher Glastür-Kühlschränke, die mit Reihen glitzernder, bunter Getränkedosen bestückt sind. Ich war wie gelähmt. Mit ihrer sterilen Innenbeleuchtung und den Schwaden kältetechnischen Dunstes haftete diesen Installationen etwas ehrfurchtgebietend Futuristisches an, fast wie klimageregelte Aufbewahrungsanlagen für lebensspendende Kostbarkeiten.
Rar war der Kunde, der ohne eine von Kondensation perlende Erfrischung ging. In den größeren Tankstellen gab es außerdem Getränkespender zur Selbstbedienung mit ineinander gestapelten Bechern daneben, deren Füllmenge von Zylinderhut bis Regentonne reichte. An meinem dritten Morgen sah ich einen kräftig gebauten Sheriff mit einem Trinkbecher von der Größe eines Büroabfalleimers aus einer Tankstelle herauskommen. Als ich hineinging, um zu bezahlen, warf ich einen verstohlenen Blick in den Streifenwagen und sah ihn den Becher vorsichtig in einen verlängerten trichterförmigen Adapter einfügen, der im Becherhalter der Konsole steckte.
Nun, da der Quarzergipfel offenbar überschritten ist, rangiert Amerikas Sucht nach Limonaden einsam an der Spitze als größte Belastung für das Gesundheitswesen in den westlichen Industrienationen. Werfen wir einen Blick auf die klebrigen Tatsachen. In den letzten drei Jahrzehnten hat sich die Häufigkeit von Diabetes in den USA verdreifacht, während der Verzehr zuckerhaltiger Erfrischungsgetränke sich verdoppelte – auf 170 Liter im Jahr pro Kopf. Das Vorkommen von Fettleibigkeit hat sich unter Erwachsenen mehr als verdoppelt und unter Kindern im Alter zwischen sechs und elf Jahren gar vervierfacht. J. D. Vance, der in den Appalachen aufgewachsene Autor von Hillbilly-Elegie, war neun Monate alt, als seine Mutter begann, sein Fläschchen mit Pepsi zu füllen. Mehr als ein Drittel aller Amerikaner gilt inzwischen als adipös – ein doppelt so hoher Anteil wie in Großbritannien, und wir sind immerhin die Fettwänste Europas.
In den 1970er Jahren war die größte Füllmenge, die bei McDonald’s angeboten wurde, knapp 0,6 Liter. Heute ist es mehr als ein Liter. 1995 stellte die Fast-Food-Kette Wendy’s den als »einen Strom eiskalten Vergnügens« gepriesenen 1,2 Liter fassenden »Great Biggie« vor. Dabei enthält schon eine normale 0,33-Liter-Dose Limo das Äquivalent von neun Teelöffeln Zucker. Trinken Sie einen Great Biggie und Sie haben mehr als 30 Teelöffel intus. Doch dieser spritzige, süße Strom wird noch in den Schatten gestellt von einem Sirup-Tsunami, der jeglicher physiologischen Vernunft spottet: Mit rund 1,5 Litern ist der »Double Big Gulp« von 7/11 um 156 Prozent größer als das Magenvolumen eines durchschnittlichen Erwachsenen. Junge Männer zwischen 12 und 29 konsumieren heute im Schnitt 600 Liter kohlensäurehaltige Limonade im Jahr – das sind jeden Tag fast zwei Liter. Ein erstaunliches Maß an Einsatzbereitschaft, geradezu ein Vollzeitjob.
Mir war das ganze hilflose, gedankenlose Ausmaß dieser Sucht erstmals zehn Jahre zuvor bei einem Bürgerkrieg-Reenactment in den Wäldern von Louisiana begegnet, wo ich im Rahmen der Recherchen zu einem Buch über gelebte Geschichte weilte, an dem ich damals arbeitete. Die zivilen Flüchtlinge, mit denen ich kampierte, zählten zu den fanatischsten und authentischsten Reenactment-Darstellern, die mir je untergekommen waren. Sie hatte ihre Ochsenkarren von Grund auf selbst gebaut, bis hin zu den Nägeln, die sie in einer holzkohlebefeuerten Hinterhof-Gießerei schmiedeten. Sie fertigten aus Tierknochen ihre eigenen Knöpfe, webten Kleider an einem Handwebstuhl, löffelten Maisgrütze aus zwiebelfleckigen Holzschüsseln und sagten »schon recht« statt »okay«. Sie wussten mehr über englische Geschichte als ich, jammerten viel weniger über Spinnen und bewahrten ihre Würde auch dann, wenn sie zu hören bekamen, dass sie in Knob Lick lebten. Eines Abends dann winkte mich ein Schmied mit einem verschlagenen Zwinkern in den hinteren Teil des Zelts und hob den Deckel eines großen hölzernen Eimers. Darin befanden sich drei riesige Flaschen Mountain Dew.
»Sag keinem, dass ich dir das gezeigt habe«, flüsterte er.
»Schon recht«, log ich.
Wohlgemerkt, ich äußere mich hier keineswegs aus einer Position vermeintlicher moralischer oder ernährungsbezogener Überlegenheit heraus. Der einzige Grund – Spoileralarm! –, warum ich mich auf meiner Reise im Ford T nicht auch selbst in ein diabetisches Koma soff, ist eine persönliche, historisch mehrfach belegte Korrelation zwischen dem Verzehr flüssigen Zuckers und der Ausbildung quälender Nierensteine. Dennoch schüttete ich neben den 99-Cent-Gallonen Wasser, die ich den ganzen Tag über unsicher auf meinem Schoss balancierte, jede Menge Müll in mich hinein. Da ich mich hinter dem uralten Steuer immer sicherer zu fühlen begann und die anregenden, fokussierenden Schübe reinsten Adrenalins somit ausblieben, war ich nachmittags auf beträchtliche Dosen zuckerfreien Taurins angewiesen, um die Geistesgegenwart aufrechtzuerhalten. Mit ihren infantilen Death-Metal-Namen – Relentless, Monster Rehab, No Fear – und Logos wie Fußballer-Tattoos sind Energydrinks zweifellos die albernsten und miesesten Lebensmittelerzeugnisse, die es gibt. Obendrein sind sie außerdem viel gefährlicher als einfache Limo und das auf anregend unmittelbare Weise: Energydrinks sind in den letzten Jahren mit Dutzenden tödlicher Herzattacken in Verbindung gebracht worden.
Auch schreckte ich nicht davor zurück, mich mit der fürchterlichen Fertigkost zu versorgen, die an jeder Tankstelle in rauen Mengen angeboten wurde. Kein einziges Mal blickte ich matt auf die endlosen Regale eingeschweißter Snacks und dachte: Oh nein. Schon wieder Fire Cracker Giant Red Hot Pickled Sausage als zweites Frühstück. Die Wahrheit ist: Ich liebe diesen ganzen Kram. Ich liebe es, meine geschürzten Lippen mit extremen und unirdischen Geschmackseindrücken zu besudeln, die scharlachroten Flamin’ Hot Pork Rinds, die Erdnüsse im Honig-Chipotle-Mantel, die unsäglichen Dillgurken, die in einem transparenten Beutel psychedelisch gewürzten Essigs angeboten werden wie Souvenirs zum Mitnehmen aus der Intimwundbrandklinik. Ich zog die Grenze beim Beef Jerky, aber auch nur, weil es so unfassbar teuer war. Sieben Dollar für ein Päckchen Trockenfleisch? Mensch, das ist ein Wochenvorrat an Slim Jims, dem fußlangen Schwengel aus Separatorenfleisch – dem Snack, den man hinter dem Steuer eines rasenden antiken Fahrzeugs essen kann, ohne ganz und gar die Kontrolle zu verlieren.
Aber ich konnte es mir erlauben, diesen ganzen köstlichen Mist zu essen und es auch noch zu genießen, denn ich war im Urlaub, gewissermaßen, und würde zu gegebener Zeit in einen isländisch geführten, snack-intoleranten Haushalt mit forciertem Zugriff auf frische Lebensmittel zurückkehren. Was um alles in der Welt musste eine solche Ernährung aber langfristig mit einem anrichten? Und in einer solchen unmäßigen Fülle? Der Model T war ein schlankes und behändes Auto für eine hungrige, tatkräftige Nation. Wenn Amerikaner damals ein gestörtes Körperbild hatten, so war es unschöner Magerkeit geschuldet. Nachdem Angelo Siciliano 1922 seinen Namen in Charles Atlas geändert hatte, zielte er mit seinem Fitnessprogramm auf den »50-Kilo-Schwächling« ab und ließ sich sogar den Spruch »Hey, Skinny, yer ribs are showing!« patentieren: »Hey, Hänfling, man sieht deine Rippen!«. Bis in die frühen 1960er Jahre hinein waren amerikanische Zeitungen voller Annoncen für Ergänzungsmittel zur Gewichtszunahme, begleitet von Darstellungen sacht kurviger Frauen in Badeanzügen und von Sprechblasen, in denen Dinge standen wie »Ich kriege jede Menge Dates, seit ich 10 Pfund zugenommen habe!« oder »Kaum zu glauben, dass man mich mal Bohnenstange nannte!«
Nun, worauf auch immer diese hungrigen Menschen der Tat damals aus waren, sie waren längst entschwunden und hatten es sich geholt und in den Rachen gestopft. Amerikaner geben sechsmal mehr für Fertigsnacks aus als der weltweite Pro-Kopf-Durchschnitt. Eine normale Portion Pommes bei McDonald’s ist heute dreimal so groß wie in den 1950er Jahren. Betrachten wir nur mal die normale – und sehr häufige – McDonald’s-Bestellung des aktuellen Präsidenten, wie von seinem früheren Wahlkampfmanager enthüllt: zwei Big Macs, zwei Filet-o-Fish und ein Schoko-Milchshake. Mit 2.500 Kalorien enthält diese einzelne Mahlzeit bereits deutlich mehr als die empfohlene Tagesmenge für einen Mann in seinem Alter. Als die Verkörperung des aufgedunsenen, dekadenten Endstadiums des amerikanischen Traums schreitet Trump wacker voran. Von den 25 fettesten Staaten der USA haben nur zwei ihn nicht gewählt.
Henry Ford indes verachtete Fettleibigkeit, für ihn Beleg zügelloser Faulheit und Garant eines »schwerfälligen Gehirns«. »Wenn die Leute weniger essen würden«, meinte er, »würden sie keine Ärzte brauchen.« Er wäre außer sich zu erfahren, dass viele Model-T-Besitzer im 21. Jahrhundert ihre Lenkräder umgedreht haben, um ihren Wänsten ein paar Zentimeter mehr Freiraum zu verschaffen, oder aber sich ein »Fat Man«-Lenkrad mit Scharnier haben einbauen lassen, das sich über ihre Bäuche klappen lässt, sobald sie ihren Platz am Steuer eingenommen haben. Auf meiner Suche nach einem geeigneten T war ich auf die eine oder andere Gebrauchtwagen-Anzeige von reumütigen Besitzern gestoßen, die angaben, mittlerweile »zu dick« zu sein, um ihn zu fahren.
Kehren wir nach diesem wahrhaft ausladenden Exkurs nun aber mit einem holprigen Schnitt zurück zu einem Tag im Leben unseres Antik-Autofahrers, der nun wacker in Richtung der Appalachen tuckert. Nach etwa 240 Kilometern Hitze, Lärm und kohlensäurehaltigem Taurin neigt sich sein Tag dem Ende zu und er hält an irgendeinem einsamen und verlassenen Motel, in dem die Zeit buchstäblich stehengeblieben ist. Auf dem Nachtschränkchen werden sich eine Gideon-Bibel und ein klobiges altes Telefon befinden, und der gelbe Schein einer kraftlosen Lampe wird Wände erhellen, die von lange vergangenen Jahrzehnten zügelloser Eskapaden und feurigen Temperaments gezeichnet sind. Möglicherweise befindet sich ein mexikanisches Restaurant in der Nähe. Falls nicht, wird unser Reisender einen bedauerlichen Fehler mit ein paar übrig gebliebenen Subway-Stummeln machen und nebenbei den tief verwurzelten Geruch männlichen Verfalls im Zimmer um viele neue Schichten ergänzen. Dann wird er den Fernseher einschalten.
Ein Angestellter im Weißen Haus beschrieb seine Arbeit dort einmal als »zu versuchen, einen Schluck Wasser aus einem Löschschlauch zu trinken, der nie abgedreht wird«. So erging es mir in diesen ersten Tagen mit dem Versuch, eine Bestandsaufnahme von Trumpland vorzunehmen. Zu sehr war ich mit der grellen Diskrepanz zwischen der freundlichen, bukolischen Welt vor meiner Frontscheibe und der kakophonen Panik, die dahinter herrschte, beschäftigt. Keine Zeit, über den Zustand der Nation zu grübeln, angesichts drängenderer und umgehender zu lösender Rätsel, zum Beispiel wie zur Hölle man rückwärtsfuhr oder warum die blöde Beifahrertür ständig aufging. Die Fernsehnachrichten waren meine Hoffnung auf eine gelassene, informative Übersicht der Entwicklungen, doch während Trumps Präsidentschaft ihren kranken Lauf nahm, überboten sie sich gegenseitig in ihrer rasenden Fassungslosigkeit und steigerten sich hinein in ein gellendes Chaos aus Heulen und Schreien, Furcht und Schrecken. Gequälte Korrespondenten starrten ausdruckslos in die Linse und sagten: »Jim, in 30 Jahren politischer Berichterstattung habe ich so etwas noch nicht erlebt.« Bevor sie am nächsten Tag wieder das Gleiche sagen würden.
Und die Werbung, meine Güte, die Werbung. Es heißt ja immer, dass Fernsehnachrichten bald der Vergangenheit angehören werden. In Amerika liegt das daran, dass die Zuschauer alt, fett und krank sind und somit in Scharen dahinscheiden. (Das ist nicht nur eine herzlose Verunglimpfung, sondern eine bestürzende demografische Tatsache: Die Lebenserwartung männlicher Amerikaner geht seit 2009 langsam, aber stetig zurück und steht in manchen Countys in West Virginia heute bei 64 Jahren, auf Augenhöhe mit Namibia.) Fast jede einzelne Werbung, die ich bei den drei großen Sendern zu sehen bekam – CNN, MSNBC, Fox News – drehte sich um ernsthafte Erkrankungen, die Behandlung von Fettsucht oder altersbedingte Gebrechlichkeit. Ich betätigte die Fernbedienung und schon stand die Country-Sängerin Marie Osmond in einem gegürteten pinkfarbenen Kleid vor mir, tätschelte sich den Bauch und trällerte: »Bye bye, hartnäckiges Bauchfett!« Oder eine alte Dame im Badeanzug hockte mit strahlendem Lächeln in einem Plastiksarg und schwärmte: »Eine begehbare Wanne – mit beheiztem Sitz!« »Finden Sie mit unserer kostenlosen Probepackung den Katheter, der für Sie der richtige ist – unsere Auswahl an Kathetern ist riesig! Vorgefettete Katheter! Antibakterielle Katheter! Stacheldraht-Katheter! Hochspannungs-Katheter!«
Mein Motel-Fernseher erschien mir allmählich wie ein Fenster in das dekadente, kränkliche Endstadium des amerikanischen Traums, die Vision eines Konsumismus, der sich selbst verspeist. Schaltete ich zu den Simpsons um, die sich an ein jüngeres Publikum richteten, animierte fast jeder Werbespot die Zuschauer dazu, sich dumm und dämlich zu fressen. »Iss, als gäbe es kein Morgen – bei Hardee’s!«; »Hier bei Carl Junior’s hauen wir beim Frühstück doppelt rein!«; »Ran an den karamellisierten Speck: Bei Arby’s dreht sich alles ums Fleisch!«; »Alle Red-Robin-Burger nur 6,99 Dollar – natürlich mit unseren berühmten Fritten ohne Ende!«
Zurück auf den Nachrichtensendern versuchten dann die Alten der aufgedunsenen, immobilen Folgen ihrer zügellosen Jugend Herr zu werden und gingen aufeinander los, wenn sie scheiterten: »Komplikationen mit Netzimplantaten? Infektionen, wiederöffnende Wunden, chronische Schmerzen? Möglicherweise steht Ihnen eine Entschädigung zu.« Amerikas berühmt klagefreudiger Umgang mit dem Thema Gesundheit war so richtig in Fahrt gekommen. Selbst die Untertitel auf CNN wurden mir von der Rechtsberatungs-Hotline der Mesotheliom-Hilfe präsentiert. Spannend auch, dass den Hinweisen zu Risiken und Nebenwirkungen am Ende der Spots oftmals mehr Zeit eingeräumt wurde als den Anpreisungen des Produkts selbst, und sie wurden auch nicht mehr wie früher in einem unverständlichen Singsang heruntergeleiert (kann-Kopfschmerzen-und-Eierfäule-verursachen-geben-Sie-nicht-uns-die-Schuld-wenn-Milz-explodiert).
Das Endergebnis all dieser Fremdkosten – die Milliarden, die für Werbung und Vergleiche vor Gericht draufgingen – war, dass der durchschnittliche Amerikaner heute 50 Prozent mehr für seine Gesundheit ausgibt als alle anderen auf der Welt. Man sollte es nicht glauben angesichts des ganzen Wirbels um Obamacare & Co., aber die USA haben pro Kopf über Jahre genauso viel für die Gesundheitsversorgung ausgegeben wie Länder wie Großbritannien, Japan, Frankreich und Deutschland. Es ist nur so, dass sie noch einmal die gleiche Summe – doppelt so viel wie die Schweizer, ihre ärgsten Verfolger – für die private Versorgung bezahlen.
Es ist skandalös, aber auch traurig. Diese verwässerten, verlogenen pharmazeutischen Spots mit ihrer endlosen Leier an Haftungsklauseln wirkten so entsetzlich fehl am Platz in diesem Land, einer einst so entschlossenen, hartgesottenen Nation, die nun von lähmenden Unsicherheiten geplagt war. Der ganze selbstsichere Tatendrang erschöpft, reduziert auf ein aufgedunsenes, lethargisches Jammern und Klagen. Ich musste an den dürren Loser aus Charles Atlas’ Zeichentrick-Anzeigen denken, der herumgeschubst wurde, bevor er zwei Bilder weiter den Spieß umdrehte. Heutzutage wäre die ganze Seite voller Sternchen und Fußnoten. *Ergebnisse nicht repräsentativ. *Ausgiebige Muskelertüchtigung kann zu Schmerzen und Langeweile führen. *Biegsame Federvorrichtung kann in Nasenöffnung flitschen. *Wenden Sie sich an Ihren Anwalt, falls Schikane fortbesteht.