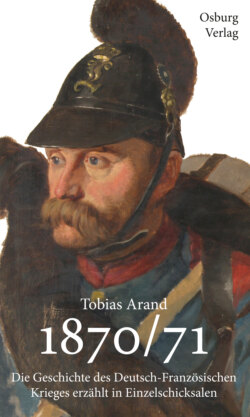Читать книгу 1870/71 - Tobias Arand - Страница 10
Оглавление»Eisen und Blut« – Die Vorgeschichte des Krieges
Was ist eigentlich passiert, dass es im Sommer 1870 zu den dramatischen Ereignissen kommen musste, die all diese Menschen in Bewegung setzen und dann als der ›Deutsch-Französische Krieg‹ oder ›70/71er-Krieg‹ bekannt werden sollten? Schauen wir zuerst auf die sehr spezifische deutsche Entwicklung einer ›verspäteten Nation‹:
Der deutsche Weg zur Einheit
Der ›Deutsche Bund‹
Im September 1862 wird Otto von Bismarck – ein als etwas hinterwäldlerisch-ruppig geltender, stockkonservativer, 47 Jahre alter Junker – preußischer Ministerpräsident. Innerhalb von neun Jahren wird er Preußen in das Deutsche Reich überführen und die von vielen sehnsüchtig erwartete Einheit vollziehen. Allerdings wird es sich dabei nur um eine ›kleindeutsche‹ Einheit handeln und werden die Widerstände und Unvorhersehbarkeiten enorm sein. Der äußere Rahmen, in dem sich dieser Prozess ereignet, ist zunächst der ›Deutsche Bund‹. Im Unterschied zu manch anderer Nation in Europa, zum Beispiel Frankreich, war es den Deutschen bis ins 19. Jahrhundert hinein nicht gelungen, eine staatliche Einheit unter zentraler Regierung und mit gemeinsamer Identität zu bilden. Seit dem 10. Jahrhundert lebten die ›Deutschen‹ in einem sprachlich, kulturell und ethnisch sehr heterogenen Kaiserreich, das weit über die Grenzen des heutigen Deutschland hinausgriff. Der heute noch bekannte Name ›Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation‹ für dieses komplexe Gebilde war ab dem Spätmittelalter gebräuchlich. Dieses Reich war ein Sammelsurium aus Kleinststaaten, Ritterschaften, Abteien, Königreichen, Herzogtümern, Fürstbistümern, Freien Reichsstädten, Grafschaften, das nur lose von einem in den letzten Jahrhunderten meist aus dem österreichischen Hause Habsburg stammenden Kaiser und dem Reichstag zusammengehalten wurde. Unter dem Druck der Französischen Revolution und der nachfolgenden Napoleonischen Kriege löste sich dieses Reich nach fast 900 Jahren seiner Existenz im Jahre 1806 auf. Vorausgegangen war die Gründung des Rheinbundes, in dem sich alle deutschen Staaten außer Preußen und Österreich zusammengefunden hatten. Die Rheinbundstaaten waren von Napoleon I. abhängige ›Satellitenstaaten‹. Die Gründung des Rheinbundes war für den letzten Kaiser des Reichs, den Habsburger Franz II., der Anlass, die Kaiserkrone niederzulegen und das Reich als aufgelöst zu betrachten. Franz II. wollte künftig lieber als Kaiser von Österreich herrschen.
Mit der Französischen Revolution des Jahres 1789 war eine neue Idee in die Welt gekommen: die Idee der Nation als Summe aller Bürger einer Sprache, einer Geschichte und einer Kultur, vereint in der Vorstellung einer vaterländischen Gemeinschaft, repräsentiert durch Fahne und Wappen. Nun war der Mensch nicht mehr rechtloser und passiver Untertan eines Fürsten, nun war er Teil einer Gemeinschaft, der er sich verpflichtet fühlen, der er dienen sollte. Mit dieser Idee der Nation wurde zugleich die Idee der allgemeinen Wehrpflicht geboren. Der absolutistische Fürst musste auf bezahlte Söldner zurückgreifen, denen die Interessen ihrer Auftraggeber gleichgültig sein konnten. Der ›Citoyen‹ als Teil der Nation hingegen sollte es als seine Pflicht verstehen, die Nation und damit ebenso sich selbst mit dem Leben zu verteidigen. Es waren erst diese seit der ›Levée en masse‹ 1793 aus Wehrpflichtigen zusammengestellten französischen Revolutionsarmeen, dann die Truppen Napoleons, welche die wirkmächtige Idee der Nation auch ins Ausland trugen. Zuerst wehrten sich die Truppen der Revolution nur gegen die Angriffe der Frankreich umgebenden Monarchien und verteidigten ihre Errungenschaften. Dann trugen sie den Krieg jedoch als ›Revolutionsexport‹ über ihre Grenzen hinaus. Was aber als revolutionärer Aufbruch zu ›Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit‹ begonnen hatte, wurde unter der Macht Napoleon Bonapartes und seiner fast ganz Europa kontrollierenden Soldaten zu Unterdrückung und Ausbeutung. In dieser verzweifelten Atmosphäre wendeten die unterdrückten Völker die Idee der Nation gegen ihre Erfinder. Sie ›erfanden‹ sich als Nationen in der Abgrenzung und im Kampf gegen Napoleon. Auch im deutschen Sprachraum schufen Literaten, Philosophen, Musiker, Historiker im Dienst der nationalen Selbstdefinition patriotische Gedichte, Bilder, Gedankenwelten, Dramen. So pflanzten sie trotz Angst vor Verfolgung, Gefängnis oder Tod vor allem den Kreisen des ›Bildungsbürgertums‹ die Idee einer deutschen Nation als Voraussetzung für Freiheit und nationale Erfüllung ein. Als Preußen im Jahr 1813, nach Napoleons verheerendem Russlandfeldzug und gestärkt durch einige tief greifende innere Reformen, endlich den Freiheitskrieg gegen den Kaiser wagte, zogen Zehntausende junger Männer freudig gegen Napoleon und seine Verbündeten in den Kampf. Viele gingen freiwillig in den Krieg, doch die meisten folgten aufgrund der kurz zuvor in Preußen eingeführten allgemeinen Wehrpflicht, in der von nicht wenigen Deutschen ein egalitär-demokratisches Element gesehen wurde.
Nach dem Ende der napoleonischen Herrschaft, das 1815 in einer großen Schlacht beim heute belgischen Örtchen Waterloo besiegelt wurde, musste Europa neu geordnet werden. Diese Neuordnung sollte auf dem Wiener Kongress geschehen, bei dem sich die Siegermächte in langen Verhandlungen auch über die Frage einigen mussten, was künftig mit den deutschen Staaten geschehen sollte. Vage Andeutungen von Verfassung, Freiheit oder staatlicher deutscher Einheit, wie sie der preußische König Friedrich Wilhelm III. seinen Untertanen bei Beginn der Freiheitskriege gegen Napoleon 1813 gemacht hatte, waren nun plötzlich kein Thema mehr. Statt eines einheitlichen Verfassungsstaates mit Bürgerrechten wurde der ‹Deutsche Bund‹ gegründet. Er verstand sich als Nachfolger des untergegangenen ›Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation‹ und stellte so keine Einheit, sondern wieder lediglich einen losen Verbund freier Einzelstaaten dar. Insgesamt umfasste der ›Deutsche Bund‹ 41 Staaten. Die vielen Klein- und Kleinststaaten sowie die zahlreichen geistlichen Territorien, die noch im ›Alten Reich‹ existiert hatten, waren bereits 1803 im sogenannten ›Reichsdeputationshauptschluß‹ zerschlagen und den größeren Mächten unterworfen worden. Führende Länder des Deutschen Bundes waren Österreich und Preußen, die sich jedoch seit den gegeneinander geführten Kriegen des 18. Jahrhunderts als Konkurrenten betrachteten. In ihrer Bedeutung am nächsten kamen diesen noch die Königreiche Bayern, Württemberg, Hannover und Sachsen. Die Großherzogtümer Baden, Oldenburg und Mecklenburg galten dagegen schon als Staaten zweiter Ordnung. Weiterhin musste ein Deutscher, der von Süd nach Nord reiste, zahlreiche Zollschranken und Grenzzäune überwinden.
Als gemeinsame Organe besaß der ›Deutsche Bund‹ die ständig tagende Bundesversammlung und als Teil der Bundesversammlung den Bundesrat, auf dem die wichtigen Beschlüsse gefasst wurden. Vorsitzender des Bundesrats war Österreich. Im Kriegsfall konnte ein gemeinsames Bundesheer einberufen werden, das sich aus Kontingenten der Bundesstaaten zusammensetzte. In ihren Staaten regierten die meisten deutschen Fürsten im ›Deutschen Bund‹ autokratisch und unter weitgehender Missachtung der ihre Rechte einfordernden Bürger. Die Meinungsfreiheit wurde unterdrückt. Ausnahmen wie das Großherzogtum Baden, das sich schon 1818 eine verhältnismäßig liberale Verfassung gab, bestätigten nur die Regel. Man tat einfach so, als habe es die Französische Revolution und die mit ihr in die Welt gekommenen Ideen des Nationalstaats, der Freiheit und der bürgerlichen Grundrechte nie gegeben. Gegen diese Missstände opponierten besonders Studenten, die in den Kriegen gegen Napoleon besonders begeistert dem Ruf des Königs gefolgt waren und für die nationale Sache zu kämpfen geglaubt hatten. 1817 protestierten sie unter Führung der Jenaer Urburschenschaft auf der Wartburg gegen Reaktion und Unterdrückung. Im Jahr 1832 wurden beim ›Hambacher Fest‹ bereits schwarz-rot-goldene Fahnen geschwenkt. ›Schwarz–Rot–Gold‹, hervorgegangen aus den Farben des Lützow’schen Freikorps, dem in den Jahren 1813 und 1814 zahlreiche idealistische Handwerker und Studenten freiwillig zum Kampf gegen Napoleon beigetreten waren, wurde das Symbol für staatliche Einheit und bürgerliche Machtteilhabe.
Weiterhin wurde ein anderer gewichtiger Umstand von den Mächtigen übersehen oder geflissentlich ignoriert. Durch die Industrialisierung bildeten sich immer rascher drei wichtige Gruppen heraus, die aus unterschiedlichen Gründen mit der althergebrachten feudalen Ordnung nichts mehr anfangen konnten. Da war einmal das zu immer mehr Einfluss kommende Bürgertum. Dieses setzte sich aus Industriellen, Geschäftsleuten, Händlern, Gelehrten, kurz aus den mit ihren Steuern den Staat tragenden Menschen, in heutiger Terminologie den ›Leistungsträgern‹, zusammen. Das Bürgertum wollte seinem ökonomischen Anteil entsprechend an der Macht beteiligt werden. Auf dem Hambacher Schloss protestierten nicht nur Studenten, sondern Professoren, Juristen, Kaufleute, Journalisten wehrten sich ebenfalls lautstark und in ganz Deutschland vernehmlich gegen Unterdrückung und Fürstenwillkür. Das Bildungsbürgertum nahm Anlauf für eine deutsche Revolution.
Zum anderen gab es das wachsende Proletariat, welches in den Fabriken der Industriellen unter Einsatz der eigenen Gesundheit den ›Mehrwert‹ des Kapitalismus schuf, sich aber mit gutem Recht als ausgebeutet und politisch an den Rand gedrängt betrachtete. Doch nicht nur diese beiden Gruppen hatten Grund, die bestehende Ordnung abzulehnen. Auch weite Teile der Landwirtschaft und der Landbevölkerung litten unter der zunehmenden industriellen Technisierung, die ihre Arbeitskraft zunehmend überflüssig machte. Traditionelle, jahrhundertelang gepflegte Handwerke verloren nach und nach durch die Effizienz der industriell fertigenden Maschinen an Bedeutung. Bauern, Handwerker, Kleingewerbetreibende und ihre Familien hatten häufig nur die Wahl, zu verhungern oder nach Amerika auszuwandern. Millionen Menschen verließen die Länder des Deutschen Bundes. In Schlesien revoltierten 1844 die hungernden Weber, bis sie vom preußischen Militär gewaltsam ›befriedet‹ wurden. Anders als das Bürgertum hatten Proletariat und Bauern aber noch keine Wege gefunden, sich als ›Klassen‹ zu begreifen und politisch zu artikulieren. Hinzu kam, dass auf dem Land häufiger als in den Städten die ›alten Sitten‹, feudale Zwänge und religiös wie monarchistisch motivierte Untertanenmentalität herrschten. Viele Bauern, vor allem östlich der Elbe, waren trotz der preußischen Bauernbefreiung des Jahres 1807, in deren Rahmen die ›Erbuntertänigkeit‹ abgeschafft worden war, noch immer faktisch Leibeigene des jeweiligen örtlichen Landadligen. Erst 1863 begann mit dem ›Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein‹ unter Ferdinand Lassalle die Bildung politischer Organisationen zur Vertretung der Interessen der ›unteren Schichten‹.
Diese beschriebene Mischung aus Ignoranz der Herrschenden, wirtschaftlicher Not, althergebrachten Strukturen und politischer Unzufriedenheit führte schließlich in Preußen und den anderen deutschen Staaten im Jahr 1848 zur Revolution, in der ein einheitlicher deutscher Verfassungsstaat unter Einschluss Österreichs geschaffen werden sollte. Ausgangspunkt der Revolution war das Großherzogtum Baden. Die Badener nahmen die Impulse der Pariser Februarrevolution auf, die den Sturz des französischen Königs Louis-Philippe zur Folge hatte. Von Baden verbreitete sich der Aufstand schnell über ganz Deutschland.
Der ›Deutsche Bund‹ überstand jedoch die Revolution von 1848/49. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. lehnte die ihm von der Frankfurter Nationalverfassung angebotene Kaiserkrone 1849 verächtlich ab. Er wollte nicht Herrscher über einen demokratisch legitimierten gesamtdeutschen Verfassungsstaat sein, sondern bevorzugte es, weiter in der Illusion einer göttlich geschaffenen Feudalordnung zu regieren. Am Ende scheiterte die Revolution, sie wurde zusammengeschossen, viele der führenden Revolutionäre kamen in Gefängnisse oder flohen in die Fremde, vornehmlich in die Vereinigten Staaten. Doch zwei wichtige Erbschaften hinterließ die Revolution: die Bildung von Parteien und ein liberal-fortschrittliches Bürgertum, das sich den Traum von Einheit und Verfassung nicht nehmen lassen wollte.
Der König hat ein Problem – Bismarck und Preußen 1862
Dreizehn Jahre nach der Niederschlagung der Revolution regiert Wilhelm I. Preußen. Wilhelm war 1858 seinem bis zur Regierungsunfähigkeit erkrankten älteren Bruder Friedrich Wilhelm IV. zunächst als Regent und nach dem Tod des Bruders 1861 als König von Preußen nachgefolgt. Wilhelm gilt als etwas fortschrittlicher als sein Bruder, wenngleich er sich bei der Niederschlagung der Revolution den wenig einnehmenden Spitznamen ›Kartätschenprinz‹ eingehandelt hat. Unter Führung des Prinzen Wilhelm wurden 1849 die letzten Reste der Revolution in Baden und in der Pfalz niedergeschlagen. Dennoch sind die ersten Jahre der Regentschaft Wilhelms I. von 1858 bis 1862 unter dem Begriff der ›Neuen Ära‹ als verhältnismäßig liberal zu bezeichnen. Daran allerdings, dass allen Parlamenten zum Trotz letztlich nur der vor Gott verantwortliche Monarch das Sagen hat, lässt Wilhelm keinen Zweifel. Der König denkt traditionalistisch und legalistisch, jedoch nicht reaktionär. Die Jahre der Unterdrückung während der Regierungszeit seines Bruders will er aufrichtig überwinden. Hierarchien, Ordnungen und ein korrektes Verhalten innerhalb monarchischer Rangfolgen sind ihm dennoch überaus wichtig. So reagiert er sehr emotional und unbedacht, wenn er sich in seiner königlichen Würde missachtet fühlt, und achtet umgekehrt penibel darauf, selbst korrekt aufzutreten. Die intellektuellen Interessen des gläubigen Protestanten sind zwar begrenzt, er besitzt aber gesunden Menschenverstand und politisches Verständnis. Seine Frau Augusta, eine Tochter des aufgeklärten Goethe-Förderers Karl August Großherzog von Sachsen-Weimar, ist eine kluge Beobachterin und Ratgeberin, die ihrem Gatten offen auch ihre Meinung zu politischen Fragen mitteilt. Verheiratet ist der König jedoch vor allem mit seiner Armee, um die seine Gedanken meist kreisen.
Wilhelm I. regiert einen großen, allerdings territorial zersplitterten Flächenstaat mit erheblichen regionalen Unterschieden. Während der Westen rund um das heutige Ruhrgebiet und einige andere Industriegebiete in Schlesien durch die Kohlegewinnung und Stahlverarbeitung eine rasante Entwicklung erleben, sind andere Landschaften Preußens noch rein agrarisch geprägt. Von 1816 bis 1861 hat sich die Bevölkerungszahl Preußens von ca. zehn Millionen auf ca. 19 Millionen Menschen fast verdoppelt.
Seit 1848 gibt es in Preußen eine oktroyierte Verfassung, die dem Bürgertum neben einigen Grundrechten, zum Beispiel eine relative Pressefreiheit, das Zugeständnis eines im Dreiklassenwahlrecht zu bildenden Abgeordnetenhauses macht. Gemeinsam mit dem aus ernannten Mitgliedern bestehenden ›Preußischen Herrenhaus‹ bildet das Abgeordnetenhaus den ›Preußischen Landtag‹. Im Abgeordnetenhaus treten die Gegensätze zwischen den beiden in Preußen dominierenden politischen Kräften offen zu Tage: auf der einen Seite die monarchistisch-feudal gesinnten Konservativen, auf der anderen die durch das rasche Wirtschaftswachstum in den 1850er- und 1860er-Jahren immer selbstbewusster gewordenen bürgerlich gesinnten Liberalen. Durch das preußische Dreiklassenwahlrecht fundamental benachteiligt, haben die Wähler aus Proletariat und Landbevölkerung keine parlamentarischen Vertreter, die genuin ihre Interessen vertreten könnten. Sie sind auf das Wohlwollen der von den Adligen sowie Besitz- und Bildungsbürgern gestellten Abgeordneten angewiesen. Die Minister werden direkt vom König bestimmt und sind nur diesem Rechenschaft schuldig. Der König kann den Landtag jederzeit auflösen und neu wählen lassen. Dieses preußische Abgeordnetenhaus hat also keine weitgehenden Rechte, doch ein Instrument der Beeinflussung der königlichen Politik besitzt es: das Budgetrecht. Das preußische Abgeordnetenhaus kann den jährlich vorgelegten Staatshaushalt ablehnen und so politische Forderungen artikulieren. Im Jahr 1862 ist die liberale Mehrheit des Hauses sehr unzufrieden mit dem Haushalt. Der Streit geht so weit, dass der König sogar daran denkt, abzudanken.
Was ist das Problem? Der Konflikt, der Preußen in eine Staats- und Verfassungskrise stürzt, dreht sich um die Heeresvorlage des königlichen Kabinetts. Diese sieht 1860 eine Verlängerung der Wehrdienstzeit und damit eine Vergrößerung des Friedensbestands des Heeres von zuvor 140 000 Mann, ein Stand, der seit 1815 trotz des schon erwähnten Anstiegs der Einwohnerzahl Preußens nicht mehr verändert worden war, auf nunmehr 200 000 Mann vor. Daneben bestehen bereits im Jahr 1858 Pläne zur Schwächung der Landwehr, die seit den Befreiungskriegen ein bürgerlich dominiertes Ersatzheer darstellt, das im Kriegsfall rasch mobilisiert werden kann. Die Pläne der Regierung sollen den Ausbildungsstand des Heeres verbessern und die Friedensstärke auf eine Größe bringen, welche die preußische Armee konkurrenzfähig mit den Heeren anderer Staaten machen soll. Weiterhin soll die Armee technisch modernisiert und aufgerüstet werden. Dieser Plan ist durchaus plausibel. Dadurch, dass die Einziehungsrate von Rekruten trotz der Verdoppelung der Einwohnerzahl seit vierzig Jahren nicht erhöht worden ist, entgehen jährlich 23 000 Männer dem Wehrdienst. Preußen ist von Kriegsgegnern umgeben und muss verteidigungsfähig bleiben. Gleichzeitig soll mit der Armee, die schließlich wesentlich an der Niederschlagung der Revolution beteiligt war, auch die Macht der Monarchie gestärkt, mit der Schwächung der Landwehr ein möglicher demokratischer Unruheherd ausgeschaltet werden. König und konservatives Kabinett bitten das Abgeordnetenhaus um die Bewilligung der nicht unerheblichen Mehrkosten für ihre Pläne. Die liberalen Kräfte, insbesondere die Mitglieder der 1861 gegründeten ›Deutschen Fortschrittspartei‹, lehnen die Heeresreform jedoch mit ihrer Mehrheit ab und versuchen an diesem neuralgischen Punkt, die Macht des Parlaments durch Verweigerung des Gesamthaushalts zu stärken. Die Liberalen sind keineswegs grundsätzliche Antimilitaristen. Vielmehr befürworten sie die Wehrpflicht und den Waffendienst für alle als eine demokratische Errungenschaft. Aber sie haben dem Heer seine Rolle in den Jahren 1848/49 nicht vergessen.
Ohne parlamentarisch abgesegneten Haushalt ist der Staat Preußen jedoch praktisch handlungsunfähig. Der König ist verzweifelt und hat sein Abdankungsschreiben angeblich schon abgefasst. In dieser Situation beruft Wilhelm I. jedoch, statt zu demissionieren, lieber Otto von Bismarck zum preußischen Ministerpräsidenten. Dass diese Berufung auf Vermittlung ausgerechnet Albrecht von Roons, des preußischen Kriegsministers, zustande kommt, soll sich als symbolhaft für die Zukunft erweisen.
Bismarck hat den Auftrag, die Parlamentarier zu bändigen und den Willen des Königs durchzusetzen. In einem dramatischen Vieraugengespräch am 22. September 1862 zwischen Bismarck und dem König versichert Bismarck seinem Monarchen absolute Treue und einen Kampf bis aufs Letzte für die Durchsetzung der Heeresreform. Der 1815 in Schönhausen bei Stendal geborene Gutsverwalter und studierte Jurist Bismarck steigt 1847 in die Politik ein und macht sich als erzkonservativer Monarchist und reaktionärer Scharfmacher rasch einen bei Liberalen verhassten Namen. Als kleiner Landedelmann mit wenig herausragendem Juraexamen gilt er auch vielen Mitgliedern des Hochadels als wenig satisfaktionsfähig. Er spürt die Herablassung und beantwortet sie mit übersteigertem Selbstbewusstsein und zuweilen dröhnender Ruppigkeit. Selbstverständlich lehnt er die Revolution von 1848/49 strikt ab. 1851 wird Bismarck preußischer Gesandter im Bundestag von Frankfurt, 1859 wird er nach Sankt Petersburg versetzt, 1862 noch kurz nach Paris. Bismarck, zwar ein Mann von konservativen Überzeugungen, paart seinen Konservatismus mit einem kalten Machtinstinkt und scharfen Realitätssinn. Beide Gaben lassen dann zuweilen eine politische Wendigkeit und eine moralische Flexibilität erkennen, die Bismarck vielen Konservativen suspekt macht. Bismarck interessiert sich letztlich nicht für Prinzipien, sondern einzig für die Durchsetzung der Bedürfnisse Preußens und seines Königs, wobei Bismarck Wilhelm allerdings häufig erst zwingen muss, sein Handeln als tatsächliche Erfüllung königlicher Interessen zu verstehen. Dazu kommt Bismarcks Neigung, in der Formulierung seiner Meinung keinerlei Rücksicht auf die Empfindlichkeiten anderer zu nehmen – eine Eigenschaft, die durch seine Körpergröße, den buschigen Schnurrbart und einen strengen Blick noch an Schärfe gewinnt. Lediglich Bismarcks schwache Stimme passt nicht zu seiner einschüchternden Physis und dominanten Art. Die Urteile mancher Zeitgenossen sind harsch. Der englische Diplomat Sir Alexander Malet fällt 1862 ein ambivalentes Urteil: »Er hat eine starke, vielleicht unangemessene Verachtung der öffentlichen Meinung und eine kaum geringere gegenüber dem deutschen Liberalismus und seinen Führern; er ist in der Äußerung seiner Ansichten freimütig bis zur Unverfrorenheit und besitzt eine außerordentliche Selbstbeherrschung. Ich glaube kaum, dass irgendwelche Bedenken für ihn Gewicht haben, wenn es sich um eine territoriale Abrundung Preußens handelt […].«13 Max von Forckenbeck, führender Liberaler, schreibt über Bismarck deutlich schärfer als der neutrale Diplomat Malet: »Bismarck-Schönhausen bedeutet: Regieren ohne Etat, Säbelregiment im Innern, Krieg nach außen. Ich halte ihn für den gefährlichsten Minister für Preußens Freiheit und Glück […].«14 Auch Wilhelms Frau Augusta lehnt Bismarck ab. Die Abneigung ist wechselseitig. Später sollte er sich wenig freundlich über Augusta äußern und bemerken, dass sie ihm »mehr Probleme bereitete, als alle ausländischen Mächte und Oppositionsparteien im Innern«15. Was Bismarcks Opponenten jedoch meist übersehen, sind Bismarcks Gedankenschärfe und Tiefgründigkeit. Dieser Mann handelt selten unbedacht und seine Provokationen sind stets taktisch begründet. Berüchtigt, zugleich aber daneben Ausweis seiner Intellektualität sind Bismarcks scharfzüngige, stilistisch anspruchsvolle Beobachtungen menschlichen Handelns und menschlicher Charaktere, wie er sie in Briefen und Reden äußert. Hinter der ruppigen Fassade verbirgt sich schließlich ein feinfühliger, vielseitig interessierter Geist mit zuweilen schwachen Nerven. Der kettenrauchende, Unmengen Schinken und Brandy konsumierende Hüne Bismarck legt sich bei politischen Krisen gern krank ins Bett oder wandelt am Rand von dramatischen Nervenzusammenbrüchen.
Die erste Kostprobe seiner Fähigkeit zur rücksichtslosen Meinungsäußerung gibt er im neuen Amt gleich am 30. September 1862 vor der Budgetkommission des Abgeordnetenhauses, indem er zwei seitdem viel zitierte Sätze ausspricht: »Nicht auf Preußens Liberalismus sieht Deutschland, sondern auf seine Macht. […] Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden […] – sondern durch Eisen und Blut.«16 Die Wut der liberalen Abgeordneten ist Bismarck so gewiss wie der Hass der freiheitlichen Presse, bündelt sich in dieser Sentenz doch Bismarcks politisches Credo: Es gilt das Recht des Stärkeren, Parlamente sind überflüssige ›Schwatzbuden‹ und Krieg ist ein legitimes Mittel zum Zweck. Vielen Liberalen, ›altrevolutionären‹ Demokraten und Vertretern der im Entstehen begriffenen Sozialdemokratie gilt Bismarck spätestens jetzt als »der schärfste und letzte Bolzen der Reaktion«17.
Bismarck regiert im Folgenden ohne abgesegneten Haushalt und beruft sich dabei auf eine vermeintliche Lücke der Verfassung, die im Falle eines derart tief greifenden Konflikts zwischen König und Parlament keine Regelung vorsehe, weshalb der König und sein Kabinett auch ohne Zustimmung ›souverän‹ handeln könnten. Trotz dieser originellen ›Lückentheorie‹ ist Bismarcks Handeln Verfassungsbruch. Dieses Hintergehen des Parlaments trägt Bismarck unversöhnliche Feinde und ein mit Aggressionen aufgeladenes politisches Klima ein. Die auf diese Weise trotzdem in Gang gesetzte Heeresreform, an deren Ende die preußische Armee zur mächtigsten und gefürchtetsten Streitmacht Europas wird, gründet auf gesetzwidriges Verhalten der Regierung Bismarck. Am Anfang der deutschen Militärmacht des 19. und des 20. Jahrhunderts steht der Betrug an einem gewählten Parlament. Die Finanzierung der Heeresreform erfolgt nun unter Geldaufnahme bei privaten Financiers. Bismarck arbeitet dabei eng mit dem befreundeten Bankier Gerson Bleichröder zusammen, der auch die Privatgeschäfte des Ministerpräsidenten regelt. Der geschickte Bleichröder verkauft zugunsten der preußischen Heeresfinanzierung Staatseigentum, unter anderem Kohlegruben, ohne zuvor, wie eigentlich vorgeschrieben, den Landtag zu informieren.
Durch Schikanen gegen Beamte, die der Fortschrittspartei angehören, und eine im Juni 1863 verhängte, verfassungswidrige Presseverordnung, die das Verbot regierungskritischer Zeitungen ermöglicht, gießt der ›Konfliktminister‹ Bismarck zusätzlich Öl ins Feuer der politischen Erregung. Allerdings versucht Bismarck mit der autoritären Presseverordnung ebenfalls die zahlreichen persönlichen Beleidigungen, die ihm durch oppositionelle Zeitungen widerfahren, zu unterbinden. Am 22. Mai 1863 richtet das liberal dominierte Abgeordnetenhaus eine scharfe Note an den König: »Das Haus der Abgeordneten hat kein Mittel der Verständigung mehr mit diesem Ministerium.«18 Der König löst wie bereits im Vorjahr den Landtag auf, obgleich die Wahlperiode eigentlich drei Jahre beträgt. Die Neuwahlen stärken jedoch erneut die liberale Mehrheit. Im November 1863 bringt das neu gewählte Abgeordnetenhaus als erste Amtshandlung Bismarcks verhasste Presseverordnung zu Fall. Die Ankündigung des Königs, das Abgeordnetenhaus so lange auflösen und neu wählen zu lassen, bis eine ihm genehme Zusammensetzung erreicht sei, beruhigt die Gemüter nicht gerade. Bismarck selbst erinnert sich später selbst dramaturgisch überspitzt an die Aufgeregtheiten dieser Zeit. König Wilhelm soll zu ihm im Oktober 1862 gesagt haben: »Ich sehe ganz genau voraus, wie das alles endigen wird. Da, vor dem Opernplatz, unter meinen Fenstern, wird man Ihnen den Kopf abschlagen und etwas später mir.«19
Das gewollte Scheitern – Der ›Fürstentag‹ 1863
Eine Chance für Bismarck, von den innenpolitischen Schwierigkeiten Preußens, vom offen vorliegenden Verfassungsbruch und dem harten Kampf gegen die liberale Opposition abzulenken, bietet ihm die Außenpolitik. Insbesondere der stets schwelende Konflikt mit Österreich soll nun in den Mittelpunkt rücken. In gewisser Weise beginnt schon 1863 der Prozess, der zur ›kleindeutschen‹ Einheit führen wird.
Im ›Deutschen Bund‹ streiten zu diesem Zeitpunkt drei wichtige Konzepte über die Zukunft eines künftigen Reichs. Große Teile des liberalen und überwiegend protestantischen Bürgertums in den nordund mitteldeutschen Staaten streben einen deutschen Nationalstaat unter Ausschluss Österreichs an. Diese ›kleindeutsche‹ Nationalbewegung nimmt dabei eine zwangsläufige starke Dominanz Preußens im zu schaffenden Reich in Kauf. Von Preußen soll diese nationale Einigung auch ausgehen. Organisiert ist die ›kleindeutsche‹ Nationalbewegung im ›Deutschen Nationalverein‹, der aus Liberalen und gemäßigten Demokraten besteht. Vorbild des Nationalvereins ist die italienische ›Società Nazionale‹. Die nationale Einigung Italiens der Jahre 1859/60, die im Zusammenwirken von liberalem Bürgertum und dem Königreich Sardinien-Piemont in blutigen Kriegen erkämpft wurde, hat gezeigt, wie ein Erfolg versprechender Weg auch für Deutschland aussehen konnte.
Die ›großdeutsche‹ Bewegung hingegen, die vor allem von süddeutsch-katholischen Liberalen, einigen Konservativen und alten Revolutionären der Jahre 1848/49 getragen wird, steht für ein Reich unter Einschluss des deutschsprachigen Teils von Österreich.
Doch auch Befürworter des Status quo sind anzutreffen. Sie wünschen, dass alles so bleibt, wie es ist. Diese christlich geprägten ›Ultra-Konservativen‹ lehnen jeden Umsturz aus Prinzip ab, wünschen sich zum Teil vorrevolutionäre Feudalverhältnisse zurück, halten soziale Ungerechtigkeiten für gottgewollt und stehen konsequenterweise der Nationalstaatsidee als einer der Haupterrungenschaften der Französischen Revolution kritisch gegenüber. Sie besitzen mit der ›Neuen Preußischen Zeitung‹, auch ›Kreuzzeitung‹ genannt, ein wirkmächtiges Publikationsorgan, das auf die öffentliche Meinung – und damit zugleich auf die Politik – großen Einfluss nimmt. Bismarck steht in vielen seiner politischen Überzeugungen diesen Konservativen nahe, ist er doch vielmehr preußischer als deutscher Patriot und sicher kein Freund liberaler Umstürzler. Allerdings fürchtet er den mangelnden Pragmatismus dieser Kreise.
Bismarck ahnt aber auch anders als viele andere Konservative, dass es zwischen den beiden großen Nationalstaatskonzepten eines Tages eine Entscheidung geben und der Status quo nicht aufrechtzuerhalten sein wird. Wichtig ist ihm dabei die Sicherstellung einer Hegemonie Preußens, die nur durch die ›kleindeutsche‹ Lösung, also ohne Österreich und damit nur gegen Österreich, zu erreichen sein wird. Dass diese Entscheidung schließlich durch drei Kriege herbeigeführt werden muss, kann er zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Allerdings ist ihm sicher bewusst, dass der Sinn der Heeresreform unter anderem darin liegt, eine Arrondierung des preußischen ›Streuterritoriums‹ durch militärische Mittel zu ermöglichen. Moralische Skrupel, diese Mittel bei günstiger Gelegenheit auch einzusetzen, sollte man Bismarck sicher nicht unterstellen. Anders als es die sogenannte ›borussische Geschichtsschreibung‹ eines Heinrich von Treitschke und anderer Bismarckverehrer nach 1871 glauben machen wollte, besitzt der preußische Ministerpräsident 1863 noch keinen ›Masterplan‹ auf dem Weg zur ›kleindeutschen‹ Einheit. Doch auch ohne diesen Plan weiß Bismarck, Gelegenheiten zu erkennen und taktisch zu nutzen. Erst in der Rückschau erscheint es reizvoll, in diesem Taktieren eine Strategie von Beginn an erkennen zu wollen.
Vor dem Hintergrund der widerstreitenden Konzepte bekommt eine Initiative Österreichs zur Reform des Deutschen Bundes große Bedeutung. Der noch kurz vor Bismarcks Amtsübernahme lancierte Reformplan sieht vor, die Bundesorgane deutlich zu stärken und ein fünfköpfiges Gremium, ›Direktorium‹ genannt, an die Spitze zu setzen. Den Vorsitz des ›Direktoriums‹ soll Österreich erhalten. Ebenfalls soll es eine ›großdeutsche‹ Nationalvertretung geben. Mit diesem Vorschlagspaket, welches das Potenzial eines ersten Schritts zu einem Nationalstaat hat, versucht Österreich, einen wichtigen Angriffszug im Schachspiel um die Führungsrolle im künftigen Reich zu platzieren. Nicht zufällig fällt dieser Angriff in einen Moment, in dem Österreich Preußen durch den Verfassungskonflikt im Inneren gelähmt wähnt. Über den Reformplan soll nach Einladung des österreichischen Kaisers im August 1863 in Frankfurt am Main auf einem ›Fürstentag‹ abgestimmt werden. König Wilhelm, immer um korrektes Auftreten und die Einhaltung von Vorschriften bemüht, sieht eine Reise zum ›Fürstentag‹ als seine Pflicht an. Schließlich kann man als König doch nicht einem Kaiser eine persönlich überreichte Einladung abschlagen! Bismarck sieht in der Einladung aber eine Falle: Reist der König dorthin, erkennt er bereits die Initiative Österreichs als diskussionswürdig an und bringt Preußen damit in die Defensive. Eine Annahme des österreichischen Plans betrachtet Bismarck als Katastrophe, würden doch damit aus seiner Sicht alle preußischen Hegemonialpläne hinfällig. Bismarck bringt pro forma radikale, geradezu demokratische Gegenvorschläge ins Spiel, die wie erwartet und erwünscht von Österreich abgelehnt werden. Dennoch gelingt es Bismarck nur mühsam, seinen König von der Reise abzuhalten und die Pläne Österreichs damit ins Leere laufen zu lassen. Ohne die Anwesenheit Preußens in Frankfurt ist jeder Beschluss des lange beratenden ›Fürstentags‹ wertlos. Die dramatischen Gespräche Bismarcks mit dem häufig widerstrebenden König, die Rücktrittsdrohungen, Wutanfälle, Tränenausbrüche und psychologischen Manipulationstricks, die der Ministerpräsident anwenden muss, um seinen Willen zu bekommen, geben bereits jetzt ein Muster für die folgenden, nicht weniger konfliktreichen Jahre ab, in denen das Verhältnis des emotionalen Königs und seines treuen, aber ebenso reizbaren Paladins noch häufiger auf harte Proben gestellt werden soll. In Frankreich werden beide einige Jahre später ihre Konflikte bis an den Rand der psychischen und physischen Erschöpfung austragen. Bismarck wird allerdings letztlich immer seinen Willen bekommen …
Der Erste Einigungskrieg – Der Deutsch-Dänische Krieg von 1864
Bereits im Ersten Schleswig-Holsteinischen Krieg, der von 1848 bis 1851 dauerte, hatten Deutsche und Dänen um die Stellung der Herzogtümer Schleswig und Holstein gerungen. Damals siegte noch Dänemark. Durch das ›Londoner Protokoll‹ von 1852 wurden die künftigen Verhältnisse der Herzogtümer geregelt. Preußen und Österreich waren neben Frankreich, England, Russland, Schweden und Dänemark Signatarmächte des Protokolls und damit für die Einhaltung der vereinbarten Regeln verantwortlich.
1863 bricht der Konflikt erneut auf und gibt Bismarck eine weitere Gelegenheit, mit Außenpolitik von inneren Schwierigkeiten abzulenken. Holstein und das kleinere Herzogtum Lauenburg sind zu diesem Zeitpunkt Mitglieder im ›Deutschen Bund‹, zugleich ist der dänische König aber auch Herzog dieser Länder. Schleswig ist nicht Bundesmitglied, aber Lehen des dänischen Königs. In Schleswig gibt es eine große deutsche Minderheit, die bis zum ersten Drittel des 19. Jahrhunderts friedlich mit der dänischen Mehrheit zusammenlebt. Doch der aufkommende Nationalismus auf beiden Seiten vergiftet das Verhältnis zunehmend. Nach dem dänischen Sieg von 1851 empfindet sich die deutsche Minderheit in Schleswig als fremdbestimmt und tatsächlich sparen die Dänen nicht mit Zeichen ihres Führungsanspruchs. Viele Schleswiger wollen raus aus Dänemark.
Manche Dänen pflegen einen aggressiven Nationalismus. Eine starke nationale Bewegung, die ›Eiderdänen‹, fordert eine stärkere Einbeziehung Schleswigs in den dänischen Staat und damit den Fluss Eider als Südgrenze des Königreichs Dänemark unter Ausschluss Holsteins und Lauenburgs. Die deutsche Minderheit soll danisiert werden. Gegen diese Pläne sprechen jedoch die international in London garantierte Selbstverwaltung Schleswigs sowie eine mittelalterliche Bestimmung, nach der Schleswig und Holstein ›up ewig ungedeelt‹ – für immer ungeteilt – zu bleiben haben.
Anfang der 1860er-Jahre wächst der Einfluss der ›Eiderdänen‹. Sie stellen Minister und entwerfen eine Verfassung, die Schleswig Dänemark vollständig einverleiben soll. Als am 18. November 1863 der dänische König Christian IX. drei Tage nach seinem Amtsantritt die sogenannte ›Novemberverfassung‹ unterschreibt, mit der die ›eiderdänischen‹ Wünsche umgesetzt werden sollen, erhebt sich ein Aufschrei der Empörung in den deutschen Ländern. Überall wird lautstark der Kampf für die bedrängten ›deutschen Brüder im Norden‹ gefordert.
Bismarck erkennt sofort die Chance für einen außenpolitischen Coup. Er verständigt sich mit Österreich zu einem gemeinsamen Vorgehen. Zuerst wird gegen Holstein und Lauenburg die Bundesexekution verhängt. Die Bundesexekution ist eine mögliche Strafmaßnahme des Deutschen Bundes gegen einzelne Mitglieder, hier gegen den König von Dänemark als Herzog von Holstein und Lauenburg. Kampflos ziehen am 23. Dezember 1863 preußische, österreichische, sächsische und hannoversche Truppen in die beiden Herzogtümer ein. Am 16. Januar 1864 fordern Preußen und Österreich ultimativ die Rücknahme der ›Novemberverfassung‹. Dänemark lässt das Ultimatum in der vergeblichen Hoffnung auf Unterstützung der anderen Signatarmächte verstreichen. Am 1. Februar 1864 marschieren beide Großmächte in Schleswig ein. Kurz zuvor, am 25. Januar, lässt König Wilhelm den Landtag für fast ein Jahr schließen, da zwischen Regierung und Abgeordnetenhaus noch immer kein ihm genehmer Ausgleich erzielt worden war. Es mag kaum übertrieben sein, hier ein Paradebeispiel für den Zusammenhang von kontrovers-repressiver Innenpolitik und Krieg als Mittel der Ablenkung von dieser Politik zu sehen. Im patriotischen Überschwang schweigen gern auch viele sonst kritische Stimmen.
Mit der blutigen Erstürmung der Düppeler Schanzen, einer Befestigungsanlage, die den Übergang zur Ostseeinsel Alsen sichert, am 18. April 1864 durch preußische Truppen ist Dänemark bereits entscheidend geschwächt. Mit dem Übersetzen preußischer Truppen nach Alsen bei Arnekiel, wohin sich die Reste der dänischen Armee geflüchtet hatten, ist im Juni 1864 der Krieg entschieden. Die österreichischen Truppen haben ihren Anteil am Sieg vor allem durch erfolgreiche Kämpfe in Dänemarks größtem Landesteil Jütland.
Im Deutsch-Dänischen Krieg konnten die preußischen Truppen zum ersten Mal seit den Kämpfen gegen Napoleon und der unrühmlichen Niederschlagung der Revolution in Baden 1849 wieder ihre Kampfkraft beweisen. Der Aufstieg Preußens zur gefürchteten Militärmacht des 19. Jahrhunderts hatte für alle sichtbar begonnen. Im Vertrag von Wien tritt Dänemark am 30. Oktober 1864 Schleswig, Holstein und Lauenburg an Preußen und Österreich ab. Wie traumatisch dieses Ergebnis für das nationale Selbstbewusstsein vieler Dänen gewesen sein muss, lässt sich noch heute auf den als patriotische Erinnerungsstätten hergerichteten Schlachtfeldern und in zahlreichen Museen nachvollziehen. Bis in die Gegenwart gedenkt Dänemark mit Wehmut und häufig die eigene Verantwortung leugnendem Selbstmitleid der Folgen der dramatischen Fehlkalkulation der Jahre 1863 und 1864.
Für Bismarck ist der Sieg ein großer Erfolg. Er hat die Effektivität der Heeresreform in der Praxis bewiesen und so manchen liberalen Gegner ins Grübeln gebracht. Die von Bismarck beschworene Einheit durch ›Eisen und Blut‹ erscheint nun einigen Liberalen als eine denkbare Alternative, die vielleicht nicht angenehm, dem Zustand der staatlichen Zersplitterung aber vorzuziehen ist.
Auch die deutsche Kriegsindustrie ist zufrieden. So konnten insbesondere die Gussstahlkanonen der Essener Stahlgießerei Krupp vor den Düppeler Schanzen eindrucksvoll ihre Leistungsfähigkeit beweisen. Dass der preußische Staat die Waffen ohne verfassungsgemäßen Etat, sozusagen mit ›Schwarzgeld‹, abgekauft hat, ist den Industriellen dabei gleichgültig. Der Preis für Bismarcks Wunsch, durch kriegerische Außenpolitik von seiner umstrittenen Innenpolitik abzulenken und die Heeresreform durchzusetzen, ist hoch. Für Bismarck, seinen König, die Interessen der Industrie und die bürgerlichen Träume von der staatlichen Einheit verlieren ca. 8000 Männer beider Seiten Leben oder Gesundheit. Gekämpft hatten neben dem überwiegend adeligen Offizierskorps vor allem Bauern, einfache Handwerker und Arbeiter, für deren Interessen sich aber weder Konservative noch Liberale ernsthaft einsetzen. Ihre Rolle erfüllt sich darin, Schanzen zu stürmen und als Tote die Schlachtfelder zu bedecken. Die dänische Kampagne sollte dafür nur das vergleichsweise harmlose Vorspiel bilden.
Ein friedliches Mittel der ›kleindeutschen‹ Reichseinigung – Der Deutsche Zollverein
Parallel zu den außenpolitisch-militärischen Plänen versucht Bismarck außerdem auf dem Feld der Wirtschaft, Österreich zur Seite zu drängen. Dabei kann er an die Arbeit seiner Vorgänger anknüpfen. Eine wichtige Einrichtung, in der die deutsche Einheit in Teilen vorweggenommen ist, stellt der 1834 errichtete Deutsche Zollverein dar. In ihm sind Preußen, Bayern, Württemberg, Sachsen, Baden und die mittel- wie norddeutschen Kleinstaaten organisiert. Seine Aufgabe besteht im Abbau von Zoll- und Handelsschranken zwischen den deutschen Staaten. Das Fehlen Österreichs im Zollverein ist eine wichtige Vorentscheidung im Kampf zwischen ›kleindeutscher‹ und ›großdeutscher‹ Lösung, kann Preußen doch dadurch den Zollverein dominieren und für seine Interessen instrumentalisieren. Auch in der Zollfrage konkurrieren Preußen und Österreich erbittert. Die preußischen Vorstellungen zielen auf eine deutsche Freihandelszone mit Orientierung nach Westen, womit den Interessen der exportorientierten preußischen Agrarwirtschaft, der Handels- und der Finanzindustrie Rechnung getragen würde. Österreich hingegen wünscht ebenfalls eine Zollunion, möchte seine Wirtschaftszweige aber durch Schutzzölle sichern und tritt deshalb dem Zollverein nicht bei. Eine Westbindung, zum Beispiel durch Freihandelsverträge mit Frankreich, wäre für Österreichs mittel- und osteuropäisch orientierte Wirtschaftswelt deutlich nachteilig. Allerdings versucht Österreich, mit eigenen Vorschlägen den Zollverein in seinem Sinne zu beeinflussen, um doch noch beitreten zu können. Für beide Seiten ist es wichtig, die anderen deutschen Staaten von den eigenen Vorstellungen überzeugen zu können. Ständig werden neue Pläne vorgestellt. Die ›Südstaaten‹ Bayern, Württemberg und Baden stehen auf Österreichs Seite, fürchten sie doch mit Recht eine preußische Übermacht. Dazu kommt, dass sie sich konfessionell, kulturell und historisch der südlichen Großmacht näher fühlen.
Dieser Jahrzehnte währende Konflikt kommt noch vor Bismarcks Amtsantritt zu einer Vorentscheidung. Im März 1862 unterzeichnen Preußen und Frankreich einen Handelsvertrag. Nun kommt es für die beiden deutschen Großmächte lediglich darauf an, die anderen Staaten auf ihre Seite zu ziehen. Hier nutzt Preußen seine ökonomische und militärische Dominanz nördlich des Mains rücksichtslos aus. Die kleinen deutschen Länder werden mit mehr oder weniger subtilen Methoden bedroht. Der öffentliche Druck des ›kleindeutsch‹ orientierten Bürgertums nördlich der Mainlinie tut ein Übriges. Verhandlungen mit Österreich lässt Bismarck eher nur noch zum Schein führen. Nach und nach treten 1864 die anderen deutschen Staaten nördlich des Mains dem preußisch-französischen Freihandelsbund bei. Auch wenn die Südstaaten vorerst fehlen, hat das preußische Freihandelssystem gesiegt. Wirtschaftlich ist Österreich aus Deutschland praktisch ausgeschieden. Nun fehlen noch der politische und der militärische Rauswurf.
Das Endspiel um die Macht in Deutschland – Preußens Krieg gegen Österreich
Im Jahr 1866 kommt es schließlich zum ›Showdown‹ zwischen den beiden deutschen Großmächten. Die Voraussetzungen sind jedoch schon in den Jahren zuvor gelegt worden. Anders als heute verstanden die Politiker des 19. Jahrhunderts Krieg in Europa als ein legitimes Mittel zur Durchsetzung staatlicher Interessen. Durch geschicktes Paktieren, Handeln oder Gewährenlassen konnten Allianzen geschmiedet oder Dankbarkeiten bewirkt werden.
Im Krimkrieg, den von 1854 bis 1856 Frankreich, Großbritannien, das Osmanische Reich und Sardinien-Piemont gegen Russland führten, hatte sich Österreich ungeschickt verhalten. Es war zwar nicht Kriegspartei, band jedoch durch Truppenbewegungen und eine unklare Haltung russische Truppen an der Grenze. Dazu hatte es Russland durch ein Ultimatum gezwungen, sich den englischen und französischen Friedensbedingungen zu unterwerfen. Nachdem 1849 ein ungarischer Aufstand mithilfe russischer Truppen unterdrückt und nur so die Habsburgermonarchie gerettet worden war, zeigte man sich beim Zaren mehr als verstimmt über so viel Treulosigkeit. Die ›Heilige Allianz‹ des Jahres 1815, in der sich die Monarchen von Russland, Preußen und Österreich geschworen hatten, in Europa gemeinsam die vorrevolutionäre Ordnung zu bewahren, hatte sich überlebt. Russland würde Österreich in einem Krieg gegen Preußen sicher keine Hilfe leisten. Preußen hatte sich im Krimkrieg herausgehalten und so keine der Kriegsparteien verärgert.
Auch in den ›Sardischen Krieg‹, der 1859 zwischen Frankreich, Sardinien-Piemont auf der einen und Österreich auf der anderen Seite geführt wurde, hatte sich Preußen nicht eingemischt. Unbeeindruckt ließ es Preußen geschehen, dass die einstigen Waffengefährten der Napoleonischen Kriege von Frankreich und Sardinien-Piemont besiegt wurden und Österreich die Lombardei abtreten musste. Mit Frankreich hatte man es sich wegen dieser Frage zumindest nicht ›verscherzt‹.
Als schließlich im Januar 1863 in Russisch-Polen ein Aufstand ausbricht, lässt Bismarck mit dem Zaren einen Beistandspakt aushandeln, der allerdings nicht militärisch umgesetzt wird. In Russland wird ihm das hoch angerechnet. In Preußen jedoch, wo viele Liberale große Sympathien für die polnische Unabhängigkeitsbewegung hegen, gilt die sogenannte ›Alvenslebensche Konvention‹ – benannt nach dem preußischen Unterhändler General Gustav von Alvensleben – nur als weiterer Beleg für Bismarcks rettungslos reaktionären Geist.
In den Beschlüssen von Bad Gastein legt Bismarck dann die Zündschnur, die mit dem richtigen Feuer das Pulver des Krieges gegen Österreich zur Explosion bringen wird. Nach dem Sieg gegen Dänemark kommt es sofort zu Streitereien zwischen den Gewinnern, wie mit den Herzogtümern Schleswig, Holstein und Lauenburg künftig zu verfahren sei. Preußen will die Eingliederung in sein Territorium, Österreich den Erhalt der eigenständigen Herzogtümer im ›Deutschen Bund‹. Am 18. August 1865 einigt man sich in einem Grandhotel im Alpenkurbad Gastein darauf, dass Schleswig preußisch und Holstein österreichisch verwaltet werden. Allerdings soll die Verwaltung in wechselseitiger Abstimmung in Form eines ›Kondominiums‹ erfolgen. Lauenburg wird Österreich abgekauft. Kiel, in Holstein gelegen, wird Bundeshafen unter preußischer Verwaltung.
Die Pflicht zur gemeinsamen Abstimmung der verwalteten Gebiete bei Streitfragen sorgt für reichlich Konfliktstoff. Außerdem betreibt Preußen die Einverleibung des eigentlich nur verwalteten Schleswigs in das eigene Territorium. Im Februar 1866 betrachten sowohl der preußische als auch der österreichische Kronrat – ein Gremium, bestehend aus Monarch, Ministern und engsten Beratern – das Konfliktpotenzial als so gewichtig, dass beide Seiten einen Krieg für unausweichlich halten. Anders als Österreich, bereitet sich Preußen ganz gezielt darauf vor. Am 8. April 1866 unterschreibt Preußen mit Italien, dem nur noch das österreichische Venetien und der Kirchenstaat zur Vollendung der Einheit fehlen, ein Geheimabkommen. Darin verpflichtet sich Italien, bis zum 8. Juli des Jahres einen gemeinsamen Krieg gegen Österreich zu beginnen! Mit diesem Vertrag bricht Preußen Bestimmungen des Deutschen Bundes. Ziel des Vertrags ist es, österreichische Truppen an der Südgrenze zu binden, um den Rest leichter im bereits geplanten Krieg schlagen zu können.
Eine weitere treibende Kraft, die den Konflikt schürt, ist der französische Kaiser Napoleon III. Er verspricht sich von einem lang anhaltenden militärischen Konflikt der beiden deutschen Großmächte deren Schwächung und Destabilisierung. Auch gegen den von einem intensiven Bruderkrieg geschwächten Sieger glaubt Napoleon die französischen Ansprüche auf linksrheinische deutsche Gebiete ohne Probleme durchsetzen zu können. Allerdings geht es Napoleon III., anders als häufig behauptet, nicht um die ganze Rheingrenze. Hier sieht er mit Recht die Gefahr, dass er sich mit diesem Ansinnen in der öffentlichen Meinung Europas ins Unrecht setzen würde. Ihm geht es um kleinere Gebietsgewinne zur Arrondierung. Die Schaffung eines neutralen Pufferstaates für den Fall, dass eine der deutschen Großmächte zu stark würde, zieht Napoleon zumindest in Erwägung. Bei seinen Plänen schielt Napoleon vor allem auf die Stimmung in Frankreich, die einen zu starken deutschen Staat fürchtet. Der Kaiser drängt Italien zum Abschluss des Vertrags mit Preußen, das er unbedingt im Krieg mit Österreich sehen will. Constantin Graf Nigra, 1866 der italienische Gesandte in Paris und ein Vertrauter des Kaisers, erinnert sich später an die Zusammenhänge: »Napoleon sagte: ›Es ist ratsam, daß Italien den Vertrag mit Preußen abschließe. Denn erst dann wird Preußen es wagen, den Kampf mit Österreich aufzunehmen. Dann erst sind die Streitkräfte égalisé […]. Während ihr Venedig gewinnt, werde ich erhalten, was ich für notwendig erachte. […] Wenn ich während dieses Kampfes 100 000 Mann in die Rheinlande einrücken lasse, kann ich die Bedingungen des Friedens vorschreiben.‹«20
Bismarck hatte Napoleon bereits 1865 in einem persönlichen Gespräch gewogen gemacht und in seinen Plänen mehr oder weniger direkt bestärkt. Vage Andeutungen Bismarcks, über linksrheinische Gebietszuwächse an Frankreich, zum Beispiel Luxemburg, oder die Schaffung eines Pufferstaats nachdenken zu wollen, wenn Frankreich in einem eventuellen preußisch-österreichischen Krieg neutral bliebe, hatten dafür ausgereicht. Dieses von Bismarck absichtsvoll genährte Trugbild französischer Landgewinne links des Rheins, von denen nach dem Sieg gegen Österreich keine Rede mehr war, sollte eine nicht unerhebliche Rolle beim Beginn des Krieges von 1870/71 spielen. Allerdings hatte der französische Kaiser nicht wirklich Grund, beleidigt zu sein. Napoleon führt gleichzeitig zur Absicherung seiner Pläne Geheimverhandlungen mit Österreich, das er noch sieben Jahre zuvor bekriegt hatte. Er treibt beide deutschen Staaten in den Krieg, denn gleich wer siegt, ihm ist vermeintlich ein Stück des linksrheinischen deutschen ›Kuchens‹ gewiss. Einen wirklich konzisen Plan hat Napoleon dabei jedoch nicht. Allerdings wird sich der Kaiser recht bald als der durch Bismarck betrogene Betrüger wahrnehmen müssen …
Mag den heutigen Leser das hier aufgezeigte Spiel mit Menschen, ihren Schicksalen, mit Ländern und dem Glück ganzer Gesellschaften befremden, so wird ihm Bismarcks Intrigenspiel des Jahres 1866 vielleicht ebenso als zynisch erscheinen. Doch in der Logik ihrer Zeit handeln die Kaiser, Könige und Staatsmänner legitim, halten sie doch Größe und Machtzuwächse ihrer Länder für Ziele, die selbst mit Lügen, Krieg und vielen Toten nicht zu teuer erkauft sind.
Nach dem Abschluss des Geheimvertrags mit Italien und den aus seiner Sicht erfolgreichen Versuchen, Frankreich aus allem herauszuhalten, muss Bismarck nur noch einen plausiblen Kriegsgrund finden und die öffentliche Meinung für sich gewinnen. Die jedoch findet wenig Gefallen an einem deutschen Bruderkrieg. Auch der liberal dominierte Nationalverein, der, das italienische Vorbild vor Augen, Krieg inzwischen durchaus für ein mögliches Mittel zur Gewinnung der Einheit hält, ist noch nicht vollständig davon überzeugt, sich ausgerechnet vom ›Konfliktminister‹ vereinigen lassen zu wollen. Zwei Jahre nach dem Krieg gegen Dänemark halten viele einen neuen Krieg für wenig erstrebenswert; vor allem jene nicht, die dafür Familie, den Hof oder das Kontor verlassen müssen, um ihn auszufechten. Wie bedeutsam gute Begründungen für den Beginn eines Krieges sind, hatte Bismarck mit dem ihm eigenen Sarkasmus bereits in einer Rede vor dem preußischen Abgeordnetenhaus im Jahre 1850 betont: »Es ist leicht für einen Staatsmann, […] mit dem populären Winde in die Kriegstrompete zu stoßen und sich dabei an seinem Kaminfeuer zu wärmen […] und es dem Musketier, der auf dem Schnee verblutet, zu überlassen, ob sein System Sieg und Ruhm erwirbt oder nicht. Es ist nichts leichter als das, aber wehe dem Staatsmann, der sich in dieser Zeit nicht nach einem Grunde zum Kriege umsieht, der auch nach dem Kriege noch stichhaltig ist.«21
Doch es fehlt an einem überzeugenden Kriegsgrund. Diesen findet Bismarck schließlich in der Schleswig-Holstein-Frage. Ohne wirklich Beweise vorzulegen, beschuldigt Preußen Österreich des Bruchs der Gasteiner Konvention. Nach weiteren preußischen Provokationen überträgt die österreichische Regierung am 1. Juni 1866 die Klärung der Frage dem ›Deutschen Bund‹ und bricht so die Beschlüsse von Bad Gastein. Preußen marschiert als Reaktion am 9. Juni in das von Österreich verwaltete Holstein ein und besetzt es. Mit dem Einmarsch in das Territorium eines Bundesmitglieds bricht Preußen für alle offen erkennbar Bundesrecht. Doch noch einmal lässt Österreich Bismarck ins Leere laufen. Die österreichischen Truppen räumen Holstein kampflos. Am 10. Juni fordert Bismarck dann mit einem weiteren vermeintlichen Reformvorschlag zur Bundesverfassung den Ausschluss Österreichs aus dem ›Deutschen Bund‹. Nun reagiert Österreich auf den Affront wie gewünscht. Am 14. Juni 1866 beschließt der ›Deutsche Bund‹ auf Antrag Österreichs den Kriegszustand mit Preußen. Alle großen deutschen Staaten stehen auf der Seite Österreichs und kommen damit ihrer vertraglich festgeschriebenen Bundespflicht nach. Nur einige kleinere deutsche Fürstentümer in Nord- und Mitteldeutschland sowie die hanseatischen Stadtstaaten halten mehr oder weniger freiwillig zu Preußen. Preußen tritt am selben Tag aus dem ›Deutschen Bund‹ aus. Formal handelt sich damit beim sogenannten ›Deutschen Krieg‹ um einen von Bismarck mutwillig vom Zaun gebrochenen Kampf Preußens gegen den ›Deutschen Bund‹ und seine vertragstreuen Staaten. In der offiziellen preußischen Proklamation zum Kriegsbeginn vom 16. Juni 1866 klingt das selbstverständlich anders: »Nachdem der ›Deutsche Bund‹ ein halbes Jahrhundert lang nicht die Einheit, sondern die Zerrissenheit Deutschlands dargestellt und gefördert, dadurch längst das Vertrauen der Nation verloren hatte und dem Auslande als die Bürgschaft der Fortdauer deutscher Schwäche und Ohnmacht galt, hat er in den letzten Tagen dazu mißbraucht werden sollen, Deutschland gegen ein Bundesmitglied in die Waffen zu rufen, welches durch den Vorschlag der Berufung eines deutschen Parlaments den ersten und entscheidenden Schritt zur Befriedigung der nationalen Forderung gethan hatte. Für den von Österreich erstrebten Krieg gegen Preußen fehlte jeder Anhalt in der Bundesverfassung. Wie jeder Grund oder auch nur scheinbare Vorwand.«22 Den ›preußischen Musketieren‹, deren Opferung Bismarck 1850 noch so vermeintlich kritisch gegenüberstand, aber auch den anderen Deutschen soll dieser Bruderkrieg als Kampf für die nationale Einheit schmackhaft gemacht werden. Weiter heißt es in der Proklamation: »Indem das preußische Volk zur Erfüllung dieser Pflicht seine Gesamtkraft aufbietet, bekundet es zugleich den Entschluss, für die im Interesse einzelner bisher gewaltsam gehemmte nationale Entwicklung Deutschlands den Kampf aufzunehmen.«23 Erst zu Beginn dieses Zweiten Einigungskrieges wird auf diese Weise Preußens Anspruch auf Führung in der militärischen Lösung der ›deutschen Frage‹ formuliert. Was das nationale Pathos der Proklamation verschweigt, ist der Umstand, dass dieser Krieg auch für massive Wirtschaftsinteressen geführt wird. Die Schwerindustrie verspricht sich von einer ›kleindeutschen‹ Lösung die Ausschaltung der österreichischen Konkurrenz bei gleichzeitiger Vereinheitlichung des Wirtschaftsraums. Stahl- und Kohlebarone kaufen vor Kriegsbeginn dem preußischen Staat ein Aktienpaket der ›Köln-Mindener-Eisenbahngesellschaft‹ ab und helfen mit 13 Millionen Talern kräftig bei der Finanzierung des Krieges mit.
Wieder zeigt sich die Überlegenheit der deutschen Rüstungsindustrie. Mit den kleineren Mächten, deren Truppen sich Preußens Regimentern in Mittel- und Süddeutschland entgegenstellen, wird ›kurzer Prozess‹ gemacht. Zwar erleiden die preußischen Truppen bei Bad Langensalza gegen das Königreich Hannover eine Niederlage, die wegen der hohen gegnerischen Verluste aber dennoch zur Kapitulation Hannovers führt. Mit Siegen in Mainfranken gegen bayerische und württembergische Bundestruppen gerät der deutsche Kriegsschauplatz schnell in die Hände Preußens und seiner Verbündeten. Die entscheidende Schlacht findet auf österreichischem Territorium, in Böhmen, statt. Unter Führung Helmuth von Moltkes, Chef des preußischen Generalstabs, hat die preußische Armee ihre Schlüsse aus den Ereignissen des Amerikanischen Bürgerkriegs gezogen und nutzt gezielt die Eisenbahn zur Truppenbewegung. Getrennt marschieren die preußischen Truppen, taktisch hervorragend geschult und hoch diszipliniert, ins österreichische Böhmen ein, um dann gemeinsam am 3. Juli 1866 bei Königgrätz (heute Hradec Králové, Tschechische Republik) zuzuschlagen. Entscheidende Vorteile der preußischen Truppen sind eine moderne Artillerie und vor allem das Zündnadelgewehr. Diese Waffe ist ein – allerdings noch fehleranfälliger – Hinterlader, der anders als das österreichische Vorderladergewehr im Liegen oder Knien geladen werden kann und so dem Infanteristen die Möglichkeit zum Schutz im Gelände bietet. Mit Preußens Sieg ist der Krieg entschieden, ebenso Österreichs Ausscheiden aus dem ›Deutschen‹ Bund. Nüchtern betrachtet der Gesellschaftstheoretiker und Kommunist Friedrich Engels das Ganze mit scharfem Blick auf die Rolle der Rüstungswirtschaft in einem Schreiben an Karl Marx vom 9. Juli 1866: »Die einfache Tatsache ist: Preußen hat 500 000 Zündnadelgewehre und die übrige Welt keine 500.«24 Das Kommende sieht Engels ebenfalls schon: »Unter 2, 3, vielleicht 5 Jahren kann keine Armee mit Hinterladern bewaffnet sein. Glaubst Du, daß Bismarck den Moment nicht ausnutzen werde?«25
»Die Welt stürzt ein« – Die Folgen des Deutschen Krieges
Etwa 1,4 Millionen Soldaten hatten Preußen und seine Verbündeten, Österreich und die Bundestruppen sowie Italien auf die Schauplätze des Krieges geschickt. Etwa 100 000 Mann wurden getötet oder verwundet. Allein die Schlacht bei Königgrätz – in Frankreich ist die Schlacht bis heute nach dem leichter auszusprechenden Örtchen Sadowa benannt – kostete an Verlusten 30 000 Mann, darunter ca. 8000 Gefallene.
Auch wenn Österreich Italien militärisch besiegt hatte, verlor es den Zweifrontenkrieg insgesamt. Die mangelnde Kampfkraft der Verbündeten auf dem deutschen Kriegsschauplatz, die verheerende Niederlage auf böhmischem Boden, die technische wie taktische Unterlegenheit gegen Moltkes weit überlegenen Generalstab und die Belastungen eines gleichzeitigen Kampfes in Nord und Süd hatten Österreich in die Knie gezwungen. Die Folgen sind tief greifend oder, wie es der Kardinal Giacomo Antonelli, Leiter der vatikanischen Außenpolitik, etwas überspitzt formuliert: »Die Welt stürzt ein.«26 Ähnlich dramatisch sieht Bismarck die Folgen. Er will dabei aber nicht passiv erleben, sondern aktiv gestalten: »Soll Revolution sein, so wollen wir sie lieber machen als erleiden.«27 Er strebt nun gezielt die deutsche Einheit an.
Mit Österreich schließt Preußen auf Drängen Bismarcks einen milden Frieden. Seinem König Wilhelm I. redet Bismarck in wieder einmal tränenreichen, mit beiderseitigen Wutanfällen geführten Auseinandersetzungen einen Triumphmarsch nach Wien und jeden Landgewinn aus. Preußen, der eigentliche Sieger, erzielt keine Landgewinne, während der militärisch unterlegene ›Waffenbruder‹ Italien das Veneto erhält. Mit dem Friedensvertrag, der am 23. August 1866 in Prag geschlossen wird, beerdigen Preußen und Österreich den ›Deutschen Bund‹. In Artikel IV des Friedensvertrages heißt es lapidar, aber in den Folgen gravierend: »Seine Majestät der Kaiser von Österreich erkennt die Auflösung des bisherigen Deutschen Bundes an und giebt Seine Zustimmung zu einer neuen Gestaltung Deutschlands ohne Beteiligung des Österreichischen Kaiserstaates.«28 Österreich zahlt darüber hinaus eine verhältnismäßig bescheidene Kriegsentschädigung. Die Frage des deutschen Dualismus ist entschieden. Jetzt muss nur noch die ›kleindeutsch‹-protestantisch-preußische Einigung vollzogen werden. Die Milde gegenüber Österreich hat in erster Linie zwei rein taktische Gründe: 1. Im nächsten Krieg wäre aus Bismarcks Sicht die Mitarbeit Österreichs oder wenigstens eine wohlwollende Neutralität wünschenswert. 2. Bismarck ist sich der französischen Ambitionen bewusst. Die Gefahr, dass Napoleon bei einem zu offensichtlichen preußischen Triumph doch noch zugunsten Österreichs eingreifen könnte, um das für ihn vermeintlich so ertragreich-lähmende deutsche Gleichgewicht zu erhalten, sieht Bismarck allzu deutlich. Der Waffenstillstand mit Österreich wird schließlich Wiens Wünschen entsprechend unter französischer Vermittlung geschlossen. Napoleon III., von den Fakten der schnellen preußischen Siege überrumpelt, akzeptiert die Bedingungen Bismarcks – Ausschluss Österreichs aus dem ›Deutschen Bund‹, preußische Annexionen in Nord- und Mitteldeutschland, Anschluss Schleswigs und Holsteins an Preußen –, drängt aber erfolgreich auf Einhaltung der Mainlinie als Grenze des preußischen Einflussbereichs. Noch sieht sich Bismarck nicht stark genug für einen Kampf gegen Napoleon. Trotz dieses kleinen diplomatischen Teilerfolgs ist Napoleon III. durch die so rasanten wie überraschenden Ereignisse des Jahres 1866 vollständig düpiert. Vor der französischen Öffentlichkeit steht Napoleon mit leeren Händen da.
Vor dem Krieg gegen Dänemark konnte, wie schon gezeigt, nicht von einem konzisen Plan Bismarcks zur militärischen Reichseinigung ausgegangen werden. Sein Handeln nach dem Sieg gegen Österreich hingegen zeigt planvolle Züge und ein erkennbares Hinarbeiten auf die ›kleindeutsche Lösung‹. Ein erster Schritt hierzu ist die ›Arrondierung‹ des verstreuten preußischen Staatsgebietes. In diesem Zusammenhang bewahrheitet sich Friedrich Engels’ Prophetie. Bismarck nutzt den Triumph der preußischen Zündnadelgewehre ohne Skrupel aus. Ganze Staaten verschwinden von der Landkarte und werden von Preußen ›geschluckt‹. Das große Königreich Hannover wird besetzt und Preußen einverleibt, das Herzogtum Nassau und Kurhessen werden ebenfalls annektiert, gleichfalls die Freie Reichsstadt Frankfurt am Main. Frankfurts Bürgermeister Karl Fellner nimmt sich aus Protest gegen die Umstände dieser Gewalttat mit dem Strick das Leben. Das Großherzogtum Hessen muss Teile seines Territoriums abgeben. Kleinere Gebietsverluste erleidet desgleichen das Königreich Bayern. Baden, Württemberg, Bayern und Hessen-Darmstadt zahlen zum Teil nicht unerhebliche Kriegsentschädigungen.
Die Vertragspolitik Bismarcks zielt nun direkt auf die Verwirklichung der deutschen Einheit. Mit den ehemaligen Kriegsgegnern Baden, Württemberg, Bayern und dem Großherzogtum Hessen werden im August 1866 und im April 1867 ›Schutz- und Trutzbündnisse‹ abgeschlossen. Zwar bestätigen sich in diesen Bündnissen die Vertragspartner wechselseitig und gleichberechtigt die Wahrung der territorialen Integrität, dass hier jedoch eine Siegermacht Besiegten die Regeln diktiert, zeigt ein wichtiges Detail. Im Fall eines Krieges gegen eine dritte Macht wird gegenseitige Militärhilfe versprochen, bei der allerdings der preußische König den Oberbefehl erhalten soll, so auch im preußisch-bayerischen Vertrag: »Es garantiren sich die hohen Contrahenten die Integrität des Gebietes Ihrer bezüglichen Länder, und es verpflichten sich im Falle eines Krieges Ihre volle Kriegsmacht zu diesem Zwecke einander zur Verfügung zu stellen. Art. 2. Seine Majestät der König von Bayern überträgt für diesen Fall den Oberbefehl über Seine Truppen dem Könige von Preußen.«29 Die großherzoglich-hessischen Truppen werden sogar der preußischen Armee eingegliedert.
So dienen die Bündnisse vor allem der Vorbereitung auf den von Bismarck nunmehr gewollten und vorbereiteten Dritten Einigungskrieg gegen Frankreich. Gleichzeitig wird im März 1867 mit Baden eine Militärkonvention abgeschlossen, die dort die Einführung der Wehrpflicht und eine Anpassung an das preußische Militärsystem beinhaltet. Mit den genannten Verträgen kann Bismarck darauf vertrauen, dass im Kriegsfall gegen Frankreich auch die süddeutschen Staaten loyal sein und ihre jeweiligen Regierungen nicht vor eventuellen antipreußischen Gefühlen ihrer Bevölkerung ›einknicken‹ würden. Dass solche ablehnenden Emotionen in Süddeutschland durchaus verbreitet waren, zeigt der ›Mahnruf‹, den Moritz Mohl, Nationalökonom aus Württemberg, 1848/49 Revolutionär, Antisemit und glühender Feind Preußens, 1867 in Stuttgart veröffentlicht. Mohl erkennt und benennt hellsichtig die Absichten Bismarcks, lehnt sie jedoch rundweg ab: »Der sogenannte Allianzvertrag vom Aug. 1866 will die süddeutschen Staaten zum Voraus verpflichten, die Kriege Preußens mitzuführen, ihre Heere im Kriege unter die Befehle des Königs von Preußen zu stellen, mithin diesem Heerfolge zu leisten. Es ist ein Vertrag, welcher Süddeutschland zum Vasallen Preußens macht. […] Er legt unser ganzes Schicksal in den Willen Preußens […].«30 Die ›Schutz- und Trutzbündnisse‹ sollten 1870 die rechtliche Grundlage für den gemeinsamen Kampf von Nord- und Süddeutschland gegen Napoleon und das Second Empire bilden.
Fundamental ist auch der innenpolitische Wandel. Es ist ein bemerkenswerter historischer Zufall, dass am Tag der Schlacht von Königgrätz Tausende Männer ihr Leben oder zumindest ihre Gesundheit lassen, und zugleich am 3. Juli 1866 in Preußen das neue Abgeordnetenhaus gewählt wird. Das Ergebnis ist wie die Schlacht ein Triumph für Bismarck. Unter dem Eindruck der preußischen Siege auf dem deutschen Schauplatz, der Besetzung Holsteins und der radikalen Änderungen in kürzester Zeit wählen die Preußen nun nicht mehr liberal, sondern konservativ. Die Mehrheitsverhältnisse werden zugunsten der Konservativen umgedreht. Es ist dieser nun mehrheitlich konservative Landtag, der mit Bismarck die entscheidenden Weichen stellen wird. Allerdings differenziert sich auch die Zusammensetzung der beiden Lager als jeweils ›liberal‹ und ›konservativ‹. Anlass der Spaltungen innerhalb der Lager ist ein raffinierter Schachzug Bismarcks. Am 14. September 1866 legt Bismarck dem erstaunten Abgeordnetenhaus ein Gesetz vor, das den sperrigen Titel ›Gesetz betreffend die Ertheilung der Indemnität in Bezug auf die Führung des Staatshaushalts vom Jahre 1862 ab und Ermächtigung zu den Staatsausgaben für das Jahr 1866‹ trägt. In diesem Gesetz gibt die Regierung in Artikel 2 zu, seit 1862 ohne rechtliche Grundlage den Haushalt verwaltet zu haben, bittet aber gleichzeitig um Indemnität, also Verschonung vor rechtlicher Verfolgung. Angesichts der Tatsache, dass Bismarck immerhin zwei Kriege geführt und bezahlt hat, ohne über ein legales Budget verfügt zu haben, stellt diese Bitte, seine Politik um den geringen Preis der Zugabe eines ohnehin offensichtlichen Rechtsbruchs rückwirkend zu bestätigen, einen bis zur Unverschämtheit kühnen Schritt dar. So sehen es auch viele der Abgeordneten des preußischen Abgeordnetenhauses. Jedoch erhält Bismarck seine gewünschte Absolution mithilfe abtrünniger Liberaler. Angesichts der Erfolge Preußens und der nun nicht mehr fern scheinenden deutschen Einheit unter Preußens Führung mag manchen die Frage über die Rechtmäßigkeit eines Staatshaushalts kleinlich erscheinen. Dennoch spaltet der Vorgang die Fortschrittspartei. Rechts von ihr entsteht 1867 die ›Nationalliberale Partei‹, die vorbehaltlos Bismarcks Kurs stützen, dabei aber zugleich auf die Einhaltung liberaler Grundideen pochen möchte. Aber sogar unter den Konservativen ist Bismarck umstritten. Vielen gilt er mit Recht als Revolutionär und die Bitte um Vergebung einer Rechtsbeugung erscheint ihnen als etwas, was kein Konservativer mit Anstand, kein Preuße ›von altem Schrot und Korn‹ auch nur in Erwägung ziehen kann. Deutlich wird dies in der scharfen Kritik, die Ernst Ludwig von Gerlach, erzkonservativer, radikal-christlicher Bekämpfer des Liberalismus, Mitglied im preußischen Abgeordnetenhaus und Mitbegründer der ›Kreuzzeitung‹ anonym in einem 1866 veröffentlichten Beitrag gegen seine eigenen konservativen Kollegen schreibt. Ihn treibt die Sorge um den Erhalt des Königtums um: »Um die mehrjährige Regierung ohne Etatsgesetz zu decken, ist ›Indemnität‹ erteilt worden. Die Conservativen haben versucht, den natürlichen Sinn dieses Wortes durch allerlei wohlgemeinte mehrdeutige Redewendungen zu mildern: man sei ›außerhalb‹ der Verfassung gewesen und dergleichen. Die bisherigen Gegner der Regierung dagegen haben den natürlichen Sinn festgehalten, dahin: daß die Regierung vier Jahre lang die Verfassung widerrechtlich verletzt habe. […] Und die Conservativen, die als practische Männer, mit Vergnügen Prinzipien aufgeben für allernächste kleine Erfolge, sind mit wenigen Ausnahmen nicht unzufrieden mit solcher Behandlung, soweit das ›Bravo rechts‹ einen Schluß erlaubt. Man sollte sie statt: practische Männer, lieber kurzsichtige Männer nennen. Gern haben unter diesen Umständen die Gemäßigteren unter den bisherigen Gegnern der Regierung Indemnität gewährt; sie haben eben dadurch das ihnen bisherig bestrittene Recht ausgeübt und finden dadurch bestätigt, was sie 1862–1866 behauptet haben und eben so lange conservativerseits ihnen bestritten worden ist, daß nämlich allein das Abgeordnetenhaus allein endgültig zu bestimmen habe, welche Ausgaben nicht dürfen geleistet werden […]. Dieser angeblich ›theoretische‹ Streit ist derselbe Streit, der das gesammte neunzehnte Jahrhundert bisher durchdrungen hat […]. Wer ihn ›unerquicklich‹ findet, beweist damit, daß er es nicht als Ehre und Freude empfindet, das Vaterland und besonders unser Königthum zu verteidigen gegen seine inneren Widersacher.«31 Vielen anderen Konservativen gilt Bismarck indes als nationaler Heilbringer. So gründet sich links von den Altkonservativen die ›Freikonservative Partei‹, die Bismarcks ›sans phrase‹ unterstützt. Auch die Mehrheit der Katholiken im Abgeordnetenhaus, die bisher ›großdeutsch‹ dachten und es mit dem katholischen Österreich gehalten hatten, macht nun ihren Frieden mit Bismarck. Opposition von links kommt noch von einigen Mitgliedern aus der Fortschrittspartei, von rechts von den Altkonservativen. Zwar haben sich Radikaldemokraten und altpreußische Konservative wenig zu sagen, in der Ablehnung des umstürzlerischen Kanzlers sind sie sich, wenn auch aus ganz unterschiedlichen Gründen, einig. Allerdings verkennen sie die Zeichen der Zeit, die nicht mehr auf freiheitliche Ideale oder die Bewahrung alter Traditionen setzt, sondern den nationalen Aufbruch herbeisehnt. Den neuen Pragmatismus der Macht um der Einheit willen fasst der Nationalliberale Johannes Miquel in einer programmatischen Erklärung zusammen: »Die Zeit der Ideale ist vorüber. Die deutsche Einheit ist aus der Traumwelt in die prosaische Welt der Wirklichkeit hinuntergestiegen. Politiker haben heute weniger zu fragen, was wünschenswert, als was erreichbar ist […].«32
Die Stimmen der Opposition dringen in Preußen so immer weniger durch. Dass dafür manches aufgegeben werden muss, wofür 1848/49 noch gekämpft wurde, sehen viele Bismarck-Jünger durchaus, schätzen diesen Verlust aber geringer ein als den möglichen Gewinn einer deutschen Einheit. Dass sich viele dieser parlamentarischen Anhänger des Kanzlers als Geschäftsleute auch wirtschaftliche Fortschritte von der deutschen Einheit versprechen, macht es für viele noch leichter, die Bedenken zu verdrängen.
Die Gründung des ›Norddeutschen Bundes‹
Die spektakulärste Neuerung nach dem Sieg gegen Österreich ist die Gründung des ›Norddeutschen Bundes‹. Dieser kurzlebige ›Norddeutsche Bund‹ ist der unmittelbare Vorläufer des ›Deutschen Reichs‹. Seine Funktion liegt von Beginn an in der Vorbereitung eines Einheitsstaats, der auch die süddeutschen Länder umfassen soll. Für die Vorbereitung dieses Bundes kann sich Bismarck vor allem auf die Hilfe der neuen Gruppierungen im Landtag verlassen. Freikonservative und Nationalliberale unterstützen Bismarcks Pläne. Bismarcks Ziel ist es, Preußens Vormachtstellung in einem künftigen ›Deutschen Reich‹ zu wahren. Nach dem Sieg der preußischen Waffen 1866 gibt es keine Macht in Deutschland, die ihn daran hindern kann, einen dafür passenden Rahmen zu schaffen. Im Jahr 1866 schließen bis zum 21. Oktober 21 deutsche Staaten mit dem Hegemon Preußen ein Bündnis, das den Namen ›Norddeutscher Bund‹ erhält. Das Königreich Sachsen, das nur mithilfe Österreichs in den Friedensverhandlungen nach dem Deutschen Krieg seine Eigenständigkeit behalten konnte, tritt als letztes Land bei. In allen 22 deutschen Staaten nördlich der Mainlinie finden am 12. Februar 1867 allgemeine, gleiche und direkte Wahlen zu einem konstituierenden ›Reichstag‹ des ›Norddeutschen Bundes‹ statt. Hessen-Darmstadt, das vom Main durchtrennt wird, gehört allerdings nur mit dem nördlichen Teil dem Bündnisgebiet an.
Am 24. Februar 1867 wird der verfassunggebende Reichstag in Berlin durch den preußischen König Wilhelm I. eröffnet. Ihm wird am 4. März ein Verfassungsentwurf vorgelegt, den der preußische Publizist, Historiker und altliberale Geheimrat Maximilian Duncker vorbereitet, Bismarck überarbeitet und mit den beteiligten Regierungen abgestimmt hat. Die Verfassung sieht eine föderale Struktur vor, bestehend aus den weiter bestehenden Parlamenten der Mitgliedsstaaten, den Staatsregierungen, dem frei und geheim von allen Männern ab 25 Jahren zu wählenden Reichstag und einem Bundesrat. Während viele Fragen weiter der Regelung der Einzelstaaten unterstehen, sollen Reichsangelegenheiten auf Ebene des Reichstages und des Bundesrates entschieden werden. Der Reichstag erhält insbesondere Budgetrecht und Mitwirkungsrechte unter anderem in Fragen des Verkehrswesens, der Handelspolitik und des Rechtswesens. Dem Reichstag ist der Bundesrat zur Seite gestellt, in den aber nicht die Vertreter der Einzelparlamente, sondern die weisungsgebundenen Vertreter der überwiegend monarchischen Regierungen entsandt werden. Gesetze sollen mit Mehrheiten in beiden Kammern verabschiedet werden. Die erdrückende Dominanz Preußens – 25 der 30 Millionen Einwohner des ›Norddeutschen Bundes‹ sind Preußen – kommt in der Zusammensetzung des Bundesrats nicht gleichermaßen zum Ausdruck. Die 17 preußischen Vertreter im 43 Köpfe umfassenden Gremium besitzen jedoch eine Sperrminorität, da Verfassungsänderungen nur mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden können. Sachsen entsendet vier Vertreter, Braunschweig und Mecklenburg-Schwerin je zwei. Alle anderen Länder schicken einen Vertreter in den Bundesrat, der so ganz ein Instrument preußischen Herrschaftswillens ist und gegen den sich faktisch keine Mehrheiten organisieren lassen. Zugleich sichert der Bundesrat als Gremium der Landesregierungen den norddeutschen Monarchen die Kontrolle über die Entwicklung in Deutschland, kann der Reichstag doch nichts gegen den Willen des Bundesrats entscheiden. Das Bundespräsidium, das Bundesrat und Reichstag beruft, steht selbstverständlich dem König von Preußen zu, der auch den Oberbefehl über das Heer erhält und den Bund nach außen vertritt. Die Geschäftsführung des Bundes soll der Bundeskanzler innehaben, der nur vom preußischen König benannt und entlassen werden kann. Die Einheit Deutschlands als ein monarchisch geprägtes und bestenfalls halbdemokratisches ›Großpreußen‹ wird so bereits in der Verfassung des ›Norddeutschen Bundes‹ angelegt.
Allerdings leisten die Liberalen energischen Widerstand gegen Bismarcks Absicht, eine Verfassung ohne verantwortliche Minister vorzulegen. Sie erzwingen, dass Anordnungen des Bundespräsidiums vom Kanzler gegengezeichnet werden müssen und geben Bismarck damit, möglicherweise ungewollt, mehr Macht in die Hände, als der eigentliche Verfassungsentwurf vorsieht. Zudem sorgen die Liberalen dafür, dass der Bundeshaushalt jährlich genehmigt werden muss und die Abgeordneten Immunität besitzen. Eine wichtige Rolle bei den Verfassungsänderungen spielt der Nationalliberale Rudolf von Bennigsen.
Am 16. April 1867 wird der Verfassungsentwurf mit 230 zu 53 Stimmen angenommen und am 1. Juli des Jahres der ›Norddeutsche Bund‹ als deutscher Bundesstaat etabliert. Die Fahne des Bundes trägt in drei horizontalen Balken die Trikolore Schwarz-Weiß-Rot und verweist damit auf das preußische Schwarz-Weiß und die hanseatisch-norddeutschen Farben Rot-Weiß. Die schwarz-rot-goldenen Farben der bürgerlichen Revolution von 1848 werden bewusst verschmäht. Zur Machtzentrale des Bundes wird das Bundeskanzleramt, das der Ministerialdirektor des preußischen Handelsministeriums, Rudolph Delbrück, leitet. Delbrück, der bereits eine wichtige Rolle bei der Ausweitung des Zollvereins gespielt hat, wird zur ›rechten Hand‹ Bismarcks und betreibt zielstrebig eine Vereinheitlichung des Bundes in Fragen des Handels, der Justiz und des Post- wie Telegrafenwesens. Einen wichtigen Beitrag zur faktischen, aber auch ideellen Einheit leisten daneben die Artikel der Verfassung des ›Norddeutschen Bundes‹ zum Militärwesen. Besonders zu nennen ist die Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht, der sich niemand mehr durch Privilegien entziehen kann: »Artikel 57: Jeder Norddeutsche ist wehrpflichtig und kann sich in Ausübung dieser Pflicht nicht vertreten lassen.«33 Daneben leistet Artikel 63 eine wichtige Vorarbeit für die Ereignisse der Jahre 1870/71: »Die gesammte Heermacht des Bundes wird ein einheitliches Heer bilden, welches in Krieg und Frieden unter dem Befehle seiner Majestät des Königs von Preußen als Bundesfeldherrn steht.«34 Zur Durchsetzung dieses Verfassungsanspruchs schließt Preußen mit den Staaten des ›Norddeutschen Bundes‹ Militärkonventionen ab. Mit diesen Artikeln und Konventionen ist Wilhelm I. die größte Streitmacht Europas in die Hände gegeben. Der König von Preußen wird diese durch die Heeresreform umfassend modernisierte und ihre überragenden Erfolge selbstbewusst gewordene Streitmacht 1870 eindrucksvoll ins Feld führen.
Widerstreitende Kräfte – Die Schwierigkeiten der Jahre 1867 bis 1870
Im Nordteil Deutschlands ist nun also ein mächtiger, von Preußen dominierter Staatenbund entstanden. Nicht allen Menschen im Süden und auch nicht allen Nachbarstaaten gefällt diese Entwicklung. Dennoch regelt die Verfassung des ›Norddeutschen Bundes‹ bereits im Vorgriff den außerhalb Süddeutschlands mehrheitlich gewünschten weiteren Gang der Ereignisse. In Artikel 79 heißt es: »Der Eintritt der Süddeutschen Staaten oder eines derselben in den Bund erfolgt auf den Vorschlag des Bundespräsidiums im Wege der Bundesgesetzgebung.«35 Der Weg bis zum tatsächlichen Beitritt der süddeutschen Länder und damit zur Reichsgründung ist allerdings noch dornenreich. Das zeigt sich unmittelbar schon in den ersten Jahren nach dem Krieg von 1866.
Ein Plan Bismarcks, die süddeutschen Staaten auf friedlichem Weg näher an den ›Norddeutschen Bund‹ heranzuführen, besteht darin, zuerst ein gemeinsames Zollparlament zu schaffen. 85 Abgeordnete aus Bayern, Hessen, Baden und Württemberg sollten zu den Abgeordneten des ›Norddeutschen Bundes‹ hinzugewählt werden und mit diesen gemeinsam über Fragen der wirtschaftlichen Vereinheitlichung entscheiden. Die schon gewählten Mitglieder des Reichstags sind automatisch ebenfalls im Zollparlament vertreten. Gleichzeitig will Bismarck mit diesem Schachzug die Partikularisten schwächen und politisch in die Defensive bringen. Bei den Wahlen zum Zollparlament im Februar 1868 bekommen jedoch völlig unerwartet partikularistisch orientierte Politiker, also Freunde der deutschen Mehrstaatlichkeit, die Oberhand. Gemeinsam mit auch im Norden anzutreffenden Gegnern der preußischen Dominanz bilden sie nun die Mehrheit im Zollparlament. Vor allem im ehemaligen Königreich Hannover ist der Zorn über die kalte Annexion durch Preußen noch nicht verraucht und auch die Katholiken verfolgen die preußisch-protestantische Einigungspolitik mit Misstrauen. Kopf der norddeutschen Bismarck-Gegner ist der ehemalige hannoversche Justizminister und bekennende Katholik Ludwig Windhorst. Das Zollparlament erweist sich so als untauglicher Motor eines friedlichen Ausgreifens des ›Norddeutschen Bundes‹ in den Süden.
Auch von altpreußisch-konservativer Seite weht Bismarck der Wind entgegen. Sein schärfster Kritiker ist hier wieder Gerlach. Dieser schreibt im Dezember 1867 in einem Brief: »Daß Hannover, Nassau und Frankfurt ganz nach den Regeln der Naturgeschichte von Bismarck gefressen wurden, daran habe ich nicht den leisesten Zweifel. Mein Schmerz ist kein sentimentaler Schmerz, daß es kein Hannover, Nassau und Frankfurt mehr gibt, sondern der Schmerz eines preußischen, deutschen Christen, daß meine Partei und mein Vaterland Preußen so schmählich die zehn Gebote Gottes verletzt und durch das Laster des Pseudopatriotismus Schaden an seiner Seele genommen und sein Gewissen befleckt hat.«36 Zwar ist Gerlachs Haltung in einer Zeit, in der die rasante ökonomische Entwicklung auch politische Antworten braucht, in der Bismarcks Imperialismus, wie ein Historiker später urteilte, dem Zeitalter der kapitalistischen Expansion auf den Leib zugeschnitten ist, ein fast schon lächerlicher Anachronismus. Obendrein argumentieren andere Stimmen ähnlich. Auch sie zeigen, dass die in der Rückschau in Hunderten von prachtvollen Erinnerungsbüchern zur Reichseinigung suggerierte patriotische Zustimmung aller Deutschen zum Weg Bismarcks selbst für den ›Norddeutschen Bund‹ nur retrospektive Propaganda war. Doch am prägnantesten bleibt Gerlach. Er sieht in Bismarcks Tun nichts weniger als Gotteslästerung: »›Nationale Bedürfnisse und Forderungen‹ – ›welthistorische Momente und welthistorische Mission‹ – ›providentieller Beruf und providentielle Ziele‹ – diese und alle ähnlichen Ideen haben sich tief unterzuordnen unter die heilige Majestät der Gebote Gottes, derselben Gebote, die das Dorfkind in der Schule lernt, deren Tiefe und Höhe kein menschlicher Geist zu ermessen ausreicht.«37 Solche Kritik aus dem eigenen Lager, dem sich Bismarck in seinen Grundüberzeugungen zugehörig fühlt, dürften den durchaus religiösen ›Macher‹ der ganzen Entwicklung nicht unberührt gelassen haben. Gerlach, den radikalen Gegner seiner einigungstrunkenen Gegenwart, betrachtet Bismarck wohl gerade deswegen als seinen persönlichen Feind.
Eine große Menge an Menschen in Süddeutschland fürchtet Preußens neue militärische Macht. Vermögende junge Männer aus Baden fliehen vor der durch die Militärkonvention vom März 1867 verfügte Wehrpflicht ins Ausland. In den Überseehäfen wächst ab 1867 die Zahl auswanderungswilliger Männer im wehrfähigen Alter.
Neben diesen Misserfolgen müssen Preußen und Bismarck auch noch mit ansehen, wie das 1866 geschlagene Österreich und Frankreich gemeinsame Pläne schmieden, um einen Anschluss der Südländer an den Bund zu verhindern. Überlegungen zu französisch-österreichischen Handels- und Militärverträgen machen die Runde. Bei Kammerwahlen in Württemberg und Bayern siegen zudem ›großdeutsch‹ orientierte Politiker, und die allgemeine Stimmung in den Ländern ist wenig preußenfreundlich. Niemand will sich »borussoficieren«38 lassen. Trotz der durch die ›Schutz- und Trutzbündnisse‹ eingeleiteten militärischen Anbindung der Süddeutschen an den Norden und die fortschreitende wirtschaftliche Vereinheitlichung des deutschen Raums ist es am Ende der 60er-Jahre des 19. Jahrhunderts keineswegs ausgemacht, dass der ›Norddeutsche Bund‹ nur wenige Jahre nach seiner Gründung zugunsten des ›Deutschen Reichs‹ aufgelöst werden wird. Dennoch hat Bismarck aus seiner Sicht eine gute Ausgangslage für den letzten entscheidenden Schritt geschaffen. Was jetzt noch fehlt, ist ein Ereignis, das den patriotischen Elan der Süddeutschen in Schwung bringt und gleichzeitig die dort verantwortlichen Regierungen an die Seite Preußens zwingt. Es fehlt der Krieg, den die ›Schutz- und Trutzbündnisse‹ geradezu herbeibeschwören: der Krieg gegen Frankreich. Allerdings müssen Zeitpunkt und Anlass stimmen.
Das Second Empire
In Frankreich fühlt man sich von den Ereignissen des Jahres 1866 betrogen. Sollten sich doch eigentlich die Deutschen gegenseitig bekriegen, damit Frankreich auf den Trümmern des Reichs seine ›Gloire‹ steigern und die Territorien am Rhein gewinnen konnte. Nun muss man aber sehen, dass Bismarck das Spiel nach seinen Regeln spielen will. Der Ruf nach ›Rache für Sadowa‹ wird in der nationalistischen Presse Frankreichs laut. Was ist das für ein Staat, dieses Second Empire – das Zweite Französische Kaiserreich?
»Napoleon ohne Schminke« – Das politische System des Second Empire
In einem anonymen polemischen Pamphlet, das unter dem Titel ›Napoleon ohne Schminke‹ kurz nach dem Tod des ehemaligen Kaisers erschienen ist, wird Widersprüchliches über den Neffen Napoleons I. mitgeteilt. Zugleich werden wichtige Stationen und Prinzipien seiner Herrschaft angesprochen, die Napoleon III. im Dezember 1851 nur durch einen nachträglich mittels einer Volksabstimmung scheinlegitimierten Staatsstreich erringen konnte: »Louis Napoleon wurde Kaiser und wenn wir bei der Abstimmung eine Million Stimmen als erschwindelt bezeichnen, so können doch alle Tadler nicht die Thatsache abstreiten, daß die überwiegende Mehrzahl der Franzosen mit diesem Resultat der Abstimmung zufrieden waren. […] Wodurch hatte Napoleon das Ziel seiner Wünsche erreicht? Dadurch, daß er Allen und Jedem schmeichelte, nach allen Seiten hin Alles versprach; die naturnothwendige Folge hiervon war, daß er – mochte er handeln wie er wollte, immer Unzufriedene erzeugte, die Fug und Recht hatten, ihn eines nichtgehaltenen Versprechens zu bezichtigen. […] Und nicht in Abrede zu stellen ist, daß er sich in jener Zeit einer enormen Beliebtheit in den unteren Schichten der Bevölkerung und in den Kreisen der Industrie sowohl, als auch der Armee zu erfreuen hatte […] Nachdem der Kaiser die […] Armee wieder auf die Höhe gebracht – welche ihm – einem Napoleoniden – nöthig erschien, war ein Krieg unvermeidlich, weil Bedingung der Selbsterhaltung für den Kaiser. […]. Was aber Napoleon III. zur Erhöhung des allgemeinen Wohlstandes gethan, ist enorm.«39
Erscheint Napoleon dem anonymen Pamphletisten als zwar durchaus intelligente, aber letztlich eher schwache, nicht wirklich böse Figur, findet er scharfe Worte für dessen Gattin Eugénie: »Die Devise der Bonaparte ist: Prostitution. Mit diesem Schandtreiben erzielte aber die Kaiserin nicht nur, daß sie die Frauen kirrte, sondern sie erreichte auch, daß durch den sardanapalischen40 Luxus, der getrieben wurde, die Industrie einen vorher nicht gekannten Aufschwung nahm. Dies söhnte sie aus mit Vielen. Der von ihr eingeführte Luxus, dem bald die ganze Welt, nicht blos Frankreich fröhnte, schaffte Brod, ja Wohlstand und damit Vergessenheit der früheren Aber gegen die Kaiserin.«41 Insgesamt ist das Urteil über die Regierung des Kaisers, den der Anonymus ›ohne Schminke‹ zeigen will, bei aller Anerkennung sozialpolitischer Verdienste, eindeutig negativ. Für den deutschen Sieg im Krieg von 1870/71 wird vor allem wieder Eugénie verantwortlich gemacht: »Hier rächte sich die Entsittlichung, die der Kaiser und die Kaiserin der Nation planmäßig eingeimpft. […] Die Liederlichkeit in der Verwaltung, die Unzuverlässigkeit der Intendanturen, die Unfähigkeit der Gewalthaber, – sie waren nur die Folgen des entsittlichenden Einflusses, den der wieder zum Throne gelangte Napoleonide und seine bonapartistisch denkende Gemahlin im Selbsterhaltungstrieb geltend gemacht. […] Freilich hat dieser Krieg haarsträubende Uebelstände blosgelegt, an denen Frankreich, bis dahin die erste europäische Nation, krank war bis in’s Mark […].«42
Der übelwollende Zeitgenosse Napoleons verweist auf gleich mehrere wichtige Punkte in Napoleons Biografie und Politik: eine inkongruente Ideologie, die zu widersprüchlichem Handeln führt, Heischen um Beliebtheit bei den unteren Klassen, Hervorhebung der Rolle des Militärs, eine einflussreiche Ehefrau, die Förderung von Konsum und Luxus, Vernachlässigung der Verwaltung zugunsten einer wenig effektiven Günstlingswirtschaft, Inszenierung eines anachronistischen Kaiserkults.
»Bonaparte als die verselbständigte Macht der Exekutivgewalt fühlt seinen Beruf, die ›bürgerliche‹ Ordnung sicherzustellen. Aber die Stärke dieser bürgerlichen Ordnung ist die Mittelklasse. Er weiß sich daher als Repräsentant der Mittelklasse und erläßt Dekrete in diesem Sinne.«43 So urteilt Karl Marx in seiner Schrift über den Staatsstreich Napoleons III. Tatsächlich ist es aber gerade nicht die Mittelklasse, die im neuen Kaiserreich profitiert. Durch eine Wirtschaftspolitik, die über öffentliche Aufträge und damit über Schulden sowie eine großzügige Kreditpolitik gesteuert werden soll, wird ein Finanzboom ausgelöst, der vor allem Spekulanten bei Insidergeschäften Gewinn bringt. Neben den alten Adel treten nun die ›Nouveau riches‹, die ›Zu-Geld-Gekommenen‹, und dominieren gemeinsam mit Politgewinnlern und Verwaltungskarrieristen, die im neuen Regime eine Aufstiegschance erblicken und ergreifen, die politische Kultur, den Hof und das gesellschaftliche Leben. Um dazuzugehören, schmücken sich viele der zu Kapital und Einfluss Gekommenen sogar mit falschen Adelstiteln. Der französische Romancier Guy de Maupassant hat in der Figur des ›Bel Ami‹ diese Sorte der Emporkömmlinge mit scharfem Spott beschrieben. Auch wenn der gleichnamige Roman erst einige Jahre nach dem Ende des 2. Kaiserreichs erschienen ist, karikiert er doch genau jenen Typus des Aufsteigers, wie er seit Napoleon III. in Frankreich anzutreffen ist. Der Journalist Georges Duroy, der durch Intrigen zu Einfluss gekommen ist und im Verlauf des Romans durch unsaubere Finanzgeschäfte reich wird, macht sich auf Druck seiner mondänen Verlobten ebenfalls zu einem erfundenen Edelmann: »Ja, mein Lieber, ich bin wie alle Frauen, ich habe … meine Schwächen, meine Eitelkeit. Ich liebe alles, was glänzt, alles, was einen Klang hat. Gern hätte ich einen adeligen Namen gehabt. Könnten Sie sich nicht gelegentlich unserer Hochzeit ein wenig adeln? […] Er antwortete einfach: Daran habe ich schon öfter gedacht, aber so einfach ist das wohl nicht. ›Wieso denn?‹ Er begann zu lachen. ›Weil ich fürchte, mich lächerlich zu machen.‹ Sie zuckte mit den Schultern. ›Aber durchaus nicht … Jeder tut es, und kein Mensch lacht darüber. Sie brauchen nur Ihren Namen in zwei Teile zu zerlegen: Du Roy. […] Voller Überzeugung fügte sie hinzu: Und Sie sollen mal sehen, wie schnell die Leute sich daran gewöhnen.«44
Motor und zugleich Spiegel dieser Verhältnisse sind der überbordende Luxus am Hof und die dort gehaltenen prachtvollen Bälle. Napoleons III. überaus energische Gattin Eugénie, eine spanisch-schottische Grafentochter, ist eine bemerkenswerte Person, über die sich schon die Zeitgenossen teils bewundernd, teils hämisch äußern. Mit der Kaiserin werden die Feiern des Hofes und Eugénies modische Vorlieben sogar zu einem Faktor, der die Textilindustrie Frankreichs belebt. Frauen, die sich für gut situiert halten, müssen dem Vorbild der Kaiserin nacheifern und dem neuesten Trend folgen, den Eugénie vorgibt. Eine ›Entsittlichung‹, wie sie der anonyme Kritiker gesehen haben will, wird durch Eugénie aber sicher nicht gefördert. Die feierliche Pracht kommt jedoch nicht nur den Bedürfnissen der neuen Funktions- und Geldeliten im Kaiserreich und des ›Partygirls‹ Eugénie entgegen, sondern sie entspricht auch der Notwendigkeit der imperialen Repräsentation des Zweiten Kaiserreichs. Dieses Repräsentationsbedürfnis drückt sich ebenso in zahlreichen öffentlichen Festen aus, in denen sich das Regime als spendabel und human feiern lässt. Hiervon und von der großen Bedeutung, die der ständige Bezug auf Napoleon I. für das Second Empire besitzt, gibt der später ausgewiesene Schriftsteller Ebeling ein beredtes Zeugnis. Im Jahr 1854 wird der Geburtstag Napoleons I., der 15. August, mit einer großen Feier in Paris begangen. Ebeling beschreibt: »Massenhafte Brot- und Fleischverteilungen an die Armen […], Speisung von ganzen Regimentern mit Braten und Wein auf dem Marsfelde, ebendaselbst Puppentheater und Schaubuden, Klettermasten mit ansehnlichen Silberpreisen, Karussells und russische Schaukeln, und selbstverständlich alles gratis. […] Abends zwei große Feuerwerke, eines im Osten, eines im Westen von Paris, um die Menschenmassen zu verteilen, und allgemeine Illumination, die sich in jenem Jahre, wo die Begeisterung für den ›Retter der Gesellschaft‹ noch frisch war, bis in die entlegensten Stadtviertel erstreckte. Nebenbei bemerkt, kostete jedes Feuerwerk 40 000 Franken, und bei jedem bildete das sogenannte ›bouquet‹ den Schluß: dreitausend Soldaten schossen auf einmal ebenso viele mit Leuchtkugeln gefüllte Raketen in die Luft.«45 Bei den zahlreichen Feiern dieser Art treten auch stets die beiden wichtigsten Systempfeiler des Regimes in Erscheinung: Die katholische Kirche, die sich bedingungslos den neuen Verhältnissen unterwirft, und die Armee, deren öffentliche Wahrnehmung und Funktion im Staat durch Paraden und eine große öffentliche Präsenz Uniformierter im Alltag im Vergleich zu vorher stark gestiegen ist.
Von der staatlichen Schuldenpolitik sollen aber ebenso die unteren Einkommensschichten profitieren, schafft das staatliche ›Deficit spending‹ doch schließlich auch Arbeit, die allerdings in der Regel nicht angemessen bezahlt wird. Von Streikrecht, Arbeitslosenunterstützung oder Arbeitsschutz bei gefährlichen Tätigkeiten ist Frankreich wie die ganze Welt in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch weit entfernt. Ein Beispiel für staatliche Förderpolitik der Privatwirtschaft ist die Modernisierung des mittelalterlichen Paris im Sinne moderner Urbanität durch den Präfekten Georges-Eugène Haussmann. Das gigantische Projekt, durch das die heutige Anmutung von Paris mit seinen breiten Boulevards und neoklassizistischen Wohnblockbebauungen geprägt ist, kostet zwar Unsummen, ist aber zugleich ein wichtiger Motor der Wirtschaftsförderung. Dazu werden andere Großstädte in der Provinz nach dem Muster von Paris modernisiert und profitieren so vom Modernitätsschub, den das Zweite Kaiserreich durchaus auch hervorbringt.
Besonderen Gewinn jedoch zieht die Schwerindustrie aus dem napoleonischen Regime. Durch Zoll- und Steuersenkungen werden gezielte Hilfen für die Privatindustrie geleistet, damit diese Gelder in die für ein stetiges Wirtschaftswachstum notwendige Infrastruktur, zum Beispiel in den Eisenbahnbau, und die weitere Erschließung der Rohstoffvorkommen investieren kann. Durch das Wirtschaftswachstum soll dann das Problem der Armut und Ungleichheit gelöst werden. In der Tat erfährt das Land einen eindrucksvollen Aufschwung: das Eisenbahnnetz wird ausgebaut, die Zahl der Kohlegruben und Metallfabriken wächst enorm, die Stahlproduktion steigt, Hafenstädte werden gezielt gefördert. Die sozialen Probleme werden aber nicht eigentlich gelöst. Napoleons wirtschaftsliberale Annahme, dass eine florierende und freie, um nicht zu sagen schrankenlose Ökonomie automatisch auch die Lebensverhältnisse der ihre Arbeitskraft verkaufenden Proletarier, der Bauern und kleinen Angestellten verbessere, geht an den Realitäten vorbei. Der entfesselte Finanz- und Industriekapitalismus schaut immer und zu jeder Zeit ausschließlich auf seine Interessen, nicht auf jene der ihre Haut oder ihr mühsam Erspartes zu Markte tragenden Menschen.
Als besonders problematisch für das Second Empire – der anonyme Kritiker hat das deutlich hervorgehoben – erweisen sich Klientelismus und Korruption in Verwaltung und Wirtschaft. Minister nutzen ihre politische Funktion schamlos zur persönlichen Bereicherung. Ämter und Offizierspatente werden gekauft oder nach Loyalität zum Kaiserhaus, nicht nach Leistung vergeben. Der Wille zur Bereicherung der neuen ›Eliten‹ durchdringt den ganzen staatlichen Verwaltungsapparat von oben nach unten. Diese strukturellen Mängel werden eine erhebliche Rolle im Krieg spielen. Sie bewirken aber auch auf Dauer einen wirtschaftlichen Abschwung, der zugleich mit der steigenden Staatsverschuldung das Kaiserreich in den 1860er-Jahren zunehmend bei den Franzosen in Misskredit bringt.
Politisch ist das Empire in seiner ersten Phase ein autoritärer Staat, der auf Grundlage von Plebisziten regiert wird. Die gesetzgebende Kammer, ›Corps législatif‹, hat keine wirkliche Kontrollfunktion, wichtige Fragen werden direkt über gesteuerte Volksentscheide entschieden. Im Oberhaus, dem Senat, sitzen von Napoleon persönlich auf Lebenszeit ernannte Handlanger des Regimes, die alle Entscheidungen abnicken und ihre politische Funktion vor allem für Geschäfte nutzen. Minister sind nur dem Kaiser verpflichtet. Die Pressefreiheit ist stark eingeschränkt. So bestimmt eine merkwürdige Mischung aus direkter Demokratie, die den Kaiser stets zwingt, Rücksicht auf die öffentliche Meinung zu nehmen beziehungsweise diese zu manipulieren, und Diktatur das Herrschaftssystem. Der starke Mann Napoleons in der Innenpolitik ist sein Halbbruder Charles Auguste Louis Joseph de Morny, zuerst Innenminister, später Präsident des ›Corps législatif‹. Morny nutzt seine politischen Funktionen hemmungslos für seine Geschäfte, womit er ein weithin wahrgenommenes und tausendfach kopiertes Negativbeispiel für viele Funktionsträger des Kaiserreichs abgibt.
Erst in den 60er-Jahren, als sich die politische Opposition angesichts der Wirtschaftsprobleme und außenpolitischer Fehlschläge wieder allmählich neu formiert und zahlreiche Streiks die sich verschärfenden sozialen Probleme offenlegen, lockert der Kaiser das Regime und macht demokratische Zugeständnisse. Diese zweite Phase des Second Empire gilt als dessen sogenannte ›liberale‹ Phase. Sie ist zugleich die letzte des Regimes.
Triumphe und Pleiten – Napoleons Außenpolitik
Es läge nahe, dass sich der Neffe Napoleons I. und selbsternannte Erbe des großen Korsen, vor allem über Kriege als der ›Grandeur‹ seiner Nation und dem Andenken seines Onkels würdig erweisen will. Tatsächlich aber verkündet der Kaiser bei Herrschaftsbeginn eine ganz andere Parole. In einer Rede in Bordeaux verkündet er: »Aus dem Geist des Misstrauens sagen sich gewisse Personen: Das Kaiserreich ist der Krieg. Ich sage: das Kaiserreich ist der Friede.«46 Und tatsächlich ist Louis-Napoleon kein kriegerischer Charakter und auch kein militärisches Genie. Dennoch ist Napoleon III. seiner Armee als einem der Hauptpfeiler des Staates und der Größe Frankreichs im Konzert der europäischen Mächte verpflichtet. Siegreiche Kriege sind überlebensnotwendig für seine Herrschaft, aber ebenso für das Ansehen Frankreichs. Nicht zuletzt fordern die Generale, die Napoleons Putsch vom Dezember 1851 militärisch durchführten, ihr Recht auf Siege und Orden.
Bei Amtsantritt des neuen Kaisers ist Frankreich keineswegs gleichberechtigt im Zusammenspiel der Großmächte. Frankreich gilt – mit Recht – als Hort der Revolution, der Terror des ersten Napoleon ist in Europa keineswegs vergessen. Den etablierten Adelshäusern ist der Parvenu auf dem selbstgezimmerten, vom Volk abgesegneten Kaiserthron ohnehin suspekt. Erstes Ziel der Außenpolitik des 2. Kaiserreichs ist es daher, Frankreich wieder jenen Platz zu verschaffen, den es seiner Geschichte und Größe glaubt schuldig zu sein. Die Behauptung, dass das Kaiserreich ›der Friede‹ sei, ist schnell wieder vergessen.
Eine erste Gelegenheit, wieder Ruhm an die französischen Fahnen zu heften, ist der Krimkrieg. Im Konflikt zwischen dem Osmanischen Reich und Russland greifen Frankreich, England und Sardinien-Piemont gegen das Zarenreich ein. Der Krieg, der von 1853 bis 1856 dauert und sich vor allem auf der Krimhalbinsel abspielt, kostet durch militärische Fehler, mangelnde Versorgung und Seuchen ungeahnte Mengen an Menschenleben. Die Zahlen sind unterschiedlich, es werden aber etwa 165 000 Tote angenommen, von denen um die 100 000 Mann an Seuchen, ungenügender Wundversorgung und Krankheiten sterben.
Zugleich gilt der Krimkrieg als der erste ›moderne‹ Krieg des Industriezeitalters. Wir sehen hier alle Zutaten der im 19. Jahrhundert beginnenden industrialisierten Kriegführung: Einsatz weitreichender Geschütze mit großer Zerstörungskraft und gepanzerter, dampfgetriebener Kriegsschiffe, Verwendung von Gewehren mit gezogenem Lauf, Bau einer ersten militärischen Bahnstrecke. Eine wichtige Neuerung ist auch der militärische Einsatz von Feldtelegrafen, welche die Kommunikation auf dem Schlachtfeld stark beschleunigten. Der Bau einer Unterwasserkabelverbindung innerhalb von knapp drei Wochen durchs Schwarze Meer vom bereits mit Paris verbundenen osmanischen, heute bulgarischen Warna nach Balaklawa auf der Krim ermöglicht es den englischen und französischen Befehlshabern, innerhalb eines Tag vom Kriegsschauplatz nach London oder Paris Nachrichten zu kabeln und Entscheidungen zu empfangen. Anders als früher wird dadurch die letzte Entscheidungsgewalt über das Geschehen auf dem Schlachtfeld weg von den Befehlshabern vor Ort hin zur Politik in den weit entfernten Hauptstädten verlagert. Napoleon III. macht von dieser Möglichkeit – nicht immer zur Freude seiner und der englischen Generale – häufig Gebrauch.
Die enorme Beschleunigung der Nachrichtenübermittlung erhöht zugleich das Tempo der Presseberichterstattung. Zum ersten Mal kann das Publikum die Geschehnisse auf einem fernen Kriegsschauplatz fast in ›Echtzeit‹ in den Zeitungen nachvollziehen. Die bisher unbekannte Intensität und Geschwindigkeit, mit der seriöse Zeitungen, aber auch die Sensationspresse so auf die öffentliche Meinung einwirken können, hat zudem Folgen für das Kriegsgeschehen. Ein wichtiger Zeuge und einflussreicher Meinungsmacher ist der schon genannte ›Times‹-Korrespondent William Howard Russell. Nach einer Zeitungskritik Russells über Ausrüstungsmängel sieht sich beispielsweise die englische Generalität im Krimkrieg gezwungen, Verbesserungen vorzunehmen. Kriege müssen ab jetzt zugleich mit Rücksicht auf die öffentliche Meinung geführt werden, was sowohl die Führung als auch die Freiheit der medialen Begleitung künftiger Kriege stark beeinflussen wird. Noch im Krimkrieg wird die militärische Pressezensur eingeführt. Dazu kommt, dass der Krimkrieg der erste Krieg ist, den Fotografen mit staatlich-propagandistischemsind Auftrag in Bildern festhalten. Obwohl die Bilder meist gestellt und geschönt sind, kann sich das Publikum daheim in den Lehnsesseln erstmals ein wirkliches Bild vom Krieg machen. Mit dem in Paris 1856 unter seiner Führung abgeschlossenen Friedensvertrag, der die Niederlage Russlands besiegelt, hat Napoleon III. Frankreich wieder unter den führenden Nationen Europas etabliert.
Bereits seit seiner Jugend ist der Kaiser ein Anhänger der französischen Revolutionsidee der ›Nation‹ als Ordnungselement in Europa. Napoleon möchte eine Neuordnung Europas nach dem Prinzip des Nationalstaatsgedankens und damit eine radikale Abkehr vom System des ›Wiener Kongresses‹ mit seiner dynastischen Ordnung. Selbstverständlich soll dieses Nationalstaatseuropa unter französischem Einfluss stehen. Der natürliche Feind Frankreichs ist so der Vielvölkerstaat Österreich, der kein Interesse am Erfolg des Nationalstaatsprinzips haben kann. Im Jahre 1859 zieht er gemeinsam mit den Kampfgefährten von der Krim, dem Königreich Sardinien-Piemont, in einen Krieg gegen Österreich, der den Startschuss zur nationalen Einigung Italiens geben soll. Auch dieser ›Sardinische Krieg‹ fordert unvorhergesehene Verluste. Die siegreiche ›Bataille de Solferino‹ in Norditalien kostet allein ca. 30 000 Mann. Ein Schweizer Geschäftsmann ist in Solferino unfreiwilliger Augenzeuge der hier wiederum katastrophal mangelhaften Versorgung der Verwundeten. Henri Dunant sind seine Erlebnisse Anlass zur Gründung des Roten Kreuzes. Der sensible Kaiser ist gleicherweise schockiert. Als untätiger Oberbefehlshaber auf dem Schlachtfeld anwesend, bricht Louis Napoleon am Tag nach der Schlacht beim Ritt über das Kampffeld im Angesicht der Leichenberge und Sterbenden weinend zusammen. Diese menschliche Reaktion wirft ein bezeichnendes Licht auf den weichen Charakter eines Mannes, der auch in dieser Hinsicht nur eine schwache Kopie seines berühmten Onkels ist.
Bei der Schlacht von Magenta erwirbt sich der französische Befehlshaber Patrice de Mac-Mahon so große Verdienste, dass er zum ›Maréchal de France‹ und zum ›Herzog von Magenta‹ ernannt wird. Die Einigung Italiens unter Führung Sardinien-Piemonts gelingt, wie schon an anderer Stelle erwähnt. Allerdings müssen als Preis der französischen Hilfe die mehrheitlich italienischsprachigen Gebiete Savoyen und Nizza an Frankreich abgetreten werden. Mit diesen, gegen das Prinzip des Nationalitätsstaats verstoßenden Annexionen zieht Napoleon großes Misstrauen auf sich. Viele Beobachter sehen darin den Beweis, dass es dem Kaiser weniger um die Idee der Nation als um eine Vergrößerung Frankreichs gehe. Mit Rücksicht auf seine katholische Bevölkerung und den Klerus verhindert Napoleon mit französischen Truppen zudem, dass auch der Kirchenstaat Teil des neuen italienischen Staates wird. Rom ist von französischen Truppen besetzt, welche die Unabhängigkeit des Papstes sichern. Das ist ein weiterer Widerspruch zum von Napoleon propagierten Nationalismus. Viele Italiener, denen der Schlachtruf ›Roma capitale‹ zum Lebenszweck wird, fühlen sich von Napoleon III. verraten. Sie erkennen, dass Napoleon mit Rom ein Faustpfand in der Hand behalten will, mit dem er weiter Einfluss in Italien nehmen kann.
Auch kleinere militärische Unternehmungen in Syrien und China sind aus französischer Sicht erfolgreich. In Syrien interveniert Napoleon 1860 mit 12 000 Soldaten zum Schutz der bedrohten christlichen Minderheit und im selben Jahr wird gemeinsam mit englischen Truppen in der ›Schlacht von Palikao‹ China im 2. Opiumkrieg bezwungen. 1862 wird Cochinchina, heute Südvietnam, für Frankreich als Kolonialgebiet gewonnen.
Napoleon ist es bis dahin mit allen seinen kriegerischen Unternehmungen gelungen, auf Kosten anderer Völker und um den Preis vieler verlorener Menschenleben Frankreichs Ehre auf dem Schlachtfeld wiederherzustellen. Das Kaiserreich ist so keineswegs ›der Friede‹, was vielen Franzosen jedoch so lange gleichgültig ist, wie das Kaiserreich seine Kriege gewinnt und es mehrheitlich die Söhne der ›anderen‹ sind, die sterben müssen. Doch das nächste Kriegsabenteuer endet in einem Desaster, das Folgen haben wird.
In Mexiko regiert seit 1861 eine liberale Revolutionsregierung unter ihrem Führer Benito Juárez. Diese Regierung hat Schwierigkeiten, Anleihen zurückzuzahlen, die zuvor von der korrupten Vorgängerregierung bei europäischen Mächten gezeichnet worden waren. Juárez stellt die Zahlungen schließlich ein. England, Spanien und Frankreich vereinbaren eine Strafexpedition nach Mexiko zur Eintreibung des Geldes. Nach der Landung der Alliierten im mexikanischen Veracruz wird ein Zahlungsmoratorium ausgehandelt und Engländer und Spanier ziehen wieder ab. Das französische Expeditionskorps von 7000 Mann jedoch bleibt. Napoleon III. möchte Mexiko als politisches und wirtschaftliches Gegengewicht gegen die Vereinigten Staaten aufbauen, während diese durch den Amerikanischen Bürgerkrieg abgelenkt sind. Gelingen soll dies durch die Einrichtung eines von Frankreichs Gnaden errichteten mexikanischen Kaiserreichs, auf dessen Thron der Sohn einer großen europäischen Dynastie sitzen soll. Dieser eigenwillige Plan, eine mittelamerikanische Republik in eine Monarchie nach europäischem Vorbild umzuwandeln, konnte nur durch eine sich aus kolonialer Überheblichkeit speisenden völligen Unkenntnis der Verhältnisse in Mexiko entstehen. Tatsächlich findet Napoleon einen europäischen Fürsten, der tollkühn genug ist, sich auf dieses Selbstmordkommando einzulassen. Erzherzog Maximilian, der jüngere, schwärmerisch veranlagte Bruder des österreichischen Kaisers Franz Joseph findet sich bereit, sein Leben in Mexiko zu opfern. Bis 1864 stehen bereits 50 000 französische Soldaten in Mexiko, die immer wieder in Kämpfe verwickelt werden. Geführt wird das französische Expeditionskorps von Marschall François-Achille Bazaine. Im Juni 1864 besteigt Maximilian mithilfe der ausländischen Invasoren seinen Kaiserthron in Mexiko-Stadt und installiert eine verhasste Marionettenregierung. Seine Mühen um liberale Reformen scheitern. Anfang 1865, nach dem Sieg der Nordstaaten im Amerikanischen Bürgerkrieg, unterstützen die USA Juárez und bringen Napoleon und Maximilian in die Defensive. Ein unerbittlicher Guerillakrieg folgt. Dies und die in Frankreich nicht mehr vermittelbaren Kosten der skurrilen Expedition bringen Napoleon schließlich dazu, Anfang 1866 den Rückzug Frankreichs aus Mexiko zu verkünden. Skrupellos überlässt Napoleon damit Maximilian seinem Schicksal. Schließlich wird der Österreicher nach nur drei Jahren als Kaiser von Mexiko gestürzt und am 19. Juni 1867 in Queretaro hingerichtet. Édouard Manet, der große französische Impressionist, hat die dramatische Erschießung Maximilians in mehreren Bildversionen verewigt. Auf der bekanntesten Version tragen die Schützen des Erschießungskommandos Uniformen, die denen der französischen Armee sehr ähneln. Ein Soldat am rechten Bildrand trägt die Züge Napoleons III. Die kaiserliche Zensur verbietet die Zurschaustellung des Gemäldes, versteht sie doch Manets Vorwurf nur zu gut. Dieser Mord ist Napoleons Menetekel an der Wand.
Abb. 3: Édouard Manet, Die Erschießung Kaiser Maximilians von Mexiko, 1868
Der von Napoleon in seinen deutschen Plänen 1866 nicht einkalkulierte Sieg Preußens in Königgrätz, das damit verbundene vorläufige Scheitern aller linksrheinischen Ansprüche und das Debakel in Mexiko haben das Ansehen des Kaisers in kurzer Zeit untergraben. Das politische Zwittersystem aus pseudodemokratischen Volksabstimmungen und autoritärer Herrschaft mit liberalen Anteilen war so lange tragfähig, wie die Wirtschaft florierte und militärische Erfolge Napoleons Regime legitimierten. Das Jahr 1866 jedoch reißt Napoleon die angemaßte Feldherrnmaske seines Onkels vom Gesicht und zeigt ihn als das, was er ist: als einen zögerlichen, im Grunde seines Herzens weichen Spieler, der sich ›verzockt‹ hat und sein Regime angesichts sinkender Wirtschaftsdaten, außenpolitischer Misserfolge und unübersehbarer Korruption auf allen Ebenen nicht mehr unter Kontrolle hat. Hinzu kommt, dass Napoleons Gesundheit zunehmend Anlass zur Sorge gibt. Blasensteine bereiten ihm große Schmerzen, Schlaflosigkeit schwächt ihn zusätzlich. Eigenmächtigkeiten seiner Minister beschleunigen darüber hinaus den dramatischen Machtverfall Napoleons und des Second Empire, das allmählich in Agonie verfällt.